Stressmanagement - Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress
Die vorliegende Diplomarbeit Stressmanagement - Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress von Elke Krauss wurde im Rahmen des Pädagogikstudiengangs an der Universität Augsburg verfasst und beschäftigt sich mit der Progressiven Muskelentspannung, dem Autogenen Training und dem Yoga in der Erwachsenenbildung. Inhaltlich werden die Themengebiete Gesundheit und Stress jeweils beleuchtet und Stressmanagment anhand zusammengetragener Entspannungsverfahren erläutert.

Einleitung
„In der Ruhe liegt die Kraft“ Diese 2500 Jahre alte, bekannte Weisheit des berühmten und einflussreichen chinesischen Philosophen K`ung-fu-tzu ist nach wie vor gültig und, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland des 21. Jahrhunderts, von besonderer Aktualität. „Arbeits-Stress“ etwa hat sich in den Industriestaaten laut einer repräsentativen Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der UNO zu einer „Jahrhundert-Epidemie“ entwickelt. Gesundheitsexperten gehen bereits 1970 davon aus, dass mehr als die Hälfte aller Krankheiten stressbedingt sind (vgl. Zimbardo 19956, S. 580). Bis 1995 ist diese Zahl weiter angestiegen: zwei Drittel aller Krankheiten sind inzwischen auf Stress zurückzuführen, und die Kosten für stressbedingte Krankheitsschäden verschlingen jährlich mindestens zehn Prozent des Bruttosozialproduktes (in Deutschland etwa 60 Milliarden DM) (vgl. Huber 1995, S. 21). Stress stellt kein neues Phänomen dar, allerdings sind sich Gesundheitswissenschaftler einig, dass der Stresspegel heute höher ist als je zuvor. Die Mehrzahl der Menschen leidet unter Erschöpfung und die wenigsten können den alltäglichen Dauerstress in Beruf, Familie und Freizeit bewältigen.
In dieser hektischen, technologisierten, durch Konkurrenzkampf bestimmten, konsum- und leistungsorientierten Gesellschaft begegnen heute immer mehr Menschen durch die Kraft der Entspannung unzähligen Stressoren. Zunehmend wird erkannt, dass umfassendes Stressmanagement vom persönlichen Lebensstil jedes Einzelnen abhängt und die Forderung nach einer „Kultur der Entspannung“ (Vaitl; Petermann 20002, S. 21) wird laut. In den letzten Jahrzehnten haben sich verschiedene Entspannungstechniken (meist beeinflusst durch fernöstliche Methoden) in der westlichen Welt stark verbreitet. Die Palette der Angebote in diesem Bereich ist vielfältig. Unter Rubriken wie Reiki, Die fünf Tibeter, Feldenkrais, Tai Chi, Qi Gong, Meditation, Yoga, Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung (um nur einige zu nennen) sind mittlerweile eine fast unüberschaubare Menge an Kursen, Büchern und Videos auf dem Markt.
Allzu leicht sind viele Menschen versucht, diese Techniken als Humbug oder Spinnerei abzutun. Auch der in der Alltagssprache dafür gern verwendete Begriff „Esoterik“, unter dem fast alle unorthodoxen Techniken zusammengefasst werden, die sich mit Körper, Seele und Geist auseinandersetzen, ist für die Mehrzahl der Menschen in der westlichen Welt negativ besetzt oder hat zumindest einen unangenehmen Beigeschmack. Für meine Begriffe erstaunlich, da sich viele dieser Methoden beispielsweise in Kursangeboten der Volkshochschulen, Krankenkassen und Fitnessstudios, in den psychiatrischen und therapeutischen Einrichtungen, in Rehabilitationszentren, teilweise sogar in den Schulen und Sonderschulen etabliert haben.
Insofern scheint es von Bedeutung zu sein, zwischen Mythen und Fakten in diesem Bereich zu unterscheiden. Der Gedanke, über ausgewählte Entspannungsverfahren aufzuklären, ist einer der Gründe, warum ich diese Thematik im Rahmen einer Diplomarbeit wissenschaftlich beleuchte. Vergegenwärtigt man sich, dass beispielsweise schon vor sechs Jahren laut Unverzagt (1997) allein in Deutschland rund drei Millionen Menschen den Yoga praktizieren und damit neben einer Vielzahl von Vorteilen auf körperlicher, geistiger und seelischen Ebene auch besser mit Stress umgehen können, so fällt es schwer zu verstehen, dass sich die wissenschaftliche Forschung bisher kaum mit diesem Thema beschäftigt hat. Sachliche Aufklärung sowie fundierte empirische Studien wären hier von großem Nutzen, um Vorurteile, Irrtümer, falsche Anwendungen sowie übertriebene Erwartungen und Ängste bezüglich verschiedener Entspannungsverfahren innerhalb der Bevölkerung vorbeugen zu können. Mit dieser Arbeit möchte ich daher einen Schritt in diese Richtung machen und diskutiere, eingebettet in dem großen Rahmen Stressmanagement, folgende drei Entspannungsverfahren: die Progressive Muskelentspannung, das Autogene Training und den Yoga. Sie werden in dieser Arbeit als eine mögliche Bewältigungsmaßnahme von Stress dargestellt und in einen pädagogischen Zusammenhang gebracht. Dabei konzentriere ich mich auf den Bereich der Erwachsenbildung. Dass ich genau diese drei Entspannungsmethoden auswähle, ist einerseits mit persönlichem Interesse daran begründet und hängt andererseits mit dem Bekanntheitsgrad, der Verbreitung und damit einhergehend der wissenschaftlichen Erforschung dieser Methoden zusammen. Auf alle anderen Entspannungsverfahren einzugehen, würde zudem den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen. Innerhalb der pädagogischen Diskussion von Entspannungsverfahren setze ich den Schwerpunkt auf die Erwachsenenbildung aus folgenden Gründen. Erstens besteht auch hier die Notwendigkeit der thematischen Eingrenzung. Zweitens habe ich vor, in diesem Bereich tätig zu sein, weshalb es mir aus pragmatischen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint, mich im Laufe der Anfertigung der vorliegenden Arbeit mit theoretischen Aspekten der Erwachsenenbildung auseinander zu setzen.
Ein weiterer Grund, das Thema Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress im Rahmen dieser Diplomarbeit zu behandeln, ist subjektiver Art, nämlich der persönliche Bezug zu Entspannungsverfahren. Neben verschiedenen Methoden, wie Tai Chi, Qi Gong oder Meditation, die ich mir in Kursen an der Volkshochschule, der Universität und Meditationszentren angeeignet habe, erlernte ich vor drei Jahren auch das Autogene Training. Ich habe im Jahr 2000 zwei Kurse, einen Grund- und einen Aufbaukurs, an der Volkshochschule besucht, mit dem vorrangigen Grund vorbeugend ein Verfahren zu erlernen, um die anstehenden Diplom-Prüfungen zu bewältigen. Seither praktiziere ich es täglich. Des Weiteren lerne und praktiziere ich seit zwei Jahren den Yoga und interessiere mich ferner grundsätzlich für das Thema Gesundheit, vor allem für die Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und Seele, die ich als Einheit sehe. Zudem hatte ich bisher schon mehrfach die Gelegenheit, als „Entspannungslehrerin“ mit verschiedenen Zielgruppen zu arbeiten. Beispielsweise habe ich eine Klasse mit arbeitslosen ausländischen Mitbürgern zwischen 25 und 50 Jahren am BBZ im Fach Entspannung unterrichtet. Um Theorie und Praxis noch besser miteinander verbinden zu können, erscheint es mir sinnvoll meine theoretischen Kenntnisse zum Thema Stress und Entspannung im Zuge der Erstellung dieser Diplomarbeit zu vertiefen. Schließlich habe ich vor, nach Abschluss des Diplom-Pädagogik Studiums auf diesem Gebiet weitere praktische Erfahrungen zu sammeln. Anfangs als Dozentin für Entspannung und nachdem ich eine entsprechende Zusatzausbildung absolviert habe, auch als Yogalehrerin. Mit der Offenlegung des persönlichen Hintergrundes, weise ich darauf hin, dass ich eine gewisse praktische und theoretische Erfahrung diese Thematik betreffend aufweise, sie aber trotzdem aus einem neutralen, offenen und kritischen Blickwinkel heraus betrachte.
Das erste Ziel dieser Arbeit besteht in der Untersuchung der verschiedenen Aspekte des Stressgeschehens, der Auswirkung von Stress auf die Gesundheit und schließlich der ausgewählten Entspannungsverfahren als eine mögliche Maßnahme der Stressbewältigung. Dafür trage ich aus der Literatur die bisherigen Erkenntnisse zu dieser Thematik zusammen. Das zweite Ziel dieser Arbeit besteht in der pädagogischen Diskussion der ausgewählten Entspannungsverfahren. Die Frage, in welcher Form und mit welchen Zielen die vorgestellten Entspannungsverfahren speziell in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden können, gilt es zu beantworten. Die vorliegende Arbeit richtet sich an alle, sowohl Laien als auch Experten, die sich mit dem Thema Stressmanagement beschäftigen und daran interessiert sind, ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet zu vertiefen und zu erweitern.
Gesundheit
Die Begriffe Gesundheit und Krankheit sind eng verknüpft mit den Begriffen Entspannung und Stress. Stress ist wie eingangs schon erwähnt, gegenwärtig ein entscheidender Faktor, der zur Entstehung vieler Krankheiten beitragen kann. In diesem Kapitel setzte ich mich deshalb zunächst mit dem Gesundheits- und Krankheitsbegriff auseinander. Des Weiteren untersuche ich den Wandel im Gesundheits- und Krankheitsverständnis und erörtere die aktuelle Situation diese Thematik betreffend. Schließlich stelle ich ein Gesundheitsmodell, das Modell der Salutogenese, vor.
Auseinandersetzung mit dem Gesundheitsbegriff
Auf den ersten Blick scheinen die Begriffe Gesundheit und Krankheit eindeutig definiert. Gesundheit lässt sich mit Wohlbefinden und Abwesenheit von Symptomen beschreiben. Mit Krankheit hingegen werden Beschwerden, Schmerzen und Einschränkungen verbunden. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Bereich die Begriffe Gesundheit und Krankheit unterschiedlich definiert sein können. Für manche ist Gesundheit gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Glück, andere verstehen darunter das Freisein von körperlichen Beschwerden und wieder andere verstehen darunter die Fähigkeit des Organismus, mit Belastungen fertig zu werden. Diese subjektiven Vorstellungen entwickeln sich in der Sozialisation jedes einzelnen und in einem spezifischen gesellschaftlichen Kontext. Die Wahrnehmung körperlicher Beeinträchtigungen wird durch die soziale und individuelle Einschätzung beeinflusst. Dieser Einschätzungsprozess ist zwar auch abhängig von der Schwere der Symptome, aber die Wahrnehmung von persönlichen und sozialen Ressourcen hat dennoch entscheidenden Einfluss auf die subjektive Befindlichkeit und auf das gesundheitsbezogene Verhalten einer Person (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15).
Ansätze zur Definition von Gesundheit
Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen zur Definition von Gesundheit und Krankheit, mit dem gemeinsamen Problem der klaren Grenzziehung zwischen dem, was noch als gesund, und dem, was schon als krank zu bezeichnen ist. Sie orientieren sich an unterschiedlichen Gesundheitsnormen. Die jeweiligen Definitionen haben einen Einfluss darauf, welche Mittel als angemessen und notwendig für die Wiederherstellung, für den Erhalt und die [[Förderung]9 von Gesundheit angesehen werden. Zudem entscheiden sie darüber, welche Einflussmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten für die Krankheitsentstehung und Heilung einer Person zugeschrieben werden können oder sollen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15). Bereits die Wortstämme von Gesundheit und Krankheit geben entscheidende Hinweise zu möglichen Definitionsansätzen. Das deutsche Wort gesund kommt etymologisch vom germanischen „swend(i)a“ bzw. „(ga)sundia“, was so viel bedeutet wie stark, kräftig und geschwind (vgl. Haug 1991, S. 21). Das englische Wort „health“ (altenglisch: „hale“) hat ebenso wie das deutsche Wort „heil“ den Bedeutungsgehalt von ganz. Ein interessanter Hinweis der Alltagssprache scheint auch, dass im Englischen der Gegenpol zu Krankheit („dis-ease“) durch den Begriff „ease“ markiert wird, was sich annähernd mit Sorglosigkeit, Leichtigkeit und Behaglichkeit übersetzen lässt (vgl. Faltermaier 1994, S. 55).
Eine Idealnorm von Gesundheit bezeichnet einen Zustand von Vollkommenheit, den zu erreichen wünschenswert oder wertvoll ist. Mit ihrer Definition von Gesundheit als „Zustand eines vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit“ (zitiert nach Faltermaier 1994, S. 56) hat die World Health Organisation (WHO) 1948 eine Idealnorm gesetzt. Allerdings wird diese Definition hinsichtlich ihrer Realitätsferne kritisiert, da „absolute Zustände nicht zu erreichen sind“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15). Positiv zu bewerten ist meiner Meinung nach, dass diese Definition den Menschen in seiner Ganzheit anspricht, als Einheit von Körper und Psyche, aber auch als System, das nach außen offen ist, und in Interaktion mit der Umwelt Gesundheit schafft.
Die statistische Norm von Gesundheit wird durch Auftretenswahrscheinlichkeiten einer Eigenschaft des Organismus bestimmt. Was auf die Mehrzahl der Menschen zutrifft, wird als gesund definiert. Abweichungen von diesen Durchschnittswerten sind dagegen als krank zu bezeichnen. Für die Einordnung einer Person als krank oder gesund sind also die Bezugspopulation (Referenzgruppe, zum Beispiel nach Alter und Geschlecht) und die festgelegten Grenzwerte relevant (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15f.). Als system-funktionalistische Norm orientiert sich Gesundheit daran, ob eine Person in der Lage ist, die durch ihre sozialen Rollen gegebenen Aufgaben zu erfüllen. So definiert der Soziologe Talcott Parsons in den 1960ern Gesundheit als „Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist“ (Schiffer 2001, S. 39). Krankheit wird in diesem Zusammenhang als Form abweichenden Verhaltens verstanden, da die Unfähigkeit zur Rollenerfüllung das Fortbestehen eines sozialen Systems gefährdet (vgl. Faltermaier 1994, S. 29). Gesundheit als Leistung wird am unverblümtesten im Nationalsozialismus propagiert. Gesundheit wird zur Pflicht an der „Volksgemeinschaft“, Krankheit gilt als Verweigerung, und derjenige, dessen Arbeitskraft sich nicht wiederherstellen lässt, wird als unwert ausgegliedert (vgl. Schiffer 2001, S. 39).
Innerhalb des medizinischen Systems sind die Definitionen von Gesundheit in der Regel Negativbestimmungen, das heißt Gesundheit wird als Abwesenheit oder Freisein von Krankheiten beschrieben. Beim Vorhandensein von Beschwerden oder Symptomen wird eine Person als krank eingestuft. Dieses Begriffsverständnis der Experten, der Ärzte und Therapeuten trifft auf die Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sogenannter Laien, der Patienten. Diese rein biomedizinische Betrachtungsweise vernachlässigt wichtige Dimensionen des Befindens, wie z.B. Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden. Personen mit physischen Schädigungen können sich unter psychischen Gesichtspunkten als gesund bezeichnen, wenn sie sich trotz der Erkrankung beispielsweise ihre Genuss- und Leistungsfähigkeit erhalten können (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 16). Gesundheit ist also kein eindeutig definierbares Konstrukt; sie ist kaum fassbar und nur schwer zu beschreiben. Heute besteht in den Sozialwissenschaften und der Medizin Einigkeit darüber, dass Gesundheit mehrdimensional betrachtet werden muss. Neben körperlichem Wohlbefinden (z.B. positives Körpergefühl, Fehlen von Beschwerden und Krankheitsanzeichen) und psychischem Wohlbefinden (z.B. Freude, Glück, Lebenszufriedenheit) gehören auch Leistungsfähigkeit, Selbstverwirklichung und Sinnfindung dazu. Gesundheit hängt ab vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung und dem Umgang mit Belastungen, von Risiken und Gefährdungen durch die soziale und ökologische Umwelt sowie vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung, Erschließung und Inanspruchnahme von Ressourcen. Die sozialwissenschaftlichen Definitionsversuche des Phänomens Gesundheit zeichnen sich dabei durch eine Komplexität aus, die historisch betrachtet als Neu zu bezeichnen ist (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15f.).
Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit stelle ich im folgenden eine entsprechende Konzeption von Gesundheit vor. Dabei schließe ich mich Faltermaier (1994) an, der auf Basis der einschlägigen Literatur einige Bestimmungsstücke von Gesundheit zusammengestellt hat. Gesundheit bedeutet demnach zunächst einen bestimmten körperlichen und psychischen Zustand des Individuums, der vom Subjekt erlebbar ist. Diese bestimmte Befindlichkeit (eine Art Wohlbefinden) impliziert eine relative Freiheit von Beschwerden, Beeinträchtigungen und Krankheit. Das Erleben von Gesundheit setzt in jedem Fall die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion einer Person voraus. Gesundheit bedeutet somit ein bestimmtes Verhältnis einer Person zu ihrem Körper und zu ihrer Psyche und ist insofern Teil der Identität einer Person. Gesundheit ist kein statischer Zustand, sondern in permanenter Veränderung, ist also ein Prozess, der immer wieder hergestellt werden muss, da sich das Individuum in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt ständig verändert. Daher setzt Gesundheit ein transaktionales Verständnis der Person-Umwelt-Interaktion voraus. Eine Person muss auf Anforderungen ihrer sozialen und ökologischen Umwelt reagieren und wirkt umgekehrt durch ihre Handlungen auf die Umgebung ein, gestaltet Beziehungen und die materielle Umwelt. Dadurch verändern sich die Person und ihre Umwelt.
Systemtheoretisch betrachtet ist die Person ein offenes System, das sich, wenn es gesund ist, in einem dynamischen Gleichgewicht befindet. Die Bedeutung der Gesundheit liegt darin, dass sie Voraussetzung für Lebensaktivitäten ist, auch dafür, sich im Leben zu verwirklichen: sie stellt demnach ein gewisses Potential dar, Ressourcen zu besitzen und mobilisieren zu können, um zu handeln. Gesundheit meint in diesem Sinne Handlungsfähigkeit, die gleichzeitig Leistungs- und Erlebnisfähigkeit umfasst. Was eine Person als ausreichendes Potential versteht und dann für sich als Gesundheit definiert, hängt von ihrer persönlichen Norm ab, die in vielfältiger Weise von sozialen Normen beeinflusst wird. Obwohl Gesundheit also immer eine Norm impliziert, muss ein Begriff von Gesundheit genügend offen bleiben, um auch Wachstums- und Entwicklungsprozesse einer Person erfassen zu können. Wenn Gesundheit immer im Wandel ist und immer wieder hergestellt wird, dann bedeutet das lebensgeschichtlich einen Entwicklungsprozess und in sozialer Hinsicht eine Sozialisation von Gesundheit. Gesundheit ist zwar zunächst ein Phänomen, das sich am Individuum bemerkbar macht, aber ohne den sozialen Kontext nicht verständlich ist. Wie eine Person mit ihrer sozialen Umwelt interagiert und dabei ihr dynamisches Gleichgewicht erhält ist ebenso wesentlich ein sozialer Prozess wie die Entwicklung ihres Potentials und ihrer Ressourcen. Gesundheit muss daher immer auch als soziale Kategorie verstanden werden (vgl. Faltermaier 1994, S. 57f.).
Glück und Wohlbefinden
Das Streben nach Glück und Wohlbefinden ist ein zentrales Anliegen des Menschen: „jeder Mensch möchte gern möglichst umfassend und möglichst immer glücklich sein und sich wohlfühlen“ (Abele; Becker 1991, S. 9). Da beide Begriffe eng mit dem Begriff der Gesundheit einer Person verbunden sind, schenke ich ihnen an dieser Stelle Beachtung.
Glück ist ein „komplexes Gebilde aus verschiedensten Emotionen, Einstellungen und Erfahrungen“ (Boeser; Schörner; Wolters 20022, S. 126). Das erschwert eine einheitliche wissenschaftliche Definition. Grundsätzlich wird zwischen einem aktuellem und einem habituellem Glückszustand unterschieden. Beispiele zur Komponente des aktuellen Glückserleben sind aus emotions- und gesundheitspsychologischer Sicht: Freude, sinnliche Erfahrungen und schöpferische Momente (vgl. ebd.). Aus persönlichkeitspsychologischer Sicht wird Glück als „ein harmonisches Zusammenwirken aller Gefühle einer ‚runden’ Persönlichkeit“ (ebd.) definiert. Damit ist gemeint, dass sich eine Person im Gleichgewicht befindet oder gesund ist. Nach meinem Begriff handelt es sich dabei um ein überdauerndes Gefühl, und kann insofern auch als habituelles Glück bezeichnet werden. Eine Möglichkeit diesen als „glückliche Befindlichkeit“ (ebd., S. 128) bezeichneten Zustand zu beeinflussen, ist „auf seine Gesundheit [zu] achten“ (ebd.; Anpassung: E. K.).
Wohlbefinden wird in der Fachliteratur nicht einheitlich und häufig ohne Bemühung um definitorische Präzision verwendet. In diesem Zusammenhang schlagen Abele; Becker (1991) vor, zwischen habituellem und aktuellem Wohlbefinden zu unterscheiden. Diese Einteilung wird kombiniert mit psychischem und physischem Wohlbefinden, woraus sich die in Abb.1. dargestellte Struktur des Wohlbefindens ergibt. Es handelt sich dabei um eine im thematischen Zusammenhang verkürzte Form, deren wesentliche Elemente ich nachfolgend beschreibe.

Abele; Becker (1991) definieren aktuelles Wohlbefinden als „Oberbegriff zur Charakterisierung des momentanen Erlebens einer Person, der positiv getönte Gefühle, Stimmungen und körperliche Empfindungen sowie das Fehlen von Beschwerden umfasst“ (S. 13). Bei habituellem Wohlbefinden handelt es sich um „Aussagen über das für eine Person typische Wohlbefinden, d.h. um Urteile über aggregierte emotionale Erfahrungen“ (ebd. S. 15). Durch den Begriff Urteile soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich dabei um ein Ergebnis kognitiver Prozesse handelt (vgl. ebd.). Die Gesundheitsdefinition der WHO beschreibt Gesundheit als einen Zustand des Wohlbefindens. Damit lässt sich Gesundheit zu der Kategorie des habituellen Wohlbefindens einordnen.
Psychisches Wohlbefinden ist unter anderem durch eine positive Stimmung gekennzeichnet. In Verbindung mit einem niedrigen Erregungszustand wird sie als Gelassenheit und als Entspannung (relaxation) bezeichnet (vgl. Abele; Becker 1991, S. 30f.). Physisches Wohlbefinden ist unter anderem durch positive körperliche Empfindungen gekennzeichnet, wie z.B. der „Entspanntheit“ (ebd., S. 73). Anhand dieses Modells lassen sich meiner Meinung nach Entspannungsverfahren dem Begriff der Gesundheit zuordnen. Entspannungsverfahren wirken sich auf das psychische und körperliche Wohlbefinden bzw. die Gesundheit einer Person aus. Dabei tragen sie sowohl zu einem momentanen wie auch zu einem überdauernden Wohlbefinden der Person bei.
Gesundheit im Wandel der Zeit
Das Verständnis von Gesundheit und Krankheit unterliegt einem ständigem Wandel. Es ist geprägt von kulturellen und historischen Einflüssen, wie zum Beispiel Fortschritten in der Medizin, Umweltbelastungen oder Veränderungen des Lebensraumes und der Lebensweise. Bereits in der griechischen Antike beschäftigen sich Philosophen wie Plato, Aristoteles und Hippokrates mit der Gesundheit und deren Erhaltung. Gesundheit wird als das „höchste Gut“ (Haug 1991, S. 81) betrachtet. Exemplarisch beschreibe ich die Lehre von der Diaita (Regelung zur Lebensordnung) als Teil bedeutender gesundheitspädagogischer Werke und Fragmente (5./4.Jh. v.Chr.). Sie umfasst die gesamte Lebensweise des Menschen mit Regeln zur gesunden Lebensführung und basiert auf der Auffassung, jeder einzelne könne seine Gesundheit durch entsprechende Lebensführung erhalten. Die praktischen Anleitungen der sogenannten Diätik schließen alle Lebensbereiche ein und geben sehr konkrete Anweisungen zu Ernährung, Bewegung, Entspannung und Körperpflege. Insgesamt kann als Fundament dieser diätetischen Ausführungen die Erziehung zur Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung hinsichtlich psychophysischer Veränderungen betrachtet werden. Diese soll dem Einzelnen die Möglichkeit eröffnen, schon bei geringfügigen Störungen rechtzeitig eingreifen zu können, um den Schaden zu minimieren. Durch Selbstdisziplin, Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung wird der Mensch also fähig, sich seine Gesundheit zu bewahren. Der Anschein von Aufgeklärtheit und Mündigkeit wird jedoch relativiert, wenn man sich bewusst macht, dass dies ein Privileg einer kleinen männlichen Oberschicht und nicht für die breite Volksschicht gedacht war. Diese Ideen bilden dennoch die Basis der heutigen Hygiene und Medizin und stellen eine bestimmende Kraft für die Entwicklung europäischer Gesundheitsbildung dar (vgl. Haug 1991, S. 60ff.).
Eine ganz andere Sichtweise dominiert in der christlichen Gesundheitsbildung bis ins Mittelalter (ca. 6.-15.Jh.) hinein. Im Mittelpunkt steht hier das Erreichen des Seelenheils im Jenseits. Gesundheit und Krankheit werden „als göttliche Fügung verstanden, als Schicksal, gegen das der Mensch wenig machen kann, außer gottgefällig zu leben. Krankheit [wird] entsprechend als Strafe Gottes erlebt, als Buße für ein sündhaftes Leben, als Mahnung zur Rückbesinnung auf Gott“ (Faltermaier 1994, S. 69; Anpassung: E. K.). Man glaubt nicht daran, Gesundheit bzw. Krankheit beeinflussen zu können, da alles in „Gottes Hand“ liegt. Gesundheitsbildung beschränkt sich deshalb, wie es in der Regula von Benedikt von Nursia (um 430) heißt, darauf „den ohnehin schon zur Entfaltung drängenden Seelenkräften den ‚rechten Weg’ [zu] eröffnen“ (zitiert nach Haug 1991, S. 96; Anpassung: E. K.). Oder wie es Meister Eckhart (1260-1327) als „die vornehmste Aufgabe“ ansieht, die „Rückwendung der Seele zu Gott“ zu fördern, „damit der Mensch wieder zu einem Bild Gottes werde“ (ebd., S. 96). Die Bedeutung der körperlichen Gesundheit tritt also zugunsten des Strebens nach dem Seelenheil in den Hintergrund.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Geschichte der abendländischen Kultur auch „eine Geschichte der Leibfeindlichkeit“ darstellt, wobei insbesondere christliche Theoretiker predigen, dass die „Erlösung der Seele [...] nur für den zu erreichen [sei], der seinen Leib missachte“ (Kriegisch; Zittlau 19972, S. 182; Anpassung: E. K.). Der Körper einer Person mit seinen Bedürfnissen gilt als völlig unabhängig von deren Psyche.
Im Zeitalter der Aufklärung (17./18.Jh.) vollzieht sich eine Ablösung vom religiösen Weltbild und der Ständeordnung. Sie wird ausgelöst durch Fortschritte in den Naturwissenschaften und der Astronomie sowie durch aufklärerische Gedanken. Die objektive Ordnung, die noch bei dem Arzt, Naturphilosophen und Forscher Paracelsus (1493-1541) und bei Comenius (1592-1670) vorzufinden ist, weicht endgültig der subjektiven Ordnung des Individuums. „Es ist nicht mehr Gott, der Schöpfer, sondern das Individuum, das die Dinge in seiner Umgebung subjektiv ordnet“ (Haug 1991, S. 111). Gedanken wie beispielsweise von John Locke (1632-1704), der menschliche Geist sei von Geburt an eine „tabula rasa“ (leere Tafel), oder Kant (1724-1804), der Mensch könne sich aus „seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ befreien, stärken den Glauben an die Vernunft und die Allmacht der Erziehung. Damit nehmen sie aber auch das Volk selbst in die Verantwortung. Darüber hinaus hat Rousseaus Erziehungsroman „Emile“ (1762) weit über seine Epoche hinaus großen Einfluss.
„Sein Glaubensbekenntnis für die Natur’ und gegen die Unnatur’, die Kultur, gibt all denjenigen Kraft und Auftrieb, die auch Gesundheit als Folge und Konsequenz, natürlicher Erziehung und Entwicklung’ betrachten“ (Haug 1991, S. 115). Dieser Perspektivenwechsel hat entscheidenden Einfluss auf das allgemeine Gesundheitsverständnis. Gesundheit und Gesundheitsbildung wird zur Gemeinschaftsaufgabe der Gesellschaft erhoben. Die aus der Antike stammende Diätik wird von aufklärerischen Ärzten wie Hufeland, Tissot oder Triller wieder aufgegriffen und ein grundlegendes Gesundheitsprogramm erstellt (vgl. Faltermaier 1994). Osterhausen formuliert es in seinem zweibändigen Werk „Über medicinische Aufklärung“ (1798) wie folgt: „medicinische Aufklärung’ ist nichts anderes als der Ausgang eines Menschen aus seiner Unmündigkeit in Sachen, welche sein physisches Wohl betreffen’, sie ist die Verdrängung des Aberglaubens und der Vorurtheile in medicinischen Dingen und in Sachen, welche auf die Gesundheit des Menschen Einfluß haben’“ (zitiert nach Haug, 1991, S. 117). Adressat ist eine breite Bürgerschicht, die zu einer bewussteren Lebensführung und Mäßigung zum Beispiel bezüglich der Ernährung, Bekleidung, oder Konsum von Kaffee, Tabak und Alkohol, ermahnt wird. Der emanzipierte und mündige Bürger ist für seine Gesundheit, zuzüglich der „richtigen Benutzung der Ärzte“ (Faltermaier 1994, S. 71), selbst verantwortlich.
Mit Einsetzen der Industrialisierung (Mitte 19.Jh.) und ihren sozialen und wirtschaftlichen Folgen vollzieht sich ein neuerlicher Wandel. „Die Entdeckung der Zelle und der Mikroorganismen, als die damals bekannten kleinsten Grundbestandteile des Lebens, führen zu einer Revolutionierung des Gesundheitsverständnisses:
Gesundheit und Krankheit werden mehr und mehr als technisch-mechanische vom Individuum loslösbare Probleme betrachtet, die unter Anwendung von physikalisch-chemischen Verfahren beinflußt werden können“ (Haug 1991, S. 127). Aufgrund der Fortschritte in der experimentellen Forschung (z.B. Physiologie, Chemie, Pathologie) tritt die medizinische Kontrolle durch Experten, an Stelle der Selbstdiagnose, Selbstheilung und gesundheitlichen Selbstbestimmung des Laien. „Der unmündige Patient (patiens - leiden, erdulden, ertragen) ist geboren“ (ebd., S. 127). Aus dieser Entwicklung heraus entsteht das biomedizinische Krankheitsmodell (s.2.4.2).
Vom gesundheitserzieherischen Blickwinkel aus gesehen führt dies einerseits zu einer verstärkten Ausbildung naturwissenschaftlich geschulter Spezialisten und andererseits zur Hygieneerziehung, die zum Beispiel an den Schulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeführt wird (vgl. Haug 1991, S. 130f.). Dieser meistens im Rahmen der Biologie abgehaltene Hygieneunterricht vermittelt „welche biochemischen Einzelveränderungen im Körper vor sich gehen, welche Stoffe die Organe bei ihrer Tätigkeit umsetzen, welche Bakterien und Mikroorganismen bei den ‚Volksseuchen’ auftreten u.s.w.“ (ebd., S. 131). Gesundheitsbildung beschränkt sich somit weitgehend auf medizinische Sachaufklärung und nicht mehr auf die Vermittlung einer selbstverantwortlichen gesundheitsbewussten Lebensführung.
Parallel zu diesem Gesundheitsverständnis bilden sich auch alternative Positionen heraus, die dem ganzen Menschen und seinem Verhältnis zur Natur größere Bedeutung beimessen. Genannt seien hier der Theologe Sebastian Kneipp (1821-1897) als bekanntester Vertreter der Naturheilverfahren und die deutsche Jugendbewegung als Teil der pädagogischen Reformbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie haben jedoch nur punktuellen Einfluss auf die Gesundheitsbildung bzw. das Gesundheitsverständnis dieser Zeit, die gesamtgesellschaftlich gesehen durch das biomedizinische Krankheitsmodell dominiert wird (vgl. Haug 1991, S. 124ff.).
In der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) wird die Gesundheitserziehung bzw. -bildung für ideologische Zwecke missbraucht. Über das pädagogische Mittel der Massenerziehung wird die individuelle Gesundheit auf die Körperebene reduziert. Gesundheitspolitisches Ziel ist vor allem durch sportliche „Ertüchtigung“ „gesunde arische Soldaten“ und „gebärfreudige Mütter“ für die nahe Zukunft heranzuziehen. Die Ideologie der Reinheit der „Herrenrasse“ dient als machtfaktisches Instrument und zur Verfestigung des NS-Regimes. Für Behinderte und schwer chronisch kranke Menschen ist in diesem System, das vom Auslese- und Zuchtgedanken geprägt ist, kein Platz, weshalb viele in sogenannten „Euthanasieprogrammen“ von ihrem „unwerten Leben“ befreit werden (vgl. ebd., S. 151ff.). Dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte wird als bedeutsam angesehen, darf jedoch nicht verallgemeinernd für die Entwicklung des Gesundheitsverständnisses und der Gesundheitserziehung herangezogen werden, sondern muss vor dem Hintergrund eines diktatorisch-ideologischen Regimes getrennt betrachtet werden.
Nach dem zweiten Weltkrieg wird an die Entwicklungen vor 1933 anknüpft. Das medizinische Krankheitsmodell steht erneut hoch im Kurs. Die Schreckgespenster der vorangegangenen Jahrhunderte, wie Pest, Pocken, Cholera, Gelbfieber und Typhus werden in den Industrieländern weitgehend ausgerottet. Dafür bestimmen nach und nach neue Krankheiten, sogenannte Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck, Schlafstörungen, Herzkrankheiten, Magengeschwüre, Depressionen und Krebs das Alltagsleben. Sie sind das Produkt einer materialistisch eingestellten Leistungs- und Konsumgesellschaft, meist ausgelöst durch Dauerstress und eine krankmachende Lebensweise. Somit sieht sich die kurative (heilende) Medizin immer mehr chronisch-degenerativen Krankheiten gegenüber, deren Symptome sie zwar behandeln, aber in ihren Ursachen nicht besiegen kann. Im Jahre 1948 stellt sich die WHO mit ihrer positiven Definition von Gesundheit, gegen das weiterhin dominierende Krankheitsmodell. Im Anschluss daran (etwa seit 1950) beschäftigt sich vor allem die nordamerikanische wissenschaftliche Literatur verstärkt mit dem Thema Gesundheitserziehung (health education) bzw. Gesundheitsförderung (health promotion), was aber ebenso wie die WHO-Definition keinen wesentlichen Einfluss auf die Vormachtstellung der kurativen Medizin hat. Erst 1978 leitet die Konferenz der WHO von Alma Ata mit dem „Primary Health Care Konzept“ eine erste Umorientierung in der Gesundheitspolitik ein. Dieses Konzept findet später in der Ottawa-Charta von 1986 und dem „Health Promotion Ansatz“ seine Fortsetzung (vgl. Faltermaier, 1994, S. 58ff.).
Gesundheit – ein aktuelles Thema
Der Wandel im Denken über Gesundheit und Krankheit, der sich unter den Experten erst abzeichnet, hinkt den Veränderungen des Gesundheitsbewusstseins von Laien bereits hinterher. Das Wissen des Laien über Gesundheit und ihre Risikofaktoren sowie der Stellenwert der Gesundheit ist in der Gesellschaft enorm gestiegen. „Die aktuelle Karriere des Gesundheitsbegriffs verweist darauf, daß das Gesundheitsmotiv heute ein relevantes gesellschaftliches Problem geworden ist und ernst genommen wird. Die Menschen kümmern sich heute mehr um ihre Gesundheit und ihren Körper und überlassen sie nicht mehr ausschließlich den ärztlichen Experten“ (Faltermaier 1994, S. 12). Ein Beispiel dafür ist das starke Aufkommen von Selbsthilfegruppen, die nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland entstehen und seit 1970 bis heute ungebrochen boomen. Ein weiteres Beispiel ist die Renaissance alternativer Heilmethoden (z.B. Akupunktur) und die verstärkte Inanspruchnahme traditioneller Naturheilkräuter.
Nach Faltermaier (1994) spricht außerdem einiges dafür, dass sich „gegenwärtig [...] ein tiefgreifender Wandel in der Konzeption des Körpers vollzieht: Die funktionalistische Vorstellung vom Körper als Instrument und als Voraussetzung der eigenen Leistungsfähigkeit, der nicht wahrgenommen wird, solange er ‚störungsfrei läuft’ [...], wird überlagert und teilweise abgelöst von einem bewussteren Verständnis vom und Verhältnis zum Körper“ (S. 12; Auslassungen: E. K.).
Daneben hat die freie Marktwirtschaft diesen Trend zu mehr Selbstbestimmung und Körperbewusstsein schnell erkannt. In der Bundesrepublik wird mit Gesundheit geworben, der „Körper-Kult“ (Faltermaier 1994, S. 12), als übersteigerte Form dieses neuen Körperbewusstseins wird geschürt. Zahlreiche Zeitschriften, die sich mit entsprechenden Themen auseinandersetzen (beispielsweise „Fit For Fun“ oder „Men’s Health“) sind ein deutlicher Beleg dafür. Der freie Markt macht große Gewinne, zum Beispiel mit „biologisch wertvollen“ Lebensmitteln, mit Fitness- bis hin zu Selbsterfahrungskursen und besonders mit einem facettenreichen Freizeitsportangebot.
Der Kölner Wirtschaftswissenschaftler und Experte für Informationstechnologie Leo Nefiodow prophezeit, dass Gesundheit, verstanden als ein „Streben nach einer ganzheitlich verstandenen Gesundheit“ (Schwab 1997, S. 29), die entscheidende Wachstumsbranche des 21. Jahrhunderts, sein wird. Die von Dauerkrisen geplagten Gesellschaften des Westens müssten gleichsam an Leib und Seele gesunden: nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial. Dies schaffe einen ganz neuen Aspekt von Gesundheit. Das Geschäft mit der Gesundheit lasse sich somit als Motor der Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert verstehen, womit Heilung selbst zu einer ökonomischen Macht werden würde. Komplexe Beziehungsfelder (soziale, gesundheitliche und psychische) rückten in den Vordergrund. Während in der Industriegesellschaft vor allem materielle Produkte nachgefragt wurden, gehe es jetzt im wesentlichen um immaterielle Güter wie z.B. Dienstleistungen, Pflege und Betreuung. Erstmals in der Geschichte scheinen Wirtschaftswachstum und Strukturwandel nicht mehr primär von Rohstoffen, Maschinen und deren Anwendungen abhängig, sondern von „Fortschritten im Menschlichen“ (ebd.). Solche Fortschritte bedeuteten unter anderem die „Sicherung einer guten psychosomatischen Gesundheit oder eine bessere Wechselwirkung zwischen Körper, Seele und Geist“ (Schwab 1997, S. 30). Ob der Wirtschafts-Visionär tatsächlich als einer der „angesehensten Vordenker der Informationsgesellschaft“ (ebd., S. 30) gelten kann, wird die Zeit beweisen. Eine „Megabranche Gesundheit“ (ebd. S. 21) als Motor der Weltwirtschaft wäre aber nicht nur der Ökonomie hochwillkommen, sie würde zudem jedem einzelnen in diesem Jahrtausend gut tun. Für Nefiodow lassen sich durch eine Verbesserung der psychosozialen Gesundheit nicht nur destruktive und produktionshinderliche Verhaltensweisen vermeiden, sondern auch kreative und produktive Potentiale des Menschen mobilisieren. Und tatsächlich klingt sein Argument plausibel, dass durch eine „bessere Beherrschung psychischer Phänomene“ riesige Einsparungen erreicht und jene Ressourcen freigesetzt werden könnten, die zur Erschließung neuer Märkte notwendig wären. Mit nur 5% weniger „psychosoziale Destruktivität“ (ebd. 29), beispielsweise in Form von psychischen Störungen, Gewalttätigkeit oder Drogen könnten mehrere hundert Milliarden US-Dollar eingespart werden und einen Konjunkturschub auslösen, der Millionen neue Arbeitsplätze schaffen würde. Nach Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation gilt nämlich gegenwärtig bereits jeder siebte US-Amerikaner, wahrscheinlich jeder siebte Bürger der Welt als psychisch krank (vgl. Schwab 1997, S. 29f.). Im „Megamarkt Gesundheit“ haben alle entwickelten Nationen eine Chance. Sehr günstig sind die Ausgangsbedingungen aber für Europäer: in allen gesundheitsorientierten Branchen ist die europäische Wirtschaft führend, die Nachfrage liegt auf hohem Niveau und es besteht eine moderne und ausbaufähige Gesundheitsinfrastruktur (vgl. Schwab 1997, S. 21ff.).
Ein weiterer aktueller Trend die Gesundheit betreffend, fällt unter das Stichwort Wellness, von Tenzer (2003) auch als das „Widerstandsprogramm gegen den Alltagsstress“ (S. 20) bezeichnet. Es sei ein „geeignetes Mittel um sich körperlich und seelisch widerstandsfähiger“ (ebd., S. 20) zu machen. Der Begriff Wellness ist viel älter, als angesichts des Booms in diesem Bereich zu vermuten ist: „er taucht schon 1654 in einem englischen Lexikon auf und meint dort so viel wie Wohlbefinden und gute Gesundheit“ (ebd.). Populär wird der Ausdruck in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts durch den Arzt Halbert L. Dunn, der ihn zum Schlagwort einer neuen Gesundheitsbewegung macht. Er bezeichnet seine Gesundheitsphilosophie als „High Level Wellness“ (Tenzer 2003, S. 22) und meint damit einen eigenverantwortlichen Lebensstil, der die Gesundheit optimal fördern soll. Der Wellnessbegriff schlägt seit 1970 in Deutschland Wurzeln. Laut einer repräsentativen Befragung von Frauen, kennen gegenwärtig 82% den Begriff (vgl. Tenzer 2003, S. 22). Dies ist nicht weiter verwunderlich, da Wellness ein Modethema für Frauenzeitschriften und Werbestrategien ist. Die Umsätze in dieser Branche steigen, da Wellnessangebote, wie z.B. der Yoga, verstärkt wahrgenommen werden.
„Der moderne Kopfmensch besinnt sich nun auf dieses alte Wissen, denn er hat Nachholbedarf. Sein verspannter Muskelapparat erinnert ihn täglich daran, dass ihm Bewegung fehlt, Stress nagt an den Nerven, Fehlhaltungen schmerzen, Speckröllchen wachsen. Wellness ist gefragt, weil vielen Menschen Körpergefühl und Sinnlichkeit abhanden gekommen sind“ (ebd., S. 20). Wellness steht laut einer Studie der Heidelberger Gesellschaft für Innovative Marktforschung unter anderem für Entspannung und Stressbewältigung und kommt der Sehnsucht nach einer Balance von Körper, Geist und Seele entgegen. Dabei gehe es um „Ziele wie Stressverarbeitung, erlebte Selbstwirksamkeit, Vitalität, Genussfähigkeit sowie ein positives Selbstkonzept“ (vgl. Tenzer 2003, S. 22). Es ist außerdem ein Mittel für das Selbstmanagement, da Wellness gleichzeitig „als Therapieersatz Kraft, Lebensfreude, ein gutes Körpergefühl, sinnstiftend und identitätsfördernd“ (ebd.) sei. Es handelt sich um „eine aktive selbstverantwortliche Gesundheitsvorsorge, die Ressourcen für ein erfolgreiches und erfülltes Leben sicherstellt“ (ebd.). In diesem Sinn soll Wellness neben Entspannung auch die Leistungsfähigkeit fördern. Auch in diesem Bereich zeichnet sich laut Tenzer (2003) ein „Megatrend“ (S. 23) ab, der viele Bereiche der Wirtschaft zurücklässt. Der Soziologe Matthias Horx, bringt damit vor allem drei große gesamtgesellschaftliche Trends in Verbindung: die Individualisierung, die Notwendigkeit einer eigenverantwortlichen Gesundheitsvorsorge und moderne Arbeitsformen. Das Individuum sei gefordert, sich seelisch und körperlich fit zu halten: „wenn es [...] viel leistet, soll es sich [...] aktiv und eigenverantwortlich um seine Regeneration kümmern“ (ebd.; Auslassungen: E. K.). Damit sichert Wellness die persönlichen Ressourcen und somit auch die Zukunftsfähigkeit und bedeutet letztlich „Pflege des immer wichtiger werdenden Humankapitals“ (ebd.). Demnach bildet Wellness und damit auch Entspannungsverfahren sowohl psychisches als auch physisches Kapital, was nach Tenzer vergleichbar mit dem „lebenslangen Lernen“ ist (ebd.).
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die Verantwortung für Gesundheit von der rein medizinischen Versorgung durch gesamtgesellschaftliche und politische Aspekte erweitert und sich das selbstbestimmte Gesundheitshandeln einer Person gestärkt hat. Damit hängt allerdings auch ein gesunkenes Vertrauen in die Ärzteschaft zusammen, was zur Folge haben kann, dass der Arztbesuch im Krankheitsfall zu lange hinausgezögert und so die Krankheit erst dann zu einem ernsten Gesundheitsrisiko wird. Die „Gefahr einer Individualisierung der Verantwortung“ (Faltermaier 1994, S. 72) sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Auch die angesprochene freie Marktwirtschaft bringt Probleme für den Einzelnen mit sich. Sie läuft Gefahr, Gesundheit zur „Ware“ verkommen zu lassen. Denn durch Überangebote und Halbwahrheiten werden Orientierungsprobleme geschaffen, die zu unbewusst gesundheitsschädigendem Handeln führen können. So stellt beispielsweise die „Freizeitindustrie“ (Hurrelmann 1990, S. 176) unzählige Angebote für eine Person bereit. Damit kann Freizeitspaß leicht zu krankmachendem Freizeitstress umschlagen. Außerdem wird z.B. mit einer entspannenden Wirkung von Alkoholtrinken oder Zigarettenrauchen geworben. Beides ist erwiesenermaßen gesundheitsschädlich (vgl. Corazza et al. 2001) und versetzt den Körper in einen Stresszustand, selbst wenn sich eine Person dabei entspannt fühlt. In diesem Sinne bieten sich meiner Meinung nach Entspannungsverfahren, richtig und kontrolliert angewendet, als eine sinnvolle und zugleich angenehme Freizeitbeschäftigung an, und stellen gleichzeitig eine gesundheitserhaltende Maßnahme dar.
Das Modell der Salutogenese-eine Theorie der Gesundheit
Das Thema Salutogenese hat in jüngerer Zeit in den Sozialwissenschaften und in der Medizin, vor allem in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung, viel Aufmerksamkeit erfahren. Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923-1994) hat dieses Konzept in die gesundheitswissenschaftliche und gesundheitspolitische Diskussion eingebracht. Er kritisiert eine rein pathologisch-kurative Betrachtungsweise und stellt ihr eine salutogenetische Perspektive gegenüber. Die Frage, warum Menschen gesund bleiben, soll Vorrang vor der Frage nach den Ursachen von Krankheiten und Risikofaktoren bekommen. Dementsprechend fragt die salutogenetische Perspektive primär nach den Bedingungen von Gesundheit und nach den Faktoren, welche die Gesundheit schützen und zur Unverletzlichkeit beitragen. Die Frage nach den Wirkfaktoren für die Erhaltung von Gesundheit steht dabei im Mittelpunkt. Teilweise ist bereits die Rede von einem Paradigmenwechsel: „von einem krankheitszentrierten Modell der Pathogenese hin zu einem gesundheitsbezogenen, ressourcenorientierten und präventiv ansetzenden Modell der Salutogenese“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20017, S. 9).

Bevor ich das Konzept der Salutogenese näher darstelle, beschreibe ich zunächst dessen Entstehungshintergrund und Kontext. Das Modell der Salutogenese und Antonvskys Thesen sind nur zu verstehen, wenn man sie vor dem Hintergrund der Entwicklungen und Strömungen in der Gesundheitsversorgung und in den Gesundheitswissenschaften der letzten fünfzig Jahre interpretiert. Dazu beschreibe ich folgende parallel verlaufende Entwicklungen: die Kritik am System der Gesundheitsversorgung, die Entwicklung eines biopsychosozialen Krankheitsmodells und die Veränderungen in der Prävention und der Gesundheitsförderung.
Kritik am System der Gesundheitsversorgung
Das System der Gesundheitsversorgung bzw. Krankenbehandlung in der Bundesrepublik Deutschland ist geprägt durch ein Handeln und Denken, das häufig als pathogenetische Betrachtungsweise (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 14) gekennzeichnet wird: im Mittelpunkt stehen die Beschwerden, Symptome oder Schmerzen des Patienten. Alle Anstrengungen des medizinischen Systems, der Ärzte und Therapeuten, richten sich auf die Diagnose und das möglichst schnelle Beseitigen der Symptome und Beschwerden. Die Erwartungen des Patienten an die Möglichkeiten des medizinischen Versorgungssystems sind hoch. In den vergangenen Jahrzehnten konnten wie bereits angesprochen beeindruckende Erfolge in Diagnostik und Therapie vieler Erkrankungen erzielt werden. Nichtsdestotrotz wird in den letzten Jahren zunehmend Kritik an der sogenannten Apparatmedizin und der primären Orientierung an Symptomen laut. Unter dem Eindruck einer immer stärkeren Technisierung der Medizin wird die Vernachlässigung der Person (also die Vernachlässigung der Ganzheitlichkeit) beklagt. Ferner sei unser gesundheitliches Versorgungssystem zu teuer, könne nicht angemessen auf die Zunahme chronischer Erkrankungen reagieren und würde sich nicht genügend mit ethischen Fragestellungen befassen. Gefordert wird eine „sprechende Medizin“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 14), die sich nicht nur an der Krankheit und Behinderung orientiert und mit hohem technischen Aufwand diagnostiziert, sondern dem Gespräch zwischen Arzt und Patienten einen hohen Stellenwert gibt, die gesunden Anteile des Patienten wahrnimmt und fördert sowie psychosoziale Aspekte der Krankheitsanpassung und Heilung mit einbezieht.
Entwicklung eines biopsychosozialen Modells
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt sich unter dem Einfluss naturwissenschaftlichen Denkens ein Krankheitsverständnis, das als biomedizinisches Krankheitsmodell bezeichnet wird (s.2.2). Dieses Modell geht davon aus, dass der menschliche Körper mit einer Maschine vergleichbar ist, deren Funktionen und Funktionsstörungen verstanden werden können, indem die Organsysteme und –strukturen sowie die physiologischen Prozesse möglichst genau analysiert werden. Krankheitssymptome (körperliche und psychische Beschwerden) werden durch organische Defekte erklärt. Diese anatomischen oder physiologischen Defekte bilden die eigentliche Krankheit. Für die Entstehung des Defekts wird angenommen, dass es eine begrenzte Zahl von Ursachen gibt, so zum Beispiel Bakterien und Viren. Entscheidend ist das Erkennen des Defekts und die Suche nach Möglichkeiten, ihn zu beheben. Diese Grundannahmen bestimmen den Umgang mit körperlichen Beschwerden. Die Bestimmung, ob eine Person als krank bezeichnet werden kann, hängt davon ab, ob anatomische oder physiologische Veränderungen festgestellt werden können. Der kranke Mensch als Subjekt und Handelnder wird weitgehend ausgeklammert. Er ist passives Objekt physikalischer Prozesse, auf die seine psychische und soziale Wirkung keinen Einfluss haben (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 17). Medizinische Forschung, die dem biomedizinischen Krankheitsmodell folgt, konzentriert sich auf die Entdeckung bisher unbekannter Defekte und den Nachweis, dass diese die Ursache für die Krankheit sind. Die medizinische Behandlung zielt demnach darauf ab, den Defekt zu beheben (vgl. Faltermaier 1994, S. 20ff.). Dieses Krankheitsverständnis hat in vielen Bereichen zu großen medizinischen Fortschritten geführt, beispielsweise bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten (s. 2.2).
Dem biomedizinischen Modell stellt der Sozialmediziner Engel Ende der 1970er ein erweitertes, biopsychosoziales Modell gegenüber, in dem sowohl somatische als auch psychosoziale Faktoren zur Erklärung von Krankheiten herangezogen werden. Sozialwissenschaftliche, psychologische und psychosomatische Forschungsbefunde belegen, dass psychische und soziale Faktoren bei der Entstehung und im Verlauf von Krankheiten von Bedeutung sind. Auch das Erstellen einer Diagnose und die Behandlung der Erkrankung werden davon beeinflusst. Beispielsweise werden bereits die Wahrnehmung von Symptomen, das Schmerzerleben, die Inanspruchnahme medizinischer Versorgung und das Befolgen von ärztlichen Anordnungen entscheidend von psychischen und sozialen Faktoren beeinflusst (vgl. Bengel, Strittmatter; Willmann 20027, S. 17). Auch die psychobiologische Bewältigungs- und Stressforschung beginnt zu fragen, welche protektiven Ressourcen der Organismus unter Belastungsbedingungen beispielsweise über das Immunsystem aktivieren kann. Sie folgt damit nicht mehr ausschließlich einem Vulnerabilitätskonzept, das untersucht, wie psychische Belastungen über psychophysiologische Prozesse pathogenetisch wirksam werden (vgl. ebd.). Heute sind in diesem interdisziplinären gesundheitswissenschaftlichen Feld zahlreiche Fächer aktiv, wie beispielsweise die Medizinische Psychologie, die psychosomatische Medizin, die Gesundheitspsychologie, die Verhaltensmedizin und die Psychoneuroimmunologie (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 84).
Vulnerabilität ist definiert als „Verwundbarkeit“ bzw. „Verletzlichkeit“ (Wermke et al. 20017, S. 1040). Psychoneuroimmunologie: Relativ junges Forschungsgebiet, welches Wissen und Methodik der Psychologie und verschiedener medizinischen Teildisziplinen integriert, um zu untersuchen, welche Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Systemen des Körpers bestehen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 17f.).
Mit der Erweiterung des biomedizinischen Modells um psychische Bedingungsfaktoren ist jedoch nicht immer eine grundsätzliche Neuorientierung in der Auseinandersetzung mit Gesundheit verbunden. Oft orientieren sich die Formulierungen biopsychosozialer Modelle ebenfalls an einem Defizitmodell des Menschen. Deutlich wird diese Tendenz bei der gesundheitspolitischen Forderung nach präventiven Konzepten und Maßnahmen. Auf den ersten Blick erscheint dies als Neuorientierung und Distanzierung vom kurativen System. Bei näherer Betrachtung sind die pragmatischen Präventionskonzepte, die sich unter dem Begriff der Früherkennung und Gesundheitserziehung subsumieren lassen, geprägt von medizinischem Denken, auch wenn gerade bei letzteren psychologisches Wissen integriert ist. Trotz der vielfältigen Kritik und obwohl gerade bei den zunehmenden chronisch-degenerativen Erkrankungen (Verschleißerkrankungen) die Bedeutung von psychosozialen und kulturellen Faktoren nachgewiesen ist, bestimmt nach wie vor das biomedizinische Krankheitsmodell sowohl die heutige Schulmedizin als auch die Prävention.
Entwicklung der Prävention und Gesundheitsförderung
Wie bereits angesprochen, hat es in der gesamten Geschichte der Medizin Anstrengungen gegeben, Krankheiten zu verhüten. Ganz besondere Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung haben Maßnahmen, welche die hygienische Versorgung der Bevölkerung betreffen, sowie Massenimpfungsprogramme, wie sie nach dem zweiten Weltkrieg eingeführt werden (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 18). Im Mittelpunkt präventiver Anstrengungen steht gegenwärtig vor allem die Vermeidung der bereits angesprochenen Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Krebs, Rheuma, Allergien, Magen-Darmerkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates und psychische Störungen. Diese verlaufen meist chronisch und degenerativ und häufen sich mit zunehmendem Alter (vgl. Faltermaier 1994, S. 17). Zivilisationskrankheiten sind solche Erkrankungen, die in industrialisierten Staaten in großer Anzahl vorkommen. Es handelt sich dabei um körperliche, geistige und seelische Schäden als Folge von unangemessener Nutzung zivilisierter Errungenschaften und Schädigungen durch die Produktion von Zivilisationsgüter. Der Brockhaus (20029) spricht bei Zivilisationskrankheiten von Erkrankungen, „die durch zivilisatorische Einflüsse hervorgerufen oder gefördert werden“ (Brockhaus, S. 1013).
Bewegungsmangel, einseitige Ernährung, Nikotin- und Alkoholmissbrauch, in weiterem Sinne auch schädigende Umwelteinflüsse sind per Definition mit Einflüssen der Zivilisation gemeint. Bezugnehmend auf das Thema Entspannung gehe ich auf den Aspekt der Bewegung näher ein. Bewegungsmangel entsteht beispielsweise, wenn eine Person eine vorwiegend sitzende Tätigkeit ausübt. Hierzu zählen das Sitzen im Auto und Büro ebenso wie das Sitzen am [[PC] oder beim Fernsehen. Der Bewegungsapparat einer Person setzt sich zusammen aus Muskeln, Bändern, Knorpeln und Knochen. In Kombination eingesetzt, ergeben sie die Tätigkeit „sich bewegen“. Diese geht einher mit Anspannung und Entspannung. Die Verspannung der Muskulatur ist eine häufige Erscheinung der modernen Zivilisation. Hiervon betroffen sind bevorzugt die Muskulatur von Nacken und Schultern. Besonders häufig kommt es zu Verspannungen bei monotonen Arbeitsprozessen, wie beispielsweise Fließbandarbeiten oder Computerarbeiten (vgl. Corazza et al. 2001).
Durch die zunehmend technische und computergesteuerte Arbeitswelt wird Bewegung im Berufsalltag immer seltener; andererseits aber fordern hochtechnische Geräte erhöhte Aufmerksamkeit und erzeugen vermehrt Stresssituationen. Zum Ausgleich einseitiger und mangelnder Bewegung bieten die Volkshochschulen z.B. Yoga-Kurse an. Um Stress zu bewältigen, gibt es eine Reihe von Entspannungsangeboten wie z.B. Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training und Yoga. Ein Entspannungsverfahren zu praktizieren stellt demnach eine Möglichkeit dar, Bewegungsmangel vorzubeugen und/oder zu beheben.
Basis für präventive Maßnahmen ist das Risikofaktorenmodell. Dieses wird auf der Grundlage von Ergebnissen epidemiologischer Studien und Statistiken von Lebensversicherungsgesellschaften in den 1950ern entwickelt, bei der Erforschung der koronaren Herzerkrankung (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 18). Demnach bestehen Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren wie zum Beispiel hohe Blutfettwerte, Tabakkonsum, Bluthochdruck, Übergewicht, psychische Stressoren und dem Auftreten von koronaren Herzerkrankungen (vor allem in Form von Herzinfarkten). Je mehr Risikofaktoren, insbesondere bei Männern, vorliegen, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen. Wie bei jedem statistischen (Wahrscheinlichkeits-) Modell treffen solche Aussagen nur bei einem bestimmten Prozentsatz der untersuchten Personen zu. Demzufolge können aus dem Zusammentreffen (Korrelation) von Risikofaktoren und Erkrankung keine ursächlichen, kausalen Interpretationen oder Vorhersagen über die Morbidität bzw. Mortalität einzelner abgeleitet werden. Die Wirkung der Risikofaktoren ist für die einzelne Person nicht zwangsläufig; es kann nur eine erhöhte Erkrankungswahrscheinlichkeit angenommen werden. Einige Forschungsergebnisse zum Stellenwert verschiedener Risikofaktoren und deren Wechselwirkungen sowie der Festlegung von kritischen Werten (ab wann ist ein Risikofaktor gefährlich?) und Einwirkungszeiten (wie lange muss ein Risikofaktor bestehen?) sind widersprüchlich. Da Risikofaktoren als beginnende Krankheit aufgefasst werden, konzentriert sich die Prävention auf die Vermeidung von Risikofaktoren und auf individuelle Verhaltensänderungen. Bisher sind im Risikofaktorenmodell überwiegend sogenannte verhaltensgebundene Risikofaktoren (wie zum Beispiel Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck) enthalten, während die kontext- und verhältnisbezogenen Risikofaktoren (zum Beispiel chronische Arbeitsbelastung, Umwelteinflüsse) noch vernachlässigt werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund setzt man in der Umsetzung des Modells vor allem auf individuelle Verhaltensänderungen.
Spätestens seit der WHO-Konferenz von Alma Ata (s.2.2) und der Proklamation „Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“ wird eine Ergänzung des biomedizinischen Risikofaktorenmodells und den mit diesem Modell verbundenen Implikationen als wichtig erachtet. Mit der Ottawa-Charta stellt die WHO 1986 das Programm zur Gesundheitsförderung (Health Promotion) vor. Dort heißt es:
Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozeß, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und Umwelt zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. [...] Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, daß man sich um sich selbst und für andere sorgt, daß man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, daß die Gesellschaft in der man lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen (zitiert nach Keupp 1997, S. 45; Auslassung: E. K.).
Die Gesundheitsförderung als ein sozial-ökologisches Gesundheits- und Präventionsmodell betrachtet Gesundheit nicht als Ziel, sondern als Mittel, um Individuen zu befähigen, individuelles und gesellschaftliches Leben positiv zu gestalten. Präventive Maßnahmen werden somit nicht durch das professionelle System verordnet. Sie zielen auf die aktive und selbstverantwortliche Beteiligung einer Person an der Herstellung gesundheitsfördernder Bedingungen und auf den Dialog und die Interaktion zwischen Laien und Professionellen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 19). Mit dieser Zielsetzung zeigt die Gesundheitsförderung große Nähe zum Empowerment-Ansatz, der aus der amerikanischen Gemeindepsychologie stammt. Handlungsziel der Empowerment-Praxis ist nach (Herriger 1997) „Menschen vielfältige Vorräte von Ressourcen für ein gelingendes Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen, auf die diese ‚bei Bedarf’ zurückgreifen können, um Lebensstärke und Kompetenz zur Selbstgestaltung der Lebenswelt zu gewinnen“ (S. 15) sowie „Menschen zur Entdeckung ihrer eigenen (vielfach verschütteten) Stärken zu ermutigen, ihre Fähigkeiten zu Selbstbestimmung und Selbstveränderung zu stärken“ (S. 7). Empowerment meint also den Prozess, innerhalb dessen Kompetenzen, Eigenverantwortlichkeit und Selbsthilfefähigkeit von Personen oder Gruppen gestärkt werden (vgl. Keupp 1997, S. 45f.). Damit ist Gesundheitsförderung auch eine politische und gesellschaftsverändernde Aufgabe, was die praktische Umsetzung nicht gerade vereinfacht (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 19). Der Ansatz der Gesundheitsförderung greift die Entwicklungen im Gesundheits- und Krankheitsverständnis auf (s.2.2). Er legt einen komplexen mehrdimensionalen Gesundheitsbegriff zugrunde und baut auf einem biopsychosozialen Krankheitsmodell auf.
Das Konzept der Salutogenese
Antonovsky war in der Stressforschung tätig und entwickelte schrittweise im Laufe seines beruflichen Werdegangs ein Modell, welches Gesundheit und Krankheit aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachtet als das medizinische Krankheitsmodell. Damit eröffnet er neue Perspektiven und Problemstellungen für die Gesundheitsforschung und -praxis (vgl. Faltermaier 1994, S. 43ff.). Aufgrund von epidemiologischen Daten über die Morbidität aller Erkrankungsarten in den USA kommt er Anfang der 1980er zu dem Schluss, dass „Krankheiten nicht etwa Ausnahme sind, sondern sich zu jedem Zeitpunkt mindestens ein Drittel der Bevölkerung (wahrscheinlich sogar die Mehrheit) im Zustand irgendeiner Krankheit befindet. Krankheit als „Abweichung ist also eher „normal“; Gesundheit als die Norm ist gar nicht so verbreitet“ (Faltermaier, 1994, S. 44). Mit dem Modell der Salutogenese will Antonovsky eine Antwort auf die für ihn zentrale und leitende Fragestellung geben, nämlich was den Menschen trotz vieler potentiell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund erhält.
Der Begriff der Salutogenese ist ein Neologismus (sprachliche Neubildung), den Antonovsky als Gegenbegriff zur bisher dominierenden Pathogenese des biomedizinischen Ansatzes und des derzeitigen Krankheitsmodells, aber auch des Risikofaktorenmodells setzt (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 24; Faltermaier 1994, S. 45). Dabei geht er von einem Postulat aus, das einer philosophischen Grundposition gleichkommt: Leben bedeutet nicht im Gleichgewicht, sondern im Ungleichgewicht zu sein. Das Grundprinzip menschlicher Existenz ist demnach nicht Heterostase sondern Homöostase, das heißt Leiden und Tod sind ebenso wie Glück und Wohlbefinden Bestandteil menschlichen Lebens. Die ausschlaggebende Frage ist wie das System erhalten wird (vgl. Faltermaier 1994, S. 45). Er formuliert mit dem Modell der Salutogenese eine „Theorie der Gesundheit“ (Faltermaier 1994, S. 48). Diese ist in Abb.2. schematisch dargestellt und nachfolgend in ihren wesentlichen Zügen beschrieben.
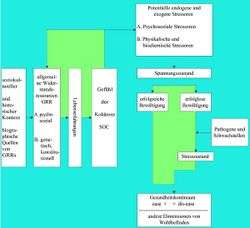
Das Modell von Antonovsky steht in der Tradition der Stress- und Bewältigungsforschung. Die Gefährdung der Gesundheit geht nach diesem Ansatz vom schädigenden Einfluss von Stressoren verschiedenster Art aus. Insofern spielen Stressoren nach Faltermaier (1994) „in diesem Modell eine zentrale Rolle, da sie sich bei einer Vielzahl von Krankheiten als Risikofaktoren erwiesen haben“ (S. 12). Im Gegensatz zu anderen Stressforschern geht Antonovsky davon aus, dass Stressoren allgegenwärtig sind und deren Wirkung nicht zwangsläufig gesundheitsschädigend sein muss. Er schlägt vor, zwischen Spannung und Stress zu unterscheiden. Die erste Reaktion ist seiner Meinung nach physiologische Spannung (psychophysische Aktivierung) und darauf zurückzuführen, dass Personen nicht wissen, wie sie in einer Situation reagieren sollen. Antonovsky definiert Stressoren als „eine von innen oder außen kommende Anforderung an den Organismus, die sein Gleichgewicht stört und die zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes eine nicht-automatische und nicht unmittelbar verfügbare, energieverbrauchende Handlung erfordert“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 32f.).
Antonovsky unterscheidet physikalische (z.B. Kälte, Lärm, Wetterkatastrophen), biochemische (z.B. Bakterien, Viren, Parasiten, Gifte und Schadstoffe) und psychosoziale (z.B. kritischen Lebensereignisse und -erfahrungen) Stressoren. Ob daraus Stress und im weiteren Verlauf gesundheitsschädigende Prozesse entstehen, ist von den Bewertungs- und Bewältigungsreaktionen des Individuums abhängig (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 85; s.3.3.1). Werden Stressoren und Spannungen erfolgreich bewältigt, bewegt sich eine Person auf dem Gesundheitskontinuum eher in die positive Richtung. Gelingt das nicht, dann reagiert der Organismus mit einem Stresszustand, der in Interaktion mit anderen Pathogenen und möglichen Schwachstellen des Organismus eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung des Gesundheitskontinuums bewirkt (vgl. Faltermaier 1994, S. 50).
Generell gilt, dass der menschliche Organismus als System permanent (natürlichen) Einflüssen und Prozessen ausgesetzt ist, die eine Störung seiner Ordnung (d.h. seiner Gesundheit) bewirken. Gesundheit ist demnach kein stabiler Gleichgewichtszustand, sondern muss in der Auseinandersetzung mit krankmachenden Einflüssen kontinuierlich neu aufgebaut werden. Gesundheit und Krankheit sind keine einander ausschließende Zustände, sondern die Extrempole auf einem Kontinuum. Dazwischen liegen Zustände von relativer Gesundheit und relativer Krankheit.
Die Art und der Erfolg von Bewältigungsversuchen wird wesentlich dadurch bestimmt, auf welche Ressourcen eine Person zurückgreifen kann. Demnach muss „die Suche nach spezifischen Krankheitsursachen (pathogenetischer Ansatz) [...] nach Antonovsky durch die Suche nach gesundheitsfördernden bzw. gesunderhaltenden Faktoren (salutogenetischer Ansatz) ergänzt werden“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 85). Diese Faktoren bezeichnet er als „generalized resistance resources“ (GRR), also generalisierte Widerstandsressourcen, und versteht darunter „jedes Merkmal einer Person, Gruppe oder Umwelt, das eine wirksame Spannungsbewältigung erleichtern kann“ (zitiert nach Faltermaier 1994, S. 51). Antonovsky diskutiert diejenigen Widerstandsressourcen, die auf eine gewisse empirische Unterstützung verweisen und auf verschiedenen Ebenen wirksam sein können:
- eine präventive Gesundheitsorientierung als unmittelbar für die Gesunderhaltung relevante GRR, die sich z.B. in der Vermeidung von Stressoren oder im Aufsuchen von Vorsorgeuntersuchungen ausdrückt;
- physikalische und biochemische GRRs wie z.B. eine besondere Reagibilität des Immunsystems;
- materielle GGRs wie Geld oder die Verfügbarkeit über Güter oder Dienstleistungen;
- kognitive und emotionale GGRs wie z.B. Wissen, Intelligenz oder Ich- Identität;
- effektive Bewältigungsstile als GRRs, die sich durch Rationalität, Flexibilität und Voraussicht charakterisieren lassen;
- interpersonale GRRs wie zum Beispiel die Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung oder die Eingebundenheit in und Bindung an soziale Netzwerke;
- makrosoziokulturelle GRRs wie beispielsweise die Verbundenheit mit stabilen Kulturen, rituell-magischen Aktivitäten oder religiösen Glaubensystemen (vgl. Faltermaier 1994, S. 51).
Durch die Frage nach Widerstandsressourcen steht der ganze Mensch mit seiner Biographie im Mittelpunkt und nicht nur seine Erkrankung bzw. seine Symptome. Der Wandel bezüglich der Gesundheitsvorstellung führt notwendigerweise zu einer Verschiebung des Fokus von der Risiko-Orientierung hin zur Ressourcen-Orientierung. Gesundheitswissenschaftliche Konzepte gehen davon aus, dass Ressourcen bei der Bewältigung (Coping) von Belastungen helfen und somit verhindern, dass der Organismus in einen längeren Stresszustand verfällt. Hinsichtlich der Gesundheitsbildung kann die Aktivierung von Ressourcen ein Schlüssel zum Erfolg einer Gesundheitsförderung sein. Eine Zusammenfassung der bisherigen Klassifizierungen von Ressourcen bietet die nachfolgende Tabelle, die von Oda (2001) im Rahmen einer Studie über „Spontanremissionen bei Krebserkrankungen aus der Sicht des Erlebenden“ zusammengestellt hat. Da die Erklärung der in dieser Tabelle klassifizierten Ressourcen den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, verweise ich zur weiterführenden Lektüre z.B. auf Oda (2001). Ich beschränke mich an dieser Stelle auf den Hinweis, dass Entspannung unter interne verhaltensbezogene Ressourcen fällt.
Im Widerspruch zu Oda (2001) handelt es sich nach Faltermaier (1994) bei dem Gefühl der Kohärenz (sense of coherence, SOC) um ein „alle Widerstandsressourcen integrierendes Konzept“ (S. 53). Dabei stellt es eine individuelle, psychologische (sowohl kognitive als auch affektiv-motivationale) Einflussgröße dar: eine allgemeine Grundhaltung gegenüber der Welt und dem eigenen Leben. Diese hängt davon ab, wie gut jemand in der Lage ist, vorhandene Ressourcen zum Erhalt seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens zu nutzen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 28). Der Ausgang von Bewertungs- und Bewältigungsreaktionen und damit der Gesundheits- bzw. Krankheitszustand einer Person wird wesentlich durch dieses Konstrukt bestimmt. Das Kohärenzgefühl ist somit die zentrale Kraft zur erfolgreichen Stressbewältigung. Antonovsky (1997) definiert es als: „eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, daß die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen“ (S. 36). Diese Grundhaltung, die Welt als zusammenhängend und sinnvoll zu erleben, setzt sich nach Antonovsky somit aus den folgenden drei Komponenten zusammen:
- Dem Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility)
Hierbei handelt es sich um die Erwartung bzw. Fähigkeit von Menschen, Stimuli (auch unbekannte) als geordnete, konsistente, strukturierte Informationen verarbeiten zu können. Also nicht mit Reizen und Situationen konfrontiert zu sein bzw. zu werden, die chaotisch, willkürlich, zufällig und unerklärlich sind. Verstehbarkeit ist nach Antonovsky ein kognitives Verarbeitungsmuster (vgl. Antonovsky 1997, S. 34f.).
- Dem Gefühl von Handhabbarkeit (sense of manageability)
Hierbei handelt es sich um die Überzeugung eines Menschen, dass Schwierigkeiten lösbar sind. Antonovsky (1997) nennt dies auch instrumentelles Vertrauen und definiert es als das „Ausmaß, in dem man wahrnimmt, daß man geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen“ (S. 35). In diesem Zusammenhang betont er, dass es nicht allein darum geht, über eigene Ressourcen und Kompetenzen verfügen zu können, sondern auch darum zu glauben, dass andere Personen oder eine höhere Macht dabei helfen, Schwierigkeiten zu überwinden. Handhabbarkeit ist nach Antonovsky ein kognitiv-emotionales Verarbeitungsmuster (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 29).
- Dem Gefühl von Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness)
Hierbei handelt es sich nach Antonovsky (1997) um das „Ausmaß, in dem man das Leben als emotional sinnvoll empfindet: daß wenigstens einige der vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, daß man Energie in sie investiert, daß man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, daß sie eher willkommene Herausforderungen sind, als Lasten, die man gerne los wäre“ (S. 35). Diese Komponente ist nach Antonovsky die wichtigste, denn ohne die Erfahrung der Sinnhaftigkeit und ohne positive Erwartungen an das Leben ergibt sich trotz einer hohen Ausprägung der anderen beiden Komponenten kein hoher Wert des Kohärenzgefühls. Das Leben wird in allen Bereichen nur als Last empfunden und jede weitere sich zusätzlich stellende Aufgabe als Qual. Sinnhaftigkeit ist nach Antonovsky ein affektiv-motivationales Verarbeitungsmuster (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 29f.).
Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl führt dazu, durch Aktivierung angemessener Ressourcen, flexibel auf spezifische Situationen reagieren zu können. Ein gering ausgeprägtes Kohärenzgefühl hingegen führt zu einer eher starren und rigiden Antwort auf Anforderungen, da weniger Ressourcen zur Bewältigung vorhanden sind bzw. wahrgenommen werden (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 30). Das Kohärenzgefühl wirkt dabei als flexibles Steuerungsprinzip, das den Einsatz verschiedener Verarbeitungsmuster (Copingstile, Copingstrategien) in Abhängigkeit von den Anforderungen aktiviert. Das Kohärenzgefühl entwickelt sich im Laufe der Kindheit und Jugend, beeinflusst von gesammelten Erlebnissen und Eindrücken. Mit etwa dreißig Jahren ist es nach Antonovsky ausgeprägt und bleibt relativ stabil. Er bezeichnet es daher auch als dispositionale Orientierung. Ob sich ein stark oder gering ausgeprägtes Kohärenzgefühl herausbildet, hängt für Antonovsky von gesellschaftlichen Gegebenheiten und der familiären Sozialisation ab, nämlich von der Verfügbarkeit der erwähnten generalisierten Widerstandsressourcen (GRR). Eine grundlegende Veränderung im Erwachsenenalter hält er nur für begrenzt möglich (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 86). Höchstens durch radikale Veränderungen der sozialen, kulturellen und strukturellen Einflüsse, welche die bisherigen Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten massiv verändern oder viele unerwartete Erfahrungen mit sich bringen, könne das Kohärenzgefühl verändert werden (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 31). Auf welche Weise kann jetzt ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl die Gesundheit fördern? Antonovsky geht von folgenden drei Einflussmechanismen über die Wahrnehmung von Stressoren aus. Diese hat er in Anlehnung an das transaktionale Modell von Lazarus (s.3.3.1) konzipiert und umfassen folgende Stufen:
- primary appraisal I
Menschen mit einem hohen SOC tendieren dazu, fordernde Situationen nicht als Belastung einzuschätzen, und erfahren daher keinen Spannungszustand.
- primary appraisal II
Auf dieser zweiten Stufe wird eingeschätzt, ob der Stressor das eigenen Wohlbefinden beeinflusst. Auch hier besteht die Annahme, dass Menschen mit hohem SOC die Stresssituation eher als günstig oder irrelevant wahrnehmen, als Menschen mit niedrigem SOC und somit ihre Spannung schneller abbauen können.
- primary appraisal III
Antonovsky nimmt an, dass auf einer dritten Stufe Personen mit hohem SOC im Gegensatz zu Personen mit niedrigem Kohärenzgefühl erstens Probleme klarer und differenzierter wahrnehmen und zweitens, dass ausgelöste Emotionen stärker fokussiert und weniger diffus (und damit lähmend) sind (vgl. Faltermaier 1994, S. 53).
Die ausgelöste Spannung wird gelöst, indem das Individuum seine Widerstandsressourcen zur Problembewältigung mobilisiert. Dabei ist eine Person mit hohem SOC eher in der Lage aus ihren generalisierten und spezifischen Widerstandressourcen die geeignete Kombination zu mobilisieren und die für die Situation angemessene Copingstrategie zu wählen. Demzufolge trägt ein hohes Kohärenzgefühl dazu bei, die durch Stressoren ausgelösten Spannungszustände des Organismus erfolgreich zu lösen und die zugrundeliegenden Probleme zu bewältigen. Indem ein Stresszustand erfolgreich gelöst werden kann, wird eine Bewegung zum gesunden Pol des Gesundheitskontinuums gefördert (vgl. Faltermaier 1994, S. 53f.).
Zur empirischen Überprüfung seiner Theorie hat Antonovsky einen Fragebogen entwickelt, den Orientation to Life Questionary (bzw. die SOC-Skala) (vgl. Antonovsky 1997, S. 79ff.). Die empirische Fundierung des Salutogenese-Modells besteht aus Querschnittuntersuchungen, die den Zusammenhang von Kohärenzgefühl mit verschiedenen Parametern psychischer und physischer Gesundheit und Persönlichkeitseigenschaften messen. Dabei erlauben die Korrelationen keine Aussagen über Ursachenzusammenhänge. Wenn sich also bedeutsame Korrelationen zwischen einem hohen SOC und einer Gesundheitsvariable finden, ist noch nicht nachgewiesen, dass das Kohärenzgefühl ein ursächlicher Faktor für Gesundheit ist (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 40ff.). Viele empirische Studien bestätigen seit der Entwicklung dieses Modells vor über 20 Jahren die Aussagen Antonovskys in Bezug auf die Stresswahrnehmung und Stressbewältigung. Das Kohärenzgefühl hat demnach Einfluss auf die Bewertung von Stressoren und deren Bewältigung und kann eine Anpassung an schwierige Lebenssituationen erleichtern. Menschen mit hohem SOC nehmen Ereignisse und Anforderungen eher als Herausforderungen und weniger als Belastung wahr. Wenn sie dennoch Stress erleben, können sie ihn schneller wieder abbauen (vgl. ebd., S. 46ff.).
Entgegen der Annahme Antonovskys, dass das Kohärenzgefühl im Erwachsenenalter eine stabile Eigenschaft ist, finden sich aufgrund von entsprechenden Studien Hinweise, dass mit zunehmendem Alter auch die Stärke des Kohärenzgefühls zunimmt. Um fundierte Aussagen über die Veränderbarkeit dieses Konstrukts zu machen, fehlen jedoch Längsschnittstudien (vgl. ebd., S. 51).
Stress
Die beiden Begriffe Spannung und Entspannung bilden Gegenpole eines natürlich angelegten Reaktionsmusters. Heute wird für den Begriff Spannung, vor allem wenn es sich um krankmachende Dauerspannung handelt, in der Psychologie und der Medizin wie auch im Alltagsgebrauch der weiterführende Begriff Stress verwendet. Die Begriffe Entspannung und Stress sind ähnlich eng miteinander verknüpft, wie die Begriffe Gesundheit und Krankheit. Stress und seinen Folgen entgegenzuwirken, ist deshalb der wohl am häufigsten auftretende Motivationsgrund ein Entspannungsverfahren zu erlernen. Dieses Kapitel behandelt verschiedene Aspekte des Stressgeschehens. Dabei lassen sich Überschneidungen zu dem vorangegangen Kapitel über Gesundheit und Krankheit aufgrund der thematischen Nähe nicht vermeiden. Was die Vorgehensweise betrifft, kläre ich zunächst den Stressbegriff, um im folgenden darauf einzugehen, wie Stress zustande kommt und wie er sich abhängig von der kognitiven Bewertung sowohl auf den Körper als auch auf die Psyche auswirkt. Schließlich zeige ich aktuelle Tendenzen der Stressthematik auf.

Auseinandersetzung mit dem Stressbegriff
Ursprünglich kommt der längst zum Schlagwort gewordene Begriff Stress aus dem Englischen. Er wird in einem physikalischen Zusammenhang verwendet und zwar speziell in der Materialprüfung. Unter Stress wird in diesem Sinne die Anspannung, Verzerrung und Verbiegung von Metallen oder Glas verstanden (vgl. Vester 1976, S. 14). Der Begriff Stress wird 1950 von dem ungarisch-kanadischen Mediziner Hans Selye (1907-1982) in die Medizin und die Psychologie eingeführt. Selye beschreibt damit etwas Ähnliches: die Belastungen, Anstrengungen und Ärgernisse, denen eine Person täglich durch viele Umwelteinflüsse (wie z.B. Lärm, Hetze, Frustrationen, Schmerz, Existenzangst) ausgesetzt ist. Also Anspannungen, Verzerrungen und Anpassungszwänge, die eine Person aus dem persönlichen Gleichgewicht (der Homöostase) bringen und sie folglich seelisch und körperlich unter Druck setzen (vgl. Vester S. 14). Stress ist demnach eine Anpassungsreaktion auf alles was die Balance lebenswichtiger Funktionen wie zum Beispiel Temperatur oder Blutdruck stört (vgl. Possemeyer 2002, S. 148).
Eine umfassende Definition von Stress liefert Zimbardo (19956): „Stress ist ein Muster spezifischer und unspezifischer Reaktionen eines Organismus auf Reizereignisse, die sein Gleichgewicht stören und seine Fähigkeiten zur Bewältigung strapazieren oder überschreiten. Diese Reizereignisse umfassen eine ganze Bandbreite externer und interner Bedingungen, die allesamt als Stressoren bezeichnet werden. Ein Stressor ist ein Reizereignis, das vom Organismus eine adaptive Reaktion verlangt. Die Stressreaktion ist zusammengesetzt aus einer vielfältigen Kombination von Reaktionen auf unterschiedlichen Ebenen, einschließlich physiologischer, verhaltensbezogener, emotionaler und kognitiver Veränderungen“ (S. 575; Hervorhebungen: E. K.). Stress ist demnach ein Reaktionsmuster, mit dem eine Person auf physiologischer und psychischer Ebene auf Stressoren antwortet, also auf Reizereignisse, die sein Bewältigungspotential auf die Probe stellen.
Ursachen von Stress
Stress ist ein Phänomen, dass zum Leben gehört. Dass im Laufe des Lebens Veränderungen auftreten, ist ganz natürlich und unvermeidlich. Die Aussage „Das einzig Beständige im Leben ist der Wandel“ (Macha; Mauermann 1997, S. 7) ist kennzeichnend für vielfältige Veränderungen in der Biographie einer Person, in ihrem alltäglichen Leben, in ihrem gesellschaftlichen Kontext und in ihrer Umwelt. Veränderungen versetzen eine Person zunächst in einen Spannungszustand, der Anpassungsleistungen erforderlich macht. In diesem Sinne können sie auch als Stressoren bezeichnet werden. Eine Möglichkeit Stressoren zu definieren und zu kategorisieren, habe ich bereits im Zusammenhang mit dem Modell der Salutogenese von Antonovsky erwähnt (s.2.4.4).
Antonovsky unterscheidet weiterhin (in Übereinstimmung mit der psychologischen Forschungsliteratur) zwischen drei Arten von Stressoren: „größere Lebensereignisse“, „daily hassles (alltägliche Ärgernisse)“ sowie „chronische Stressoren“ (Faltermaier 1994, S. 48). In diesem Zusammenhang nennt Zimbardo (19956) eine vierte Dimension der Ursachen von Stress, nämlich „unvorhersehbare katastrophale Ereignisse“ (S. 586). Bedeutende Lebensveränderungen, selbst erfreuliche, können ebenso als stressbeladen erlebt werden wie die Ansammlung von alltäglichen Ärgernissen. Chronische Stressoren und Katastrophen können schweren Stress verursachen. Auf diese vier Ursachen von Stress, gehe ich im folgenden näher ein.
Kritische Lebensereignisse
Die heutige Stressforschung beschäftigt sich vor allem mit dem Wandel im Lebenslauf einer Person und fokussiert dabei insbesondere sogenannte „kritische Lebensereignisse“ (Schaufler 2000, S. 118). Kritische Lebensereignisse können beispielsweise Übergänge (Transitionen) in der Biographie einer Person sein, wie beispielsweise der zur Elternschaft. Grundsätzlich können kritische Lebensereignisse sowohl positive (etwa wenn sich zwei Personen ineinander verlieben) als auch negative (etwa von einer geliebten Person verlassen zu werden) Erfahrungen darstellen. Beiden ist jedoch gemein, dass sie einen Einschnitt im Leben einer Person bedeuten, der eine fortlaufende Anpassung an die sich wandelnde Situation erfordert. Fthenakis et al. (1999) untersuchte in einer Längsschnittstudie den Übergang zur Elternschaft, besonders den Übergang zur Vaterschaft und die damit verbundenen Veränderungen (vgl. ebd., S. 70ff.). Ein Ergebnis ist, dass mit der Geburt eines Kindes eine „Umverteilung der beruflichen und familiären Aufgaben“ (ebd., S. 74) stattfindet, und zwar im Sinne einer traditionellen Rollenverteilung. Die Väter erhöhen ihre Wochenarbeitszeit (von 33,4 auf 39,9 Stunden), wohingegen die Mütter ihre eigene Berufstätigkeit unterbrechen oder ganz aufgeben (vgl. ebd.). Dabei sind vor allem Frauen mit ihrer Rolle unzufrieden Der Stresspegel steigt für beide Elternteile: das Ausmaß von „Streit und Konflikten zwischen den Partnern“ nimmt zu, bei gleichzeitiger Abnahme des Ausmaßes von „Zärtlichkeit und Sexualität“ sowie „von Kommunikation und Austausch“ (ebd., S. 77f.).
Nach Zimbardo (19956) bilden „Veränderungen der allgemeinen Lebenssituation [...] für viele von uns den Kern streßerzeugender Lebensereignisse“ (S. 584). Sie können einer Person wirksames Handeln erschweren oder zu körperlichen Krankheiten führen. Der Einfluss bedeutender Lebensveränderungen auf die körperliche und seelische Gesundheit ist Thema zahlreicher Forschungsprojekte gewesen. Beispielsweise belegen viele Untersuchungen, dass das Ausmaß von Lebensveränderungen, wie es mit der Social Readjustment Rating Scale (SRRS) gemessen wird, vor dem Beginn einer Krankheit signifikant zunimmt. Stress durch Lebensveränderungen wird mit plötzlichem Tod durch Herzinfarkt, Tuberkulose, multipler Sklerose, Diabetes, Komplikationen im Verlauf von Schwangerschaften und bei Geburten, chronischen Krankheiten und vielen „kleineren“ gesundheitlichen Problemen (z.B. Schlaflosigkeit) in Zusammenhang gebracht. Es besteht die Annahme, dass Stress durch Lebensveränderungen die allgemeine Krankheitsanfälligkeit eines Menschen erhöht, wobei Krankheit selbst ein wesentlicher Stressor ist.
Eine Verbesserung der Messung der Auswirkungen von Lebensereignissen bietet der Life Experiences Survey (LES), der zwei typische Eigenschaften hat. Erstens liefert er Werte sowohl für die Zunahme, als auch für die Abnahme von Veränderungen, während die SRRS nur die Zunahme registriert. Zweitens geben seine Werte individuelle Einschätzungen der Ereignisse und ihrer Erwünschtheit wieder. Der Tod eines ungeliebten Ehegatten, der eine große Erbschaft hinterlässt, kann beispielsweise als durchaus erwünscht eingeschätzt werden (vgl. Zimbardo 19956, S. 584f.). Die Skala geht also über die bloße Zählung der Lebensereignisse, an die sich eine Person erinnert, hinaus, indem sie die persönliche Bedeutung jeder Veränderung erfasst. Ein Problem bei der Untersuchung von Zusammenhängen zwischen stressreichen Lebensereignissen und darauf folgender Erkrankung besteht darin, dass sie meistens retrospektiv angelegt sind. Retrospektiv bedeutet, dass sowohl die Maße für Stress, als auch die Maße für Krankheit erhoben werden, indem man die Versuchspersonen an vergangene Ereignisse erinnern lässt. Das eröffnet die Möglichkeit für Verzerrungen im Gedächtnis, die sich auf das Resultat der Erinnerung verfälschend auswirken. Versuchspersonen, die sich nicht wohl fühlen, können sich beispielsweise mit größerer Wahrscheinlichkeit an Stressoren ihrer Vergangenheit erinnern, als Versuchspersonen, denen es gut geht. Prospektive Untersuchungen kommen jedoch zu ähnlichen Ergebnissen wie retrospektive Untersuchungen: negative Werte in Bezug auf Lebensveränderungen korrelieren signifikant mit den körperlichen Symptomen, die ein halbes Jahr später angegeben werden (vgl. Zimbardo 19956, S. 58).
Alltägliche Ärgernisse
Der Alltag kann mitunter voll verschiedener Frustrationen sein: eine Person ist mit dem Auto unterwegs zu einer wichtigen Verabredung, gerät ausgerechnet dann in einen Verkehrsstau, tritt als sie ankommt und aussteigt in eine Regenpfütze, hetzt mit nassen Schuhen und Socken zu dem Zielgebäude, muss ins achte Stockwerk, der Fahrstuhl ist außer Betrieb, sie nimmt die Treppe und, als sie oben ankommt, steht sie vor „verschlossenen Türen“.
Addieren sich diese alltäglichen Ärgernisse, können sie zu Stressoren werden und die Gesundheit einer Person angreifen. Diesen Zusammenhang zeigt die folgende Untersuchung in der „eine Gruppe weißer Mittelschichtangehöriger mittleren Alters und beiderlei Geschlechts ein Jahr lang Tagebuch über alltägliche Ärgernisse [führte]. Gleichzeitig wurden bedeutende Lebensveränderungen und körperliche Symptome festgehalten. Es zeigte sich eine deutliche Beziehung zwischen den kleinen Störungen und gesundheitlichen Problemen: Je häufiger und je intensiver diese Störungen laut Bericht waren, um so schlechter war es sowohl um die physische als auch um die psychische Gesundheit des Tagebuchführers bestellt“ (Zimbardo 19956, S. 586; Anpassung: E. K.).
Chronische Stressoren
Unmittelbar anstehende Probleme der Arbeit und der ökonomischen Sicherheit stellen eine bedeutende Stressursache für Erwachsene dar. Viele Probleme, die mit Stress zusammenhängen, nehmen in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs zu. Zum Beispiel steigen Aufnahmen in psychiatrische Anstalten, Säuglingssterblichkeit, Selbstmorde und Todesfälle aufgrund alkoholbedingter Erkrankungen sowie Herz-Kreislauferkrankungen (vgl. Zimbardo 19956, S. 587).
Die Globalisierung der Wirtschaft ist kein neues Phänomen. Intensität und Reichweite weltweiter Interaktionen zwischen Unternehmen, Kulturen und politischen Systemen haben allerdings seit Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts und insbesondere seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes deutlich zugenommen. Durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien werden geographische Distanzen und Landesgrenzen immer bedeutungsloser und erlauben intensive Kommunikation quer über den Globus ohne Standortwechsel der Beteiligten. Globalisierung eröffnet neue Chancen wirtschaftlichen Wachstums. Die Beschäftigten werden dadurch jedoch mit neuen Arbeits- und Organisationsformen konfrontiert, mit zunehmenden Beschäftigungsrisiken und einer Intensivierung der Arbeit. Das Tempo des sozioökonomischen Wandels hat deutlich zugenommen, Sicherheit und Berechenbarkeit der Markt- und Arbeitsverhältnisse haben dagegen spürbar abgenommen. Diese Tatsache stellt einen weiteren, aktuell sehr bedeutenden chronischen Stressor dar (vgl. Graham; Takala; Machida 2003, S. 12).
Des Weiteren erzeugt die „Zerstörung des ökologischen Lebensraums“ (Hurrelmann 1990, S. 155) sowohl psychischen Stress als auch physische Bedrohung. Die chemischen Errungenschaften der modernen Technologie sind auch Ursache der Verseuchung ganzer Landstriche, deren Bewohner evakuiert werden müssen. Der Störfall im Atomkraftwerk von Three Mile Island im Jahre 1979 und das darauffolgende Ausströmen radioaktiver Dämpfe sowie die Katastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986 sind Beispiele für umweltbedingte Stressoren. „Diejenigen, die in der Umgebung lebten, erlebten beträchtlichen Stress, denn sie fürchteten die unmittelbaren und die langfristigen Folgen für ihre Gesundheit“ (Zimbardo 19956, S. 587). Schließlich gilt der heutige Straßenverkehr mit seinem hohen Lärmpegel, seiner hohen Dichte an optischen Eindrücken und seinen vielen angstauslösenden Situationen als „Streßverursacher erster Ordnung“ (Knörzer 1994, S. 234).
Katastrophale Ereignisse
Die Erforschung der körperlichen und seelischen Auswirkungen katastrophaler Ereignisse, traumatischer Erlebnisse, ist äußerst aufschlussreich: in den Reaktionen von Personen auf Katastrophen treten in vorhersehbarer Weise fünf Phasen auf (vgl. Zimbardo 19956, S. 586).
- Typischerweise gibt es erst eine Phase des Schocks und sogar der „psychischen Abstumpfung“ (Zimbardo 19956, S. 586), während der die Personen das, was geschehen ist, nicht in vollem Umfang begreifen können.
- Die nächste Phase beinhaltet das, was als „automatisches Handeln“ (ebd.) bezeichnet wird. Es wird versucht auf die Katastrophe zu reagieren und es gelingt sich anpassungsorientiert zu verhalten. Die betroffenen Personen sind sich jedoch dessen, was sie tun, nicht richtig bewusst und können sich später an die Erfahrungen dieser Phase nur schlecht erinnern.
- Während der nächsten Phase spüren sie, dass sie etwas erreicht haben. Sie haben sogar ein positives Gefühl der Anstrengung für ein Ziel. In dieser Phase fühlen sie sich müde und merken, dass sie ihre Energiereserven aufbrauchen.
- Während der vierten Phase erfahren sie „ein Nachlassen“: ihre Energien sind erschöpft, „der Eindruck der Tragödie schlägt schließlich durch“ und wird emotional empfunden (ebd.).
- Darauf folgt eine ausgedehnte Phase der Erholung, in der die Personen sich wieder ausruhen und mit den aus der Katastrophe resultierenden Veränderungen umgehen.
Die Kenntnis dieser typischen Reaktionsphasen liefert ein Modell, zur Vorhersage der Reaktionen von Personen auf Katastrophen. Dadurch wird es Helfern leichter gemacht, die Probleme, die auftauchen werden, zu antizipieren und entsprechende Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Reaktionen auf so unterschiedliche Ereignisse wie Überschwemmungen, Tornados, Flugzeugabstürze und Explosionen von Fabriken folgen diesem Modell (vgl. Zimbardo 19956, S. 586).
Auswirkungen von Stress
Die Bedeutung der kognitiven Bewertung
Die Reaktion auf einen Stressor ist von Person zu Person (interindividuell) verschieden. „Einige Menschen erleben ein stressreiches Ereignis nach dem anderen, ohne zusammenzubrechen, wohingegen sich andere sogar bei wenig Stress aufregen, da sich die meisten Stressoren nicht direkt auswirken“ (Zimbardo 19956, S. 576). Ihr Effekt ist abhängig von der kognitive Bewertung eines Stressors (ob er als Bedrohung oder als Herausforderung gesehen wird). Die kognitive Bewertung wird auch als „Moderatorvariable“ (ebd.) bezeichnet, da sie die Wirkung eines wahrgenommenen Stressors moderiert. Weitere Moderatorvariablen sind innere und äußere Ressourcen zum Umgang mit einem Stressor, Einstellungen und Bewältigungsmuster (vgl. ebd.). Das Gefühl der Kohärenz, welches ebenfalls entscheidend dazu beiträgt, wie ein Stressor wahrgenommen und bewertet wird, habe ich bereits im Rahmen des Modells der Salutogenese (s.2.4.4) dargestellt.
Bevor eine Stressreaktion einsetzt muss der Stressor zunächst sinnlich wahrgenommen und dann bewertet worden sein. Die kognitive Bewertung (cognitive appraisal) spielt eine zentrale Rolle bei der Situationsdefinition: was für eine Anforderung es ist, wie groß die Bedrohung ist, welche Ressourcen für Gegenmaßnahmen zur Verfügung stehen und welche Strategien angemessen sind. Einige Stressoren, beispielsweise ein Autounfall, eine schwere körperliche Krankheit oder der Tod einer geliebten Person, werden von fast allen Menschen als Bedrohung betrachtet. Viele andere Stressoren können jedoch auf unterschiedliche Weisen gesehen werden, abhängig von der allgemeinen Lebenssituation, der Beziehung dieser bestimmten Anforderung zu wichtigen Zielen, der Kompetenz zu ihrer Bewältigung und der Bewertung dieser Kompetenz. Die Bewertung eines Stressors und der Ressourcen zu seiner Bewältigung können für die bewusste Erfahrung, für die Auswahl geeigneter Bewältigungsstrategien und für den erfolgreichen Umgang mit Stress genauso wichtig sein wie der Stressor. Wird ein Stressor so interpretiert, dass er das Handlungspotential überfordert, so wird eine sich selbst erfüllende Prophezeiung geschaffen (vgl. Zimbardo 19956, S. 577). Wahrscheinlich wird eine Person scheitern, selbst wenn sie objektiv in der Lage wäre, mit der Herausforderung angemessen umzugehen (s.4.2).
Mittels der kognitiven Bewertung kann ein Stressor als interessante und neue Herausforderung definiert werden, die eine Person dann gerne annimmt, anstatt ihn als Bedrohung zu erleben. Eine Stresserfahrung kann daher durchaus anregend sein, eine Art „Aufputschen“ und Erwartungen von Erfolg sowie gesteigertes Selbstbewusstsein nach sich ziehen. Solch eine positive Reaktion auf Stressoren wird als Eustress im Gegensatz zu Distress bezeichnet. Eustress ist demnach „zur Gesunderhaltung des Gesamtorganismus notwendig und gut“, wohingegen Distress „unser Leib-Seele-Gleichgewicht auf Dauer stören und zu psychosomatischen Krankheiten führen kann“ (Schenk 1993, S. 11).
Ob ein Stressor als Herausforderung oder Belastung gesehen wird, liegt demnach im Erleben des Subjektes, es gibt keinen objektiven Maßstab dafür, was als positiver oder negativer Stress erlebt wird (vgl. Schaufler 2000, S. 117). Eine Person reagiert also nicht direkt auf einen Stressor, sondern auf das, was ihre Wahrnehmung und ihre Interpretation ihr zeigen.
Richard Lazarus, ein Pionier der Stressforschung, hat 1966 zwei Stufen der kognitiven Bewertung von Anforderungen unterschieden (vgl. Zimbardo 19956, S. 577).
- Die primäre Bewertung (primary appraisal) bezieht sich auf die Bewertung der Merkmale einer Situation, das heißt belastende Ereignisse können als Bedrohung, Herausforderung oder als irrelevant für das eigene Wohlbefinden eingeschätzt werden;
- Die sekundäre Bewertung (secondary appraisal) bezieht sich auf die Einschätzung der persönlichen und sozialen Ressourcen, das heißt der eigenen Möglichkeiten, eine belastende Situation allein oder mit Unterstützung anderer zu bewältigen (vgl. ebd.).
Während die Maßnahmen zur Stressbewältigung ausprobiert werden, wird die Bewertung fortgesetzt. Falls die erste Maßnahme unwirksam bleibt und der Stress andauert, werden neue Reaktionen in Gang gesetzt. Es kommt zu chronischem Stress, einem „Erregungszustand, der andauert, während die Anforderungen von der Person als größer als die verfügbaren inneren und äußeren Ressourcen zur Bewältigung wahrgenommen werden“ (Zimbardo 19956, S. 577). Die kognitive Bewertung definiert also die Anforderung. Die primäre Bewertung stellt fest, ob eine Anforderung stressreich ist, die sekundäre bewertet die verfügbaren persönlichen und sozialen Ressourcen und die Angemessenheit von Handlungsmaßnahmen. Bei chronischem Stress werden die Anforderungen im Laufe der Zeit größer als die Ressourcen.
Das transaktionale Stressmodell von Lazarus ist wohl die einflussreichste Stressbewältigungstheorie. Beispielsweise wurde es von Antonovsky aufgegriffen und im Rahmen seiner Theorie der Gesundheit erweitert (s.2.4.4). Es ermöglicht einen Perspektivenwechsel von der objektiven Belastungsseite zu subjektiven Bewältigungsprozessen, also zu den mit der Bewältigung von Stress (Coping) verbundenen Anpassungsleistungen einer Person. Stress ist demnach keine unveränderliche Einflussgröße, sondern verändert sich durch individuelle Informationsverarbeitung und durch situationsbezogene Variablen. In diesem Zusammenhang bin ich der Meinung, dass die Bewertung eines Stressors nicht nur interindividuell verschieden ist, sondern sich auch intraindividuell verändern kann. Das Leben einer Person befindet sich in einem ständigen Wandel, so dass ein und der selbe Stressor unterschiedlich bewertet werden kann: abhängig zum Beispiel von der jeweiligen Tagesform oder vom jeweiligen Entwicklungsstand einer Person. Aus existenzphilosophischer Sicht ist selbst die Entwicklung eines Menschen nicht „stetig“ (Bollnow 1965, S. 18). Sie ist kein linearer Prozess, was bedeutet, dass eine Person in ihrem Lebenslauf kreisförmig verschiedene Entwicklungsstufen immer wieder durchläuft. Eine Person kann insofern „mal mehr und mal weniger verkraften“, so dass der gleiche Stressor von der gleichen Person zu verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben (unabhängig von ihrem Lebensalter), unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden kann.
Physische Stressreaktionen
Das Gehirn hat sich ursprünglich als Zentrum zur effektiveren Koordination von Handlungen entwickelt. Effizienz bedeutet in diesem Zusammenhang Flexibilität der Reaktionen auf sich verändernde Umweltanforderungen und auch eine schnellere, oft automatische Reaktion. Eine vom Gehirn kontrollierte physiologische Stressreaktion tritt dann auf, wenn ein Organismus eine äußere Bedrohung wahrnimmt (beispielsweise einen Angreifer). Sofortiges Handeln und besondere Stärke sind erforderlich, damit der Organismus überlebt. Eine ganze Konstellation automatischer Mechanismen hat sich in der Phylogenese (Stammesgeschichte der Lebewesen) entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Da ich der Meinung bin, dass es sowohl für die theoretische als auch für die praktische Beschäftigung auf diesem Gebiet von Bedeutung ist biologische und medizinische Aspekte zu beachten, um z.B. den Zusammenhang zwischen Stress und Krankheit herzustellen gehe ich im Folgenden auf die Stressphysiologie ein.
Die Alarmreaktion In den 1920ern entwirft der Physiologe Walter Cannon (1871-1945), die erste wissenschaftliche Beschreibung der Reaktion von Tieren und Menschen auf äußere Gefahren. Er findet heraus, dass in den Nerven und Drüsen eine Abfolge von Aktivitäten ausgelöst wird, die den Körper auf Gegenwehr und Kampf oder auf Flucht in die Sicherheit vorbereitet. Cannon nennt diese grundlegende zweifache Stressreaktion „fight-or-flight syndrome“ (Zimbardo 19956, S. 578).
In diesem Zusammenhang wird Stress von Selye definiert als „ein unspezifisches, stereotypes, phylogenetisch altes Antwortmuster, das primär den Organismus für physische Aktivität wie Kampf oder Flucht vorbereitet“ (Eiff 1976, S. 3). Demnach handelt es sich bei der körperlichen Stressreaktion um ein angeborenes Muster. Die Stressreaktion, auch als Alarm- und Notfallreaktion bezeichnet, ist eine entwicklungsgeschichtlich alte Funktion, die der Mensch mit höherentwickelten Tieren gemeinsam hat (vgl. Knörzer 1994, S. 233). Sinn der Stressreaktion ist ursprünglich die Lebenserhaltung durch einen reflexartigen Angriffs- und Fluchtmechanismus. Der vollständige Ablauf dieser Stressreaktion besteht aus drei Phasen, die in Abb.3 dargestellt und in Bsp.1 erläutert sind.
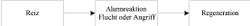
Bsp.1.: (modifiziert) nach Knörzer (1994, S. 233) Ein Steinzeitmensch, nur mit Fellen bekleidet und mit einer Keule bewaffnet, streift durch den Busch. Plötzlich hört er ein Knacken, sieht den Schatten eines sich nähernden gefährlichen Tieres, nimmt dessen Geruch wahr (Reiz). Ohne nachzudenken läuft er blitzschnell davon und bringt sich an einen ruhigen Platz in Sicherheit (Flucht), wo er sich ausruht (Regeneration).
Die Alarmreaktion wird demnach durch einen bedrohlichen Reiz, nämlich das gefährliche Tier, ausgelöst (vgl. Knörzer 1994, S. 233). Der gesamte Organismus ist auf zwei mögliche Verhaltensweisen programmiert: Flucht oder Angriff. Ohne weiteres Nachdenken wird unwillkürlich die Entscheidung für eine der beiden Verhaltensweisen getroffen und diese dann ausgeführt (in diesem Beispiel Flucht). Nach der erfolgten körperlichen Handlung ist eine Ruhepause zur Regeneration des Organismus notwendig (vgl. Olschewski 1995, S. 71). In diesem Zusammenhang gewinnen Entspannung und Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress an Bedeutung (s. 4.4). Folgende Vorgänge sind für den Ablauf der Stressreaktion verantwortlich. Die von den Sinnesorganen aufgenommenen Wahrnehmungsimpulse laufen sofort in eine Region des Zwischenhirns, wo sie Angst verursachen (Knörzer 1994, S. 233). Hierbei spielt der Hypothalamus eine zentrale Rolle. Wegen seiner doppelten Funktion bei Notfällen wird er von manchen Autoren als „Stresszentrum“ (Zimbardo 19956, S. 578) bezeichnet: er kontrolliert erstens das autonome Nervensystem und zweitens aktiviert er die Hypophyse (vgl. Zimbardo 19956, S. 578).
- Das autonome (oder vegetative) Nervensystem reguliert die Aktivitäten der Körperorgane und untersteht normalerweise nicht der direkten Kontrolle einer Person . Es ist unterteilt in den Sympathikus (zuständig für die Stressreaktion) und den Parasympathikus (zuständig für die Entspannungsreaktion) (vgl. Zimbardo 19956, S. 131f.). Angesichts einer als stressreich bewerteten Bedingung finden (auf der Aktivität des Sympathikus beruhend) folgende physiologische Veränderungen im menschlichen Organismus statt: die Atmung wird schneller und stärker, der Herzschlag beschleunigt sich, die Blutgefäße verengen sich und der Blutdruck steigt. Zusätzlich zu diesen inneren Veränderungen öffnen Muskeln die Wege durch Hals und Nase, um mehr Luft in die Lungen zu lassen. Zugleich verändern sie den Gesichtsausdruck so, dass starke Emotionen sichtbar werden. An die Eingeweidemuskulatur geht die Botschaft, bestimmte Körperfunktionen, zum Beispiel die Verdauung, einzustellen. Die Sexualfunktion und die Immunabwehr, ebenfalls Funktionen, die im Moment der Stressreaktion nicht gebraucht werden, werden „abgeschaltet“ (Olschewski 1995, S. 71). Damit wird jegliche Energie ungeteilt auf die Begegnung mit der Gefahr ausgerichtet. Ferner erfolgt das Signal, dass die Nebennieren die beiden Hormone, Adrenalin und Noradrenalin, ausschütten, die wiederum eine Reihe von Organen anweisen, ihre speziellen Funktionen auszuüben. Die Milz stellt mehr rote Blutkörperchen her, um im Fall einer Verletzung die Blutgerinnung zu unterstützen. Das Knochenmark wird angeregt, mehr weiße Blutkörperchen zu produzieren, um Infektionen zu bekämpfen. Die Leber wird angeregt, die Zuckerproduktion zu steigern, um mehr Energie für den Körper bereitzustellen (vgl. Groetschel 1984, 36ff.). Dabei wird angenommen, dass Adrenalin eine größere Rolle bei Angstreaktionen und Flucht spielt, während Noradrenalin mehr mit Reaktionen der Wut und Gegenwehr zusammenhängt (vgl. Zimbardo 19956, S. 578).
- Die Hypophyse reagiert auf die Signale aus dem Hypothalamus, indem sie zwei für die Stressreaktion wesentliche Hormone ausschüttet, das thyrotrophe Hormon und adrenocorticotrophe Hormon (ACTH). Ersteres regt die Schilddrüse an, die ihrerseits dem Körper mehr Energie zur Verfügung stellt. Das stimuliert die Nebennieren, was zur Ausschüttung einer Gruppe von Hormonen führt, die Stereoide heißen und für Stoffwechselprozesse und die Ausschüttung von Zucker aus der Leber ins Blut von Bedeutung sind. ACTH signalisiert verschiedenen Körperorganen die Ausschüttung von etwa dreißig anderen Hormonen, von denen jedes bei der Anpassung des Körpers an den Stressor eine Rolle spielt (vgl. Zimbardo 19956, S. 578).
Der reflexartige Ablauf der Stressreaktion ist für den modernen Menschen genauso überlebensnotwendig wie für den Steinzeitmenschen. Dies lässt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen.
Bsp.2.: (modifiziert) nach Knörzer (1994, S. 234) Eine Person läuft gedankenverloren über eine verkehrsreiche Straße. Plötzlich hört sie das Hupen und die Bremsgeräusche eines Autos. Mit einem schnellen Sprung bringt sie sich auf den Gehsteig in Sicherheit. Die durch das Hupen ausgelöste Alarmreaktion hat bewirkt, dass sie, ohne nachzudenken, blitzschnell der Gefahr ausweichen konnte. Nimmt sich diese Person anschließend auch noch die Zeit, um sich von dem Schreck zu erholen, vielleicht indem sie mehrmals tief durchatmet, bis sich ihr Herzschlag und ihre Atmung wieder beruhigt haben, so ist die Stressreaktion auch hier vollständig und durchaus gesundheitsfördernd verlaufen.
Wenn eine Person blitzartig mit Flucht oder Angriff reagiert, so geschieht dies vollkommen automatisch und unter Ausschaltung des Großhirns. Denn jedes Denken, jede Überlegung wäre Zeitverschwendung und würde eine große Gefahr für das Überleben darstellen. Durch die beschriebenen hormonellen Veränderungen wird der Organismus in einen Zustand gebracht, der zu körperlichen Höchstleistungen befähigt. Wird eines der beiden Handlungsmuster, Angriff oder Flucht durchgeführt, verbraucht der Körper die mobilisierte Energie. Die Überregung der Nervenbahnen wird zurückgedreht. Danach setzt eine Entspannungsreaktion und Aktivierung des parasympathischen Nervensystems ein. Die verbrauchten Kräfte können sich in einer Ruhepause regenerieren. Der Stressmechanismus und seine Folgen sind also ursprünglich und auch heute natürlich und sogar gesundheitsförderlich, da sie eine Person vor größeren Verletzungen schützen (z.B. im Straßenverkehr) und damit lebenserhaltend sind. Insofern stellt sich die Frage, warum Stress die Mehrzahl der gegenwärtigen Krankheiten mitbedingt.
Dazu ist es notwendig Reize (Stressoren), die gegenwärtig die Stressreaktion auslösen, zu betrachten. Am Beispiel des Straßenverkehrs lässt sich erkennen, warum diese Stressreaktionen eine Person krank machen kann. Angenommen aus einer Seitenstraße schießt ein Auto hervor, nimmt ihr die Vorfahrt, so dass sie gerade noch rechtzeitig ausweichen oder bremsen kann, so ist es für diese Person unmöglich zu fliehen oder anzugreifen. Es ist ganz im Gegenteil wichtig ruhig zu bleiben, um angemessen reagieren zu können. Hinter dem Steuer sitzend kann sie sich nicht körperlich abreagieren, so dass beispielsweise die während der Stressreaktion mobilisierten Fettsäuren nach und nach in Cholesterin umgewandelt werden. Das Cholesterin lagert sich direkt in die Blutgefäße ein, was die Arteriosklerose (eine Zivilisationskrankheit) beschleunigt. Die erhöhten Blutgerinnungsfaktoren steigern zusätzlich die Thrombosegefahr . Die gleichen Stressreaktionen treten auch als Folge von psychischen Stressoren auf, zu deren Bewältigung sie jedoch nicht angemessen sind, da oftmals keine körperliche Aktivität, die zusätzliche Kraft und Energie verbraucht, erforderlich ist (vgl. Zimbardo 19956, S. 586). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass physiologische Stressreaktionen automatische Mechanismen sind, die rasche „Notfallhandlungen“ erleichtern. Sie werden durch den Hypothalamus reguliert und umfassen mehrere Alarmreaktionen des Körpers, die durch die Aktivität des Autonomen Nervensystems und der Hypophyse ausgelöst werden. Sie verringern die Schmerzempfindlichkeit und liefern zusätzliche Energie für Flucht oder Widerstand. Sie sind nützlich bei der Bekämpfung physischer Stressoren, können jedoch in Reaktion auf psychische Stressoren, insbesondere bei schwerem oder andauerndem Stress, schädlich wirken.
Das allgemeine Adaptionssyndrom Selye ist der erste, der die Auswirkungen von andauerndem schweren Stress auf den Körper mit wissenschaftlichen Mitteln untersucht. Als Endokrinologe interessiert er sich für Stressoren, die die Körperfunktionen bedrohen. Nach Selyes Stresstheorie gibt es viele Arten von Stressoren, einschließlich aller Krankheiten und vieler anderer körperlicher und psychischer Bedingungen. Allen ist jedoch gemeinsam, dass sie eine Anpassung des Organismus verlangen, damit dessen Unversehrtheit und Wohlbefinden aufrechterhalten oder wiederhergestellt wird (vgl. Zimbardo 19956, S. 579). Zusätzlich zu den Reaktionen, die für einen bestimmten Stressor spezifisch sind, wie zum Beispiel die Verengung der Blutgefäße als Reaktion auf Kälte, gibt es ein typisches Muster unspezifischer adaptiver physiologischer Mechanismen. Dieses Muster tritt in Reaktion auf eine fortgesetzte Bedrohung durch jeden ernstzunehmenden Stressor auf. Selye bezeichnet dieses Muster als allgemeines Adaptionssyndrom. Er findet eine charakteristische Abfolge von drei Phasen, die dieses Syndrom kennzeichnet: eine Alarmreaktion, eine Phase der Resistenz und eine Phase der Erschöpfung (vgl. Selye 1957, S. 44f.).
- Die Alarmreaktion besteht aus physiologischen Veränderungen, durch die ein bedrohter Organismus unmittelbar die Wiederherstellung seines normalen Funktionsniveau zu erreichen versucht. Ob der Stressor ein physischer ist, wie unzureichende Ernährung, Schlafmangel, Krankheit oder Verletzung, oder ein psychischer, wie Verlust von Liebe oder persönlicher Sicherheit, die Alarmreaktion besteht immer aus dem gleichen allgemeinen Muster körperlicher und biochemischer Veränderungen. Beispielsweise scheinen sich Menschen, die an ganz unterschiedlichen Krankheiten leiden, alle über Symptome wie Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit, Schmerzen in Muskeln und Gelenken, Verlust des Appetits und ein allgemeines Gefühl des Unwohlseins zu beklagen. Im Unterschied zu den Notmaßnahmen der Mobilisierung von Verhaltensreaktionen gegen eine äußere Gefahr, mobilisiert die Alarmreaktion die körpereigene Abwehr zur Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts (vgl. Zimbardo 19956, S. 580).
- Dauert die stressauslösende Situation an, so folgt auf die Alarmreaktion die Phase der Resistenz, während der der Organismus einen Widerstand gegenüber dem Stressor zu entwickeln scheint. Obwohl die belastende Stimulation andauert, verschwinden die Symptome, die während der ersten Phase auftreten, und die physiologischen Prozesse, die durch die Alarmreaktion in Aufruhr geraten sind, folgen wieder ihren normalen Abläufen (vgl. Selye 1957, S. 148f.). Diese Resistenz gegen den Stressor scheint hauptsächlich durch gesteigerte Hormonausschüttungen aus dem Hypophysenvorderlappen und den Nebennieren bewirkt zu werden (vgl. Zimbardo 19956, S. 579). Auch wenn es in dieser zweiten Phase eine größere Resistenz gegenüber dem ursprünglichen Stressor gibt, so ist doch die Resistenz gegenüber anderen Stressoren reduziert. Selbst ein schwacher Stressor kann in diesem Stadium eine starke Reaktion hervorrufen, wenn die Ressourcen des Körpers durch den Widerstand gegen einen früheren, mächtigeren Stressor gebunden sind (vgl. Selye 1957, S. 148f.). Beispielsweise stellen einige Menschen fest, dass sie leichter gereizt reagieren, während sie dabei sind, sich von einer Grippe zu erholen. Die allgemeine Resistenz gegenüber Krankheit ist während dieser Phase reduziert, wenn auch die Anpassung an die spezifischen schädlichen Einflüsse verbessert ist (vgl. Zimbardo 19956, S. 579).
- Wenn der Organismus den schädlichen Stressoren zu lange ausgesetzt ist, wird ein Punkt erreicht, an dem es ihm nicht länger möglich ist, die Resistenz aufrechtzuerhalten. Dann tritt er in die dritte Phase des allgemeinen Adaptionssyndroms, in die Phase der Erschöpfung. Der Hypophysenvorderlappen und die Nebennieren können die erhöhte Hormonausschüttung nicht länger aufrechterhalten. Das bedeutet, dass der Organismus sich nicht mehr an den Dauerstress anpassen kann. Viele Symptome aus der Phase der Alarmreaktion treten in dieser Phase wieder auf. Wirkt der Stressor weiter auf den Organismus ein, so können laut Zimbardo (19956) „die Zerstörung von Körpergewebe und, im Extremfall, der Tod als Folge eintreten“ (S. 580).
Das Konzept des allgemeinen Adaptionssyndroms hat sich bei der Erklärung von Störungen als nützlich erwiesen, die den Ärzten zuvor verwirrend vorkamen. Innerhalb dieses Rahmens können sie als Ergebnis physiologischer Prozesse betrachtet werden, die mit den andauernden Versuchen des Körpers, mit einem als gefährlich wahrgenommenen Stressor zurechtzukommen, zusammenhängen. Als Mediziner hat sich Selyes Forschung auf physische Stressreaktionen bei Versuchstieren, beispielsweise Ratten im Labor konzentriert (vgl. Selye 1957). Insofern hat seine Theorie wenig über die Bedeutung psychischer Aspekte von Stress beim Menschen zu sagen, insbesondere bezüglich der kognitive Bewertung einer Situation (s.3.3.1), die darüber bestimmt, welche physiologischen Reaktionen auftreten.
Stress und Krankheit In Selyes Theorie wird betont, dass die Stressreaktion als Reaktion auf verschiedene Stressoren, Krankheit eingeschlossen, auftritt. Die Theorie zeigt auch, wie eine lang andauernde Stressreaktion selbst zu Krankheit führen kann (vgl. Zimbardo 19956, S. 580). Beispielsweise hängt Bluthochdruck, eine Krankheit die das Risiko für Herzanfälle und vorzeitigen Tod erhöht mit Stress zusammen. Auch Herz-Kreislauferkrankungen hängen mit der physiologischen Stressreaktion zusammen, da das Herz bei „all diesen Prozessen ständig belastet ist“ (Groetschel 1984, S. 38). Seyle (1957) bezeichnet stressbedingte Krankheiten als „Anpassungskrankheiten“ (diseases of adaptation) (S. 150). Dazu zählt er zum Beispiel „Bluthochdruck, Krankheiten des Herzens und der Blutgefäße, Nierenkrankheiten, [...], rheumatische und rheumatoide Gelenkentzündungen, Entzündungskrankheiten der Haut und der Augen, Infektionskrankheiten, allergische und Überempfindlichkeitskrankheiten, nervöse und geistige Leiden, Sexualstörungen, Krankheiten des Verdauungsapparates, Stoffwechselkrankheiten, Krebs und Krankheiten der Widerstandsfähigkeit im allgemeinen“ (ebd., S. 152). Viele dieser Krankheiten habe ich bereits unter dem Stichwort Zivilisationskrankheiten erwähnt, so dass sich vor dem Hintergrund eines steigenden Stresspegels, auch die Zunahme der stressbedingten Krankheiten erklären lässt.
Nach Zimbardo (19956) können Stressoren auf drei Wegen als kausale Faktoren bei der Entstehung von Krankheiten wirksam werden:
- Erstens können lang andauernder schwerer Stress oder chronische Erregung, die aus der Wahrnehmung von Bedrohung entstehen, mit der Zeit zu Ausfällen der physiologischen Funktionen und zu Krankheit führen. Wie bereits erwähnt, ist die „automatische“ körperliche Reaktion für die meisten psychischen Stressoren unangemessen. Sie tritt dennoch auf, und es spielt keine Rolle, ob Menschen sich ängstlich, bedroht oder unter Druck fühlen. Es ist die persönliche Bewertung der Situation, auf die es ankommt, nicht deren objektive Realität. Psychosomatische Störungen sind körperliche Krankheiten, von denen angenommen wird, dass Emotionen und Denkprozesse eine zentrale Rolle spielen. Sie werden oft als Anpassungsstörungen bezeichnet, weil ihre Ursprünge im Versuch des Organismus liegen, sich an Stressoren anzupassen. Magengeschwüre oder hoher Blutdruck sind klassische Beispiele für adaptionsbedingte Krankheiten, wenn auch nicht alle Fälle durch Stress zustande kommen. Viele Krankheiten können ihre Ursachen in physiologischen oder psychischen Faktoren oder einer Kombination von beiden haben. Damit ein chronischer psychischer Stressor zu einer körperlichen Krankheit führt, muss eine Person hinsichtlich eines bestimmten Teils des körperlichen Systems eine konstitutionelle Verwundbarkeit (Vulnerabilität), und einen nicht effektiven Stil zur Bewältigung der Stresssituation aufweisen. Entweder nimmt die Person die chronische emotionale Erregung gar nicht bewusst wahr, oder sie glaubt, es gäbe keine bessere Art, mit der schwierigen Situation umzugehen (vgl. Zimbardo 19956, S. 581).
- Zweitens können Stressoren krank machen, wenn die komplexen physiologischen Mechanismen des allgemeinen Adaptionssyndroms nicht angemessen funktionieren und selbst krankheitsverursachend wirken. Abwehrprozesse, die normalerweise der Wiederherstellung des Normalzustandes dienen, werden in extremer oder unnötiger Weise eingesetzt. Der Körper zeigt eine Überreaktion oder eine unangemessene Antwort auf Stressoren, die seine Stabilität bedrohen können. Da der Körper nicht immer weiß, welche „Angreifer“ potentiell schädlich sind, begeht er in manchen Fällen einen Irrtum und reagiert dann aversiv auf Reize, die in Wirklichkeit gutartig sind. Allergische Reaktionen sind das deutlichste Beispiel dafür: Blütenstaub hat keine direkten schädlichen Auswirkungen auf den Körper und dennoch bringt Blütenstaub bei einigen Personen eine allergische Reaktion hervor. Diese besteht aus einer Entzündung der Nasenschleimhäute und einem allgemeinen Adaptionssyndrom, das den ganzen Körper in Mitleidenschaft zieht. Allergien werden als Anpassungskrankheiten bezeichnet, da der Körper den Stressor als Gefahrenquelle bewertet und eine unnötige Stressreaktion hervorbringt (vgl. Zimbardo 19956, S. 581).
- Drittens kann der kontinuierliche Prozess der Adaption, die dadurch bedingte Erschöpfung des Energievorrates des Organismus und die kumulative Schädigung der Organsysteme zur Erkrankung führen. Jede Person verfügt über begrenzte Energievorräte, die sie nutzen kann, um mit Stressoren umzugehen. Sind sie erschöpft, so kann sie die Stressoren nicht länger bewältigen und wird krank. Dies ist der Grund dafür, dass alle Organismen im Laufe des allgemeinen Adaptionssyndroms schließlich die Phase der Erschöpfung erreichen, wenn der Stressor nicht entfernt wird. Selbst wenn eine Person ein aktives, gesundheitsbewusstes Leben führt, so wird doch bei der erfolgreichen Bewältigung aller spezifischer Stressoren, die auftreten, einige Energie für diese Anpassungsleistung verbraucht. Selye behauptet das Richtige zu tun, bedeute, die eigene Adaptionsenergie gut einzuteilen, statt sie durch Reaktionen auf zivilisationsbedingte „falsche Alarme“, die eine Person besser ignorieren sollte, zu verschwenden (vgl. Selye 1957, S. 317).
Psychische Stressreaktionen
Die physiologischen Stressreaktionen einer Person laufen automatisch und vorhersagbar ab. Es sind reflexhafte Reaktionen, die im Moment einer Notfallsituation (s.Bsp.2.) nicht bewusst kontrolliert werden können. Bei den psychischen Stressreaktionen ist das anders: „Sie sind erlernt und in hohem Maße von unseren Wahrnehmungen und Interpretationen der Welt und unserer Fähigkeiten, mit ihr umzugehen, abhängig“ und enthalten „Aspekte des Verhaltens, der Emotion und der Kognition“ (Zimbardo 19956; S. 581).
Verhaltensmuster Das Verhalten einer Person unter Stress hängt unter anderem davon ab, wie stark der empfundene Stress ist.
- Leichter Stress aktiviert und intensiviert biologisch signifikante Verhaltensweisen wie Essen, Aggression und Sexualität. Er erhöht die Wachsamkeit eines Organismus, Energien werden konzentriert, und die Leistung kann gesteigert werden. Positive Verhaltensanpassungen können durch eine Verbesserung der Informationslage erreicht werden, durch Wachsamkeit gegenüber Quellen der Bedrohung, durch Suche nach Schutz und Unterstützung von anderen und durch Erlernen besserer Einstellungen und Bewältigungsmechanismen (vgl. Zimbardo 19956, S. 582).
- Andauernder unbewältigter Stress, der von mehreren Stressoren herrührt, kann sich ansammeln und im Laufe der Zeit zunehmend belastend wirken. Er verursacht laut Zimbardo (19956) „fehlangepasste Verhaltensweisen wie erhöhte Reizbarkeit, schlechte Konzentration, beeinträchtigte Produktivität und chronische Ungeduld“ (S. 582). Tritt jedoch jeder dieser Stressoren nur vereinzelt auf, und wird gleichzeitig als kontrollierbar wahrgenommen, verursacht er „keine Probleme“ (Zimbardo 19956, S. 582).
- Mäßiger Stress führt typischerweise zum Abbruch von Verhaltensweisen, besonders solchen, die geschulte Koordination erfordern. Für einige Personen besteht die typische Reaktion auf ein mittleres Stressniveau darin, dass sie zuviel essen, besonders nach einer frustrierenden Erfahrung. Mäßiger Stress kann auch wiederholte stereotype Handlungen hervorrufen, wie Herumlaufen im Kreis oder Vor- und Zurückschaukeln. Die Wirkungen dieser wiederholten Reaktionen sind ambivalent. Sie sind „adaptiv, denn sie senken das hohe Niveau der Stimulation durch den Stressor und verringern die Sensibilität der Person gegenüber der Umwelt“ (Zimbardo 19956, S. 582). Gleichzeitig sind sie „nicht adaptiv, denn sie sind rigide und unflexibel und bestehen selbst dann weiter, wenn die Umweltgegebenheiten andere Reaktionen erfordern würden“ (ebd.).
- Schwerer Stress hemmt und unterdrückt Verhalten und kann zur völligen Unbeweglichkeit führen. Die Unbeweglichkeit unter schwerem Stress sei eine Abwehrreaktion und stehe für „einen Versuch des Organismus, die erschöpfenden Stresseffekte zu reduzieren oder auszuschalten ... eine Form der Selbsttherapie“ (zitiert nach Zimbardo 19956, S. 583).
Emotionale Aspekte Die Stressreaktion beinhaltet eine ganze Reihe unterschiedlicher emotionaler Antworten. Bewertet eine Person einen Stressor als spannende Herausforderung, die sie bewältigen kann, ist es möglich, dass sie mit einem positiven Gefühl, „einer Art freudiger Erregung“ (ebd.) reagiert. Weit üblicher sind die negativen emotionalen Reaktionen der Reizbarkeit, Wut, Ängstlichkeit, Mutlosigkeit und Depression. Der meiste Stress wird akut als unangenehm empfunden und bringt negative Emotionen und Anstrengungen, das Unbehagen auf direkte oder indirekte Weise zu reduzieren, hervor. Stresserzeugende Veränderungen der Lebensbedingungen, die mit dem Verlust oder der Trennung von Freunden und wichtigen Bezugspersonen zusammenhängen, sind häufig im Vorfeld der Depression zu finden. Allein zurückzubleiben, wenn Personen, die wichtig sind, sterben oder weggehen, scheint mit größerer Wahrscheinlichkeit in eine Depression zu münden, als eine ähnliche Trennung, die durch eigene Handlungen zustande kommt (vgl. Zimbardo 19956, S. 582). Die Erfahrung eines ganzen Bündels stressreicher Ereignisse ist ein weiterer Prädikator für eine depressive Reaktion.
Darüber hinaus können Vergewaltigungsopfer, Opfer eines sexuellen Missbrauchs, Überlebende von Flugzeugabstürzen, Naturkatastrophen, Unfälle, Kriegsveteranen und andere, die äußerst traumatische Ereignisse erlebt haben, emotional mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (Stresssyndrom) reagieren. Typisch für diese Reaktion ist das ungewollte Wiedererleben des traumatischen Ereignisses, besonders des ursprünglichen Gefühls von Schock, Furcht und Schrecken in Träumen oder Rückblenden. Zusätzlich dazu erleben die Überlebenden eine emotionale Abstumpfung gegenüber alltäglichen Ereignissen, was mit Gefühlen der Entfremdung von anderen Menschen zusammenhängt. Schließlich kann der emotionale Schmerz dieser Reaktion zu einer Verschlimmerung verschiedener Symptome führen, wie etwa zu Schlafstörungen, Schuldgefühlen, überlebt zu haben, Konzentrationsstörungen und einer gesteigerten Schreckreaktion. Die emotionalen Reaktionen des posttraumatischen Stresssyndroms können in akuter Form direkt nach einer Katastrophe auftreten und nach einer Phase von mehreren Monaten abklingen. Das Syndrom kann auch bestehen bleiben und chronisch werden. Dann wird es als „residuales Stresssyndrom“ (Zimbardo 19956, S. 583) bezeichnet. In den klinischen Einrichtungen der Vereinigten Staaten werden immer wieder Veteranen des zweiten Weltkrieges und des Koreakrieges entdeckt, die ein residuales oder ein verzögertes posttraumatisches Stresssyndrom aufweisen (vgl. Zimbardo 19956, S. 583). Aus aktuellem Anlass, seit den Terroranschlägen am 11. September 2001, taucht das Kürzel für die posttraumatische Belastungsstörung PTBS auch immer wieder in den Medien auf.
Kognitive Auswirkungen Ist ein Stressor einmal als bedrohlich für das eigene Wohlbefinden oder für das Selbstwertgefühl beurteilt worden, so kann eine Reihe verschiedener intellektueller Funktionen nachteilig beeinflusst werden. Die Verringerung der kognitiven Effizienz und die Störungen des flexiblen Denkens sind im Allgemeinen um so gravierender, je größer der Stress ist. Kognitive Stressreaktionen umfassen eine Einengung der Aufmerksamkeit, Rigidität des Denkens sowie Störungen des Urteilsvermögens, des Problemlösens und des Erinnerungsvermögens (vgl. Zimbardo 19965, S. 585).
- Aufmerksamkeit ist eine Ressource, die Grenzen hat. In einem Experiment wurde herausgefunden, dass selbst „die Durchführung einer einfachen [...] Aufgabe behindert [ist], wenn man etwas anderes im Kopf hat’“ (Zimbardo 19956, S. 229; Anpassung: E. K.). Die Konzentration auf die bedrohlichen Aspekte einer Situation und auf die eigene Erregung senkt deshalb den Anteil an Aufmerksamkeit, der zur wirksamen Bewältigung der anstehenden Aufgaben zur Verfügung steht.
- Auch das Gedächtnis wird beeinträchtigt, weil das Kurzzeitgedächtnis durch den Teil an Aufmerksamkeit begrenzt wird, der neuem Input zukommt. Daneben hängt das Abrufen relevanter Erinnerungen aus der Vergangenheit von der reibungslosen Bearbeitung der angemessenen Hinweisreize ab.
- In ähnlicher Weise kann Stress Prozesse des Problemlösens, der Urteilsbildung und der Entscheidungsfindung stören: die Wahrnehmung von Alternativen wird eingeschränkt, und statt kreativer Reaktionen tritt stereotypes, rigides Denken auf.
- Schließlich kann ein chronisches Gefühl der Bedrohung auch auf ganz normale Situationen übertragen werden. Beispielsweise kann eine Person mit Prüfungsangst, diese Angst auch auf Diskussionen in einer Bildungsveranstaltung übertragen (vgl. Zimbardo 19956, S. 584).
Stress - ein aktuelles Thema
Wie schon erwähnt findet der Begriff Stress 1950 Eingang in die Medizin und die Psychologie. Vor über 50 Jahren kannten dieses Wort allenfalls Physiker. Mittlerweile hat Stress nicht nur sprachlich den Alltag durchdrungen. Viele Wissenschaftler sehen in ihm ein zentrales Problem der Leistungsgesellschaft. Auch Arbeitgeber, Gewerkschaftler und Politiker attestieren ihm Wachstumsraten, die sie bedenklich finden. Die WHO hat Stress zu „einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts“ (Possemeyer 2002, S. 148) erklärt.
Das Phänomen Stress wird gegenwärtig sowohl im Alltag als auch in der Forschung mit sämtlichen Lebensbereichen in Zusammenhang gebracht: z.B. Stress im persönlichen Bereich, in der Schule, in der Freizeit oder am Arbeitsplatz. Wissenschaftler verschiedener Forschungsrichtungen machen Stress zum Gegenstand ihrer Untersuchungen. Zum Beispiel beschäftigt sich Hurrelmann (1990) mit Familienstress, Schulstress und Freizeitstress. In jüngster Zeit erforschen Wissenschaftler, wie zum Beispiel Schneewind (19992) oder Fthenakis et al. (1999) Stress im familiären Bereich. Stress wird häufig als Krankheit der Gegenwart bezeichnet. Fast jede Person kennt aus Erfahrung Situationen, in denen sie sich beruflich oder privat überfordert und überlastet fühlt, in denen sie gereizt, hektisch oder nervös ist. Gefühle des Ärgers, der Wut, der Ohnmacht oder der Niedergeschlagenheit sind deutliche Zeichen für Stress.
Das Gleichgewicht zwischen An- und Entspannung, Aktivität und Ruhe, Stress und Erholung ist demzufolge gegenwärtig allzu oft gestört und entspricht nicht mehr dem naturgegebenen Harmonieprinzip. Stress gehört zum Leben, durch Stress kann wie schon erwähnt sogar die Leistungsfähigkeit erhöht werden. Zu viel Stress kann aber gleichzeitig krank machen. Alarmierende Statistiken zeigen, dass die ursprünglichen biologischen Abwehrkräfte oft nicht mehr ausreichen oder manchmal ungeeignet sind, den Organismus vor Dauerschäden zu bewahren. Wie bereits erwähnt waren 1995 über zwei Drittel der Krankheiten stressbedingt. Ich gehe davon aus, dass diese Zahl nicht gesunken ist. Gegenwärtig wirkt sich Stress besonders negativ aus, da soziale Normen das körperliche Ausagieren der physiologischen Stressreaktion nur selten zulassen. Es ist für eine Person unangebracht zu fliehen, oder zu kämpfen, wenn sie beispielsweise eine öffentliche Rede halten soll. Zusätzlich ist die Zahl der stressauslösenden Reize enorm gestiegen, so dass viele Personen keine Zeit finden, sich zu regenerieren. Schließlich lösen innere Einstellungen (z.B. Sorgen, negative Erwartungen, Ängste) Stress aus (Wagner-Link 1987, S. 8f.). Eine repräsentative Umfrage des Emnid Institutes im Januar 2003, mit der Frage: „Wovor haben sie am meisten Angst?“, zeigt aktuelle Ängste der deutschen Bevölkerung. Nach dieser Angst-Skala rangiert die Angst vor Krieg und Terroranschlägen (mit 38%) an erster Stelle, gefolgt von der Angst vor Krankheiten (26%), der Angst vor Arbeitslosigkeit (14%), der Angst vor Gewalt und Kriminalität (10%) und der Angst vor finanzieller Not und Schulden (9%) (vgl. Angst-Skala 2003). Demnach betrifft beispielsweise die Angst um einen Arbeitsplatz einen großen Teil der deutschen Bevölkerung. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass die Arbeitslosenquote in einem Zeitraum von nur 3 1/2 Jahren konstant gestiegen ist: von ca. 10% zu Beginn des Jahres 2000 (vgl. Böeser; Schörner; Wolters 20002, S. 17) auf 10,4% Ende Juli 2003 (Pressestelle des Arbeitsamtes Augsburg).
Dauerstress ist, wie bereits dargestellt, nicht nur Mitverursacher zahlreicher Erkrankungen, sondern kann sich auch indirekt negativ auswirken. So steigt beispielsweise das Unfallrisiko aufgrund der mangelnden Konzentrationsfähigkeit in einer Belastungssituation. Außerdem nimmt die Leistungsfähigkeit ab und die von Stress betroffene Person fühlt sich häufig unwohl bzw. ungesund. In der heutigen Zeit besteht weniger eine körperliche Überlastungssituation als vielmehr Überlastungssituationen im geistig-seelischen Bereich. Die meisten Personen leiden unter massiver Reizüberflutung, der Hektik des Alltags bei gleichzeitig geringerem sozialen Kontakt (die Zeit für Gespräche und andere Unternehmungen in der Familie ist knapp, die Familie sitzt viel vor dem Fernseher, der Vater ist selten zuhause, Kinder leiden unter Schulstress und es besteht ein innerer Zwang zu vielen Hobbytätigkeiten) (vgl. Hurrelmann 1990, Schneewind 19992, Fthenakis et al. 1999). Körperlich besteht ein chronischer Unterforderungszustand, im Durchschnitt besteht Bewegungsmangel. Um dies zu kompensieren, versuchen sich viele Personen z.B. durch Fernsehen zu entspannen, was oftmals gerade zur Anspannung führt (z.B. innere und damit äußere Anspannung bei einem Fußballspiel). Personen in Belastungssituationen verhalten häufig gesundheitsschädigend: sie rauchen mehr, ernähren sich ungesund oder trinken mehr Alkohol, um sich eine Entspannungssituation zu verschaffen. Gerade diese Bewältigungsstrategien tragen dann noch vermehrt zum eigenen Stress bei. Die Situation schaukelt sich auf, viele Personen versuchen diesen Teufelskreis mit Medikamenten zu kompensieren (vgl. Olschewsky 1995). Damit verlässt sich der Betroffene auf Hilfe von außen, so dass die Selbstheilungskräfte (z. B. in Form von Entspannung) die jeder Person naturgemäß zueigen sind, außer acht gelassen werden. In der Bundesrepublik Deutschland ist es weit verbreitet, anstelle von den in den Alltag integrierten Erholungsphasen ein Medikament einzunehmen, das schlaffördernd wirkt, und morgens ein Mittel einzunehmen, das die Wirkung des Schlafmittels vertreibt und eine Person besser aufwachen lässt (z.B. Kaffee). Die betroffene Person scheint sich dieser Abläufe meist nicht bewusst zu sein.
Die in Deutschland weitverbreitete „Kultur des Kaffeetrinkens“ ist ein Beleg dafür, dass viele nicht wissen, dass auch die Ernährungsweise für den Organismus einen Stressor (biochemischer Art) darstellen kann, und insofern auf Dauer schädlich wirkt. Da dieser Aspekt in den mir vorliegenden Stresstheorien nicht explizit erwähnt wird, und da ich ihn für sehr bedeutend hinsichtlich des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens halte, soll er an dieser Stelle Eingang finden. Beispielsweise entsteht durch den Genuss von Kaffee im Körper Gerbsäure. Diese Säure muss der Körper so schnell wie möglich neutralisieren, damit sie nicht seine Zellen, Organe und Drüsen verätzen und in ihrer Funktion beeinträchtigen. Für diesen Neutralisierungsvorgang benötigt er Mineralstoffe. Diese bezieht er entweder aus der zugeführten Nahrung oder, was aufgrund einer unausgewogenen Ernährung gegenwärtig bei vielen Personen der Fall ist, aus den körpereigenen Depots, wie zum Beispiel aus den Zähnen, den Knochen, den Nägeln und der Haut. Die neutralisierten Säuren werden als sogenannten Schlacken im Körper abgelagert (vgl. Jentschura; Lohkämper 200310, S. 48f.). Die gesundheitlichen Folgen sind gravierend. Zum einen wird mit dem Entzug der körpereigenen Mineralstoffe zum Beispiel die zunehmende Anzahl von Osteoporoseerkrankungen erklärt (vgl. Corazza et al. 2001, S. 666ff.), zum anderen erklärt die Ablagerung der neutralisierten Säuren beispielsweise die hohe Anzahl (1,8 Millionen) der an Gicht erkrankten Personen (vgl. Jentschura; Lohkämper 200310, S. 30). In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass durch Stress, Angst und Ärger Salzsäure entsteht, die genauso neutralisiert werden muss. Interessant ist außerdem die Tatsache, dass unter körperlicher Anstrengung Milchsäure entsteht, was bedeutet, dass Sport den Körper in diesem Sinne auch stressen kann. Vor allem, wenn sich eine Person als Ausgleich zu einem anstrengenden Tag sportlich betätigt, und sich dabei im Sinne eines leistungsorientierten Denkens (z.B. heute laufe ich schneller) oder im Sinne eines konkurrenzorientierten Denkens (meine sportliche Leistung soll besser als die der anderen sein) unter Druck setzt. Die „[k]örperliche Aktivität unter der Maxime höher, schneller, weiter’ hat keinerlei Entspannungswert, sondern ist Stress mit anderen Mitteln“ (Schaufler 2000, S. 130; Anpassung: E. K.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Phänomen Stress ambivalent ist: der leistungsbezogene Alltag erfordert gegenwärtig nahezu die gesamte Energie einer Person. Gleichzeitig kann eine Person ohne Stress nicht leben. So wie sie ohne körperliche Anstrengung weder Muskeln noch Ausdauer entwickelt, braucht eine Person auch psychische Belastungen im Sinne von Herausforderungen, um ihr Verhalten einer sich ständig wandelnden Umwelt anzupassen und Neues zu erlernen. Stress spielt zwar eine Rolle in der Entstehung, Erhaltung und Verschlechterung von Erkrankungen. Die Überwindung und Bewältigung von Stress führt aber zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, zur Erhöhung der Widerstandskraft und stellt damit eine Prophylaxe gegenüber Krankheiten dar. Krankheit kann zwar selbst ein Stressor sein, da Bedürfnisse nicht befriedigt werden können und Handlungsmöglichkeiten und -fähigkeiten eingeschränkt sind. Aber Krankheit kann auch dazu führen, dass der Kranke sich ein für seine Person und seine Umwelt adäquateres Verhalten aneignet und damit weniger in Stress kommt, was häufig bei den Herzinfarktpatienten der Fall ist (vgl. Scheuch 1989, S. 91). Es scheint von großer Bedeutung zu sein, mit der eigenen Energie optimal haushalten zu können, um Überforderungen zu vermeiden. Damit Spannungszustände erfolgreich bewältigt werden und Stress nicht zum krankmachendem Distress wird, ist ein umfassendes Stressmanagement erforderlich. Dies soll Thema des nächsten Kapitels sein.
Stressmanagement
In diesem Kapitel geht es um die Frage, wie Personen mit Stress oder belastenden Ereignissen umgehen bzw. wie sie Stress managen oder bewältigen. Sowohl im englischen als auch im deutschen Sprachgebrauch wird mit dem Begriff Bewältigung bzw. Coping in der Regel „die erfolgreiche Auseinandersetzung mit einer Belastung“ (Brüderl 1988, S. 14) verstanden. Lazarus und Folkman (1984) definieren Bewältigung „als sich ständig verändernde, kognitive und verhaltensmäßige Bemühungen einer Person, die darauf gerichtet sind, sich mit spezifischen externen und/oder internen Anforderungen auseinanderzusetzen, die ihre adaptiven Ressourcen stark beanspruchen oder übersteigen“ (ebd., S. 15). Im Rahmen der Stress- und Bewältigungsforschung werden erfolgreiche oder geeignete Bewältigungsstrategien als gesundheitliche Ressourcen betrachtet, da sie eine verbesserte Anpassung an Lebensumstände bedingen oder eine Veränderung von aversiven Situationen fördern.

Nach Cohen und Lazarus ermöglichen angemessene Bewältigungsstrategien, schädigende situationale Bedingungen zu reduzieren, ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten, das emotionale Gleichgewicht zu sichern und befriedigende Beziehungen aufzubauen. Darüber hinaus beeinflussen sie das Wohlbefinden und den Gesundheitszustand (vgl. Bengel, Strittmatter, Willmann 20027, S. 61). Tendenziell werden aktive, problemlöseorientierte Copingstrategien als angemessene Verhaltensweisen betrachtet, die der Verarbeitung von Stresssituationen förderlich sind. Weniger gesunde Personen resignieren eher in Problemsituationen, finden sich mit unbeeinflussbaren Stressoren weniger gut ab und zeigen eine höhere Tendenz zu Fluchtverhalten. Die wichtigste Voraussetzung effektiver Stressbewältigung scheint jedoch der flexible Einsatz verschiedener Verhaltensmuster zu sein (vgl. ebd.).
Problemzentrierte und emotionszentrierte Bewältigung
Bewältigungsstrategien können zwei Typen zugeordnet werden, abhängig davon, ob das Ziel darin besteht, das Problem zu lösen (problemzentriert) oder das durch das Problem verursachte Unbehagen zu verringern (emotionszentriert). Der Typ der problemzentrierten Bewältigung beinhaltet alle Strategien des direkten Umgangs mit dem Stressor, sei es durch offenes Handeln oder durch kognitive Aktivitäten die der Problemlösung dienen. Bei all diesen Strategien konzentriert sich eine Person auf das Problem, das zu lösen ist und auf die Bedingungen, die den Stress verursacht haben. Beim Typ der emotionszentrierten Bewältigung verändert eine Person, die Gefühle und Gedanken, die mit der stressreichen Situation zusammenhängen. Diese Bewältigungsstrategie wird auch als „Emotionsregulation“ (Zimbardo 19956, S. 588) bezeichnet. Verschiedene Subkategorien dieser beiden grundlegenden Ansätze zeigt Tabelle 2, die von Lazarus Mitte der 1970er erstellt wird und bis in die Gegenwart Gültigkeit besitzt (vgl. Zimbardo 19956, S. 587f.).
Problemzentrierte Bewältigungsstrategien Veränderung des Stressors oder der Beziehung zu ihm durch direkte Handlungen und/oder problemlösende Aktivitäten
- Kämpfen (Zerstören, Entfernen, Verringern der Bedrohung)
- Flüchten (sich von der Bedrohung distanzieren)
- Suche nach Alternativen zu Kampf oder Flucht (verhandeln, Kompromisse schließen)
- Weiterem Stress vorbeugen (zur Steigerung der eigenen Resistenz etwas unternehmen oder die Intensität des antizipierten Stress herabsetzen)
Emotionszentrierte Bewältigungsstrategien
- Veränderung des Selbst durch Aktivitäten, die zu einem besseren Befinden führen, den Stressor jedoch nicht beeinflussen
- Aktivitäten, die an den körperlichen Bedingungen ansetzen (Drogeneinnahme, Entspannung, Feedback)
- Aktivitäten, die an den kognitiven Bedingungen ansetzen (geplante Ablenkung, Phantasien, Gedanken über die eigene Person)
- Unbewusste Prozesse, die die Realität verzerren und zu innerpsychischem Stress führen.
Tab.2.: Taxonomie der Bewältigungsstrategien nach Lazarus (1975) (vgl. Zimbardo 19956, S. 588; Hervorhebungen: E. K.)
Entspannung und damit auch Entspannungsverfahren können dieser Taxonomie zufolge einerseits dem Typ der emotionszentrierten Bewältigung zugeordnet werden. Sie stellen eine Aktivität dar, die zunächst an den körperlichen Bedingungen ansetzt, dann aber ihre Wirkungen auch auf psychischer Ebene zeigen. Andererseits fällt das Erlernen eines Entspannungsverfahrens meiner Ansicht nach ebenso in die Kategorie der problemzentrierten Bewältigungsstrategien. „Weiterem Stress vorbeugen“, indem eine Person etwas unternimmt (ein Entspannungsverfahren erlernt), um die eigene Resistenz zu steigern bzw. die Intensität des antizipierten (gedanklich vorweggenommenen) Stresses herabzusetzen, kann, obwohl es in der Taxonomie von Lazarus nicht explizit aufgelistet wird, durch systematisches Entspannen geschehen.
Grundsätzlich kann eine Person lernen, mit Stress besser umzugehen, indem sie erstens die physiologischen Reaktionen, die ihre Gesundheit bedrohen verändert (durch Entspannung) und zweitens ihre kognitiven Strategien verändert. Bevor ich mich dem Schwerpunkt dieser Diplomarbeit, dem Gegenstand der Entspannung und der Entspannungsverfahren zuwende, stelle ich die Möglichkeit vor, Stress zu bewältigen, indem eine Person ihre kognitiven Strategien verändert. Anschließend zeige ich auf, wie die soziale Unterstützung die Stressbewältigung einer Person beeinflusst. Diese beiden Aspekte sind meiner Meinung nach für ein umfassendes Stressmanagement ebenso bedeutend, wie sich zu entspannen bzw. ein Entspannungsverfahren zu erlernen und anzuwenden.
Veränderung kognitiver Strategien
Eine wirksame Methode, mit Stress angemessen umzugehen, besteht darin, die Bewertung der Stressoren und die Kognitionen hinsichtlich des Umgangs mit ihnen zu verändern. Über eine bestimmte Situation, die eigene Rolle und die kausalen Attributionen zur Erklärung unerwünschter Ereignisse nachzudenken kann den Umgang mit Stress erleichtern. Die enge Verbindung der kognitiven Bewertung mit dem Grad der Erregung des autonomen Nervensystems kann z.B. in Untersuchungen gezeigt werden, in denen die Bewertung systematisch variiert wird. Dadurch wurde beispielsweise festgestellt, dass Personen, denen beunruhigende Filmaufnahmen der Beschneidungsrituale eines Naturvolkes gezeigt werden, physiologisch weniger erregt sind, wenn der Film von einer Stimme begleitet wird, die entweder die Gefahren leugnet oder sie auf intellektuelle distanzierte Weise diskutiert. Die Veränderung des Denkens über bestimmte Stressoren, deren neue Etikettierung oder deren Vorstellung im Rahmen eines weniger bedrohlichen Kontexts, sind demnach Formen kognitiver Neubewertung, die Stress reduzieren können (vgl. Zimbardo 19956, S. 589f.). Die absichtliche Veränderung dessen, was sich eine Person selbst über Stress sagt, ist eine weitere Möglichkeit das Stressmanagement zu verbessern. Solche Botschaften können sowohl zur kognitiven Neustrukturierung als auch zur effektiveren Bewältigung führen. Beispielsweise sagen sich depressive oder unsichere Menschen oft, sie taugten nichts, sie würden schlecht abschneiden, und, wenn etwas gut geht, sei das ein glücklicher Zufall gewesen (vgl. Zimbardo 19956, S. 590). Solche negativen Gedanken können zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung führen: das, woran eine Person glaubt, das es eintrifft, also das was erwartet wird, trifft schließlich ein. In diesem Zusammenhang stelle ich „Die Geschichte mit dem Hammer“ von Paul Watzlawick (200122) als Beispiel für solch ein dysfunktionales Gedankenschemata dar.
Bsp.3.: Die Geschichte mit dem Hammer nach Watzlawick (200122) Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gedanken abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht`s mir wirklich. –Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er „Guten Tag“ sagen kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!“ (S. 37f.).
Dieses Beispiel zeigt in überspitzter Form, „wie sich eine Person selbst im Weg stehen kann“. Der Mann in diesem Beispiel hat daran geglaubt, sich den Hammer nicht ausleihen zu können, und hat es bestimmt geschafft, ohne ihn wieder nach Hause zu gehen. Durch seine negativen Gedanken, setzt er sich selbst unter Druck und erzeugt damit Stress: erstens bei ihm selber, und zweitens wahrscheinlich auch bei seinem Nachbarn, der nichtsahnend die Tür öffnet und dann angebrüllt wird. Meichenbaum hat Ende der 1970er Jahre folgenden aus drei Phasen bestehenden Prozess vorgeschlagen, mittels dessen dieser Zirkel der sich selbst erfüllenden Prophezeiung durchbrochen werden kann (vgl. Zimbardo 19956, S. 590):
- In einer ersten Phase arbeiten die Personen an der Entwicklung einer bewussteren Wahrnehmung ihres tatsächlichen Verhaltens, seiner Auslöser und seiner Ergebnisse. Eine geeignete Methode dafür, ist die tägliche Aufzeichnung von Notizen, in denen sie ihre Probleme nach Ursache und Wirkung unterteilen. Damit wird das Gefühl der Kontrolle erhöht.
- In einer zweiten Phase werden neue Verhaltensweisen, die im Gegensatz zu den fehlangepassten Verhaltensweisen stehen, eingeübt. Beispielsweise kann eine Person jemanden anlächeln oder jemandem ein Kompliment machen.
- In einer dritten Phase schätzen die betroffenen Personen die Konsequenzen der neuen Verhaltensweisen ein (vgl. ebd., S. 591).
Grundsätzlich werden im Rahmen dieses Ansatzes laut Zimbardo (19956): „Reaktionen und selbstbezogene Behauptungen angeregt [...], die mit den alten Kognitionen unvereinbar sind. Die Menschen bemerken, daß sie sich verändern und schreiben sich selbst die Verantwortung dafür zu, was weitere Erfolge fördert“ (ebd., S. 591; Auslassung: E. K.).
Soziale Unterstützung
Soziale Unterstützung bezieht sich nach Zimbardo (19956) „auf die Ressourcen, die von anderen Personen bereitgestellt werden. [...] Sie können materielle Hilfe, soziale und emotionale Unterstützung (Liebe, Fürsorge, Wertschätzung, Sympathie, Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe) und Hilfe durch Informationen (Ratschläge, persönliches Feedback) einschließen“ (S. 591; Auslassung: E. K.). Es gibt Belege, dass eine Person durch das Vorhandensein sozialer Netzwerke Stress besser bewältigen kann: „Wenn andere Menschen da sind, an die man sich wenden kann, ist es leichter möglich, Stressoren bei der Arbeit, Arbeitslosigkeit, das Scheitern der Ehe, schwere Krankheit und andere Katastrophen sowie alltägliche Probleme des Lebens zu bewältigen“ (Zimbardo 19956, S. 592).

Dagegen beschäftigen sich Menschen ohne soziale Bindungen mehr mit fehlangepassten Arten des Denkens und Verhaltens als diejenigen, die ihre Anliegen mit anderen Menschen teilen. Die Abnahme der sozialen Unterstützung im familiären Umfeld und bei der Arbeit steht im Zusammenhang mit der Zunahme psychischer Störungen (vgl. ebd.). Am leichtesten werden also solche Personen durch Stress angegriffen, denen ein soziales Netzwerk fehlt. Der Aufbau von und die Teilnahme an Gruppen, die positive soziale Unterstützung geben können, wirkt demnach gesundheitsfördernd. In diesem Sinne trägt schon allein die Teilnahme an einem Entspannungskurs dazu bei, dass eine Person Stress besser managen kann. Die Wirkungen der Entspannungsverfahren auf das Stressmanagement einer Person sind Gegenstand des nächsten Abschnittes.
Veränderung der psychophysiologischen Reaktionen durch Entspannung
Wenn eine Person eine Situation als schwierig oder bedrohlich einschätzt, wenn sie Angst empfindet, dann führt dies wie bereits dargestellt sowohl zu körperlichen als auch zu psychischen Stressreaktionen. Viele dieser Reaktionen können durch eine Reihe unterschiedlicher Entspannungsverfahren kontrolliert werden (vgl. Zimbardo 19956, S. 589). In diesem Kapitel kläre ich zunächst den Begriff der Entspannung und der Entspannungsverfahren, um dann physiologische und psychologische Kennzeichen der Entspannungsreaktion aufzuzeigen. Schließlich stelle ich Entspannung in Zusammenhang mit Gesundheit und gehe in diesem Rahmen auf individuelle Motive, zum Erlernen eines Entspannungsverfahrens ein.
Auseinandersetzung mit dem Entspannungsbegriff
Entspannung ist ein umfassender Begriff, der stark von der subjektiven Bewertung und Ausgangslage des Einzelnen abhängt. Beispielsweise kann eine Person Heavy Metal oder Techno-Musik als entspannend empfinden, während sie bei einer anderen gegenteilige Empfindungen auslöst. Andere gehen in die Natur, treiben Sport, legen sich auf das heimische Sofa oder sehen Fern um sich zu entspannen. Der Brockhaus (19847) definiert Entspannung als einen „Zustand körperl. und seelisch-geistiger Gelöstheit, eine Haltung des Los- oder Geschehenlassens, im Ggs. zur Anspannung des täg. Lebens“ (S. 180). Aus biomedizinischer Sicht wird Entspannung wie folgt definiert: „Der Begriff ‚Entspannung’ wird als Gegensatz zur ‚Spannung’ verstanden und nicht, wie fälschlich gebraucht, zur ‚Verspannung’. Spannung in der richtigen Dosierung ist notwendig und naturgemäß und soll situationsangemessen sein. Die Körperfunktionen und die Nerventätigkeiten des Menschen stehen ständig in Wechselwirkung zwischen Spannung und Entspannung. Im vegetativen Nervensystem gibt es dafür speziell die beiden Hauptkomponenten, den Sympathikus (aktivierend) und den Parasympathikus (entspannend)“ (Massoth; Massoth 1984, S. 121). In beiden Definitionen tauchen die Begriffe Anspannung bzw. Spannung auf, ohne die der Entspannungsbegriff scheinbar nicht auskommt. Sie sind evolutionär angelegte Reaktionsmuster, die zum natürlichen Verhaltensrepertoire des Menschen gehören. Angesichts der hohen Zahl an stressbedingten Krankheiten scheint dieses natürliche Spannungsverhältnis gegenwärtig aus den Fugen geraten zu sein. Da viele Personen scheinbar nicht mehr in der Lage sind, sich ausreichend auf natürliche Weise zu entspannen, müssen sie es erst wieder mit Hilfe verschiedener Entspannungsverfahren lernen. Diese sind nach Krampen; Ohm (1994) als „systematische Methoden der körperlichen und psychischen Selbstentspannung“ zu verstehen und „unterscheiden sich von individuellen Formen der Entspannung und Erholung (wie etwa dem bloßen Ausruhen, dem Hören subjektiv ruhiger, angenehmer, ‚entspannender’ Musik oder Präferenzen für interindividuell höchst unterschiedliche Tätigkeiten, bei denen man sich halt ‚entspannt’ oder ‚abschaltet’), über die wohl die meisten verfügen, nicht nur dadurch, daß sie empirisch erforscht und wissenschaftlich abgesichert sind, sondern auch und vor allem dadurch, daß sie auf dem systematischen Einüben einer psychomotorischen Routine beruhen. Dieses systematische Training von Entspannungsroutinen führt dazu, daß die gewünschten Effekte schneller sowie mit einer gewissen Stabilität und Regelmäßigkeit – auch in stärkeren Belastungssituationen – willkürlich erzielt werden können“ (S. 262).
Psychophysiologische Entspannungsreaktionen
Entspannung lässt sich laut Vaitl; Petermann (20002) „am eindeutigsten über Reaktionen charakterisieren, die sich auf den verschiedenen Ebenen abspielen. Hierzu zählen körperliche Reaktionen, Verhaltensweisen, Emotionen und Kognitionen. So unterschiedlich auch die Induktionsmethoden (= Entspannungsverfahren) sind, mit denen diese unterschiedlichen Reaktionsweisen in Gang gesetzt werden, bewirken sie allesamt eine sogenannte Entspannungsreaktion“ (S. 30). Die Anregung und Stabilisierung einer Entspannungsreaktion, erfolgt bei allen Verfahren durch kontinuierliches Üben. Anzeichen für ein erfolgreiches Üben ist die konditionierte Entspannungsreaktion. Diese Reaktion kann dann auf einen konditionierten Reiz hin (wie zum Beispiel der Körperhaltung oder von Selbstinstruktionen) in den verschiedensten Situationen hervorgerufen werden. Damit kann sich eine geübte Person gewissermaßen auf Befehl in einen Entspannungszustand versetzen. Dieser besteht in charakteristischen Veränderungen neurovegetativer und zentralnervöser Prozesse, die ich im Folgenden darstelle. Die Entspannungsreaktion ist zum einen durch physiologische Veränderungen gekennzeichnet. Vaitl; Petermann (20002) fassen diese wie folgt zusammen:
- Neuromuskuläre Veränderungen:
- Abnahme des Tonus der Skelettmuskulatur
- Verminderung der Reflex-Tätigkeit
- Kardiovaskuläre Veränderungen
- Periphere Gefäßerweiterung (Vasodilatation, insbesondere in den Hautarealen)
- geringfügige Verlangsamung des Pulsschlags
- Senkung des arteriellen Blutdrucks
- Respiratorische Veränderungen:
- Abnahme der Atemfrequenz
- Gleichmäßigkeit der einzelnen Atemzyklen
- Abnahme des Sauerstoffverbrauchs
- Elektrodermale Veränderungen:
- Abnahme der Hautleitfähigkeit
- Zentralnervöse Veränderungen:
- Veränderungen der hirnelektrischen Aktivität (EEG)
(Vaitl; Petermann 20002, S. 31f.)
Die Entspannungsreaktion ist demnach eine Bedingung, unter der beispielsweise die Muskelspannung, die kortikale Aktivität, die Herzfrequenz und der Blutdruck sinken und die Atmung langsamer wird. Außerdem wird die elektrische Aktivität des Gehirns gesenkt. Auf diesem niedrigen Erregungsniveau kann laut Zimbardo (19956) „Erholung vom Stress stattfinden“ (S. 589). Die Entspannungsreaktion ist zum anderen durch psychische Veränderungen gekennzeichnet. Obwohl Entspannungsverfahren bei ungeübten Personen meistens zum Einschlafen führen, haben sie nach längerem Training positive Effekte zur Folge, die sich deutlich von Einschlafvorgängen und deren Begleiteffekten unterscheiden lassen. Hierzu zählen laut Vaitl; Petermann (20002):
- „die affektive Indifferenz, d.h. Affekte und Emotionen lassen sich kaum noch provozieren;
- die mentale Frische; nach den Übungen stellt sich ein Gefühl des Ausgeruhtseins sowohl in körperlicher als auch geistiger Hinsicht ein; und
- die Erhöhung der Wahrnehmungsschwellen; im Laufe der Übungen verlieren die Außenreize (Geräusche, Beleuchtungsänderungen, taktile Stimulationen) immer mehr die Fähigkeit, eine Reaktion auszulösen; meist werden sie gar nicht mehr wahrgenommen“ (S. 31; Hervorhebungen: E. K.).
Körperliche und psychische Auswirkungen der Entspannungsreaktion sind miteinander verflochten. Nach dem Harvard-Mediziner George Benson kommt es bei einer Entspannungsreaktion „zu vielfältigen organismischen Veränderungen: neben hormonellen Veränderungen entkrampft und lockert sich vor allem die (Skelett-) Muskulatur, Puls und Blutdruck werden gesenkt, Atemrhythmen ruhiger und gleichmäßiger, die Aktivität des Gehirns zeigt bestimmte Muster, die subjektiv als Gefühle des Wohlbefindens, der Ruhe und Gelassenheit erlebt werden“ (Huber 1995, S. 22). Durch das systematische Training, stellt sich eine gewisse Routine, Stabilität und Regelmäßigkeit ein, wodurch die gewünschten Effekte schneller erzielt werden können. Infolgedessen werden auch Belastungs- und Erschöpfungszustände besser reguliert, kompensiert und verarbeitet. Dies stärkt die Selbstkontrolle und Selbsthilfefähigkeit, woraus bei mittel- und langfristiger Anwendung eines Entspannungsverfahrens eine emotionale und psycho-physiologische Stabilisierung resultieren kann (vgl. Krampen; Ohm 1994, S. 262).
Nach Zimbardo (19956) gibt es vier Bedingungen als notwendige Voraussetzungen der Entspannungsreaktion: eine ruhige Umgebung, geschlossene Augen, eine bequeme Stellung, wiederholte innere Instruktionen. Dabei reduzieren die ersten drei den Input an das Nervensystem. Die vierte senkt dessen innere Stimulation. Es ist erwiesen, dass die positive Wirkung der Entspannungsverfahren über die Zeit hinausreicht, in der Personen aktiv mit den entsprechenden Übungen beschäftigt sind: z.B. ist der Blutdruck von Bluthochdruckpatienten (die durch ein Entspannungsverfahren gelernt haben ihre Blutdruck zu senken) sogar wenn sie schlafen, niedriger als vor der Entspannungsübung (vgl. ebd., S. 589).
Entspannung und Gesundheit
Wenn sich eine Person dazu entschließt ein Entspannungsverfahren zu erlernen, muss sie ein gewisses Maß an Eigeninitiative und persönliches Engagement mitbringen. Da sie dies auf freiwilliger Basis tut, das Erlernen eines Entspannungsverfahrens aber auch mit Einsatz, Anstrengung, Zeitaufwand und Kosten verbunden ist, ist davon auszugehen, dass individuelle Motive eine Rolle spielen. Oft besteht ein gewisser Leidensdruck, der eine Person dazu veranlasst zu handeln, um ihre Situation zu verbessern. In diesem Zusammenhang wird in der Fachliteratur auch von Betroffenheit gesprochen, aus der heraus sich die Volition (der Wille oder die Absicht zu handeln) ergibt (vgl. Heckhausen 1989; Schwarzer 1994). Den Begriff Betroffenheit verstehe ich hier in einem weiten Sinn: er kann von bloßer Unbehaglichkeit bis hin zu schwerer chronischer Krankheit gehen. Betroffenheit kann durch die individuelle Situation, durch die Krankheit anderer oder durch die als Bedrohung empfundene gesamtgesellschaftliche Lage ausgelöst werden (vgl. Forschungsverbund Laienpotential 1987). Das subjektive Erleben eines gewissen „Mankos“ (Betroffenheit) und die Intention die Situation zu ändern (Volition) sind letztlich entscheidend für das Entstehen einer Handlung im allgemeinen und für das Erlernen eines Entspannungsverfahrens im speziellen. Um die motivationalen Aspekte genauer aufzuschlüsseln, greife ich auf eine Studie der Epidemiologischen Forschung Berlin (1994) zur Gesundheitsförderung zurück. Sie wurde im Rahmen einer Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Prävention gemäß §20 SGB V durch die Gesundheitskassen durchgeführt. Dabei wurden 858 Personen rückwirkend zu den wesentlichen Motiven und Gründen für die Teilnahme an einer Maßnahme zur Gesundheitsförderung befragt. Die Ergebnisse der Befragung sind in Tabelle 3 dargestellt (vgl. Kirschner et al. 1995, S. 99ff.).
- A Krankheiten und Beschwerden 41,6%
- B Rat von Ärzten 30,3%
- C Rat von Familienangehörigen/Freunden 12,1%
- D Unzufriedenheit mit mir bzw. mit meiner Gesundheit 24,7%
- E Ich wollte endlich was für mein Wohlbefinden tun 41,0%
- F Aktiv sein, fit sein, Kondition 26,9%
- G Aus Freude/Interesse/um Leute zu treffen 27,6%
- H Sonstiges 12,7%
- Tab.3.: Motive an einem Programm zur Gesundheitsförderung teilzunehmen
Zwar wurden in dieser Studie Maßnahmen zur Gesundheitsförderung allgemein abgefragt, da jedoch die Hälfte bis zu zwei Drittel des Gesamtangebots der Krankenkassen und Volkshochschulen im Bereich der Gesundheitsförderung verschiedene Entspannungsverfahren beinhaltet, stelle ich die Ergebnisse in einen Zusammenhang mit Entspannungsverfahren. „Krankheiten oder Beschwerden“ sind ein wesentlicher Motivationsgrund, um ein Entspannungsverfahren zu erlernen. Personen, die auf den Rat von Ärzten, Familienangehörigen oder Freunden an einem Entspannungskurs teilnehmen, dürften großteils in die selbe Kategorie fallen. Hier liegt der Unterschied zur ersten Gruppe wohl im wesentlichen darin, dass der Impuls letztlich von außen kommt. Die Punkte D bis G, die zusammengenommen mehr als die Hälfte der Angaben ausmachen, weisen auf einen Personenkreis hin, den man als eher „gesund“ bezeichnen könnte. Aufgrund der Möglichkeit mehrere Faktoren gleichzeitig anzugeben, lassen sich hier jedoch keine direkten Schlüsse ziehen. Darüber hinaus schwächt diesbezüglich der Punkt F „Aktiv sein, fit sein, Kondition“ die Aussagekraft, da er sich eher auf den Bewegungsaspekt der Gesundheitsförderung (z.B. Sport, Gymnastik, Tanz), als auf den der Entspannungsverfahren bezieht. Andererseits ist dieser Effekt beispielsweise beim Yoga auch gegeben. Zumindest sind die Personen, die „unzufrieden mit sich bzw. ihrer Gesundheit sind“ (D) und „endlich etwas für ihr Wohlbefinden tun wollen“ (E), ein Indiz dafür, daß auch „relativ gesunde“ Menschen den Drang verspüren ihre momentane Situation mit Hilfe eines Entspannungsverfahrens zu verbessern. Wie an Punkt G abzulesen ist, spielen auch der „Geselligkeitsaspekt“ und die „Freude an der Sache“ eine Rolle dabei, eine Person zu motivieren ein Entspannungsverfahren zu erlernen.
Die folgenden Fragen betrachten den Motivationsaspekt aus einer anderen Perspektive: gibt es Menschen die eher ein Entspannungsverfahren anwenden als andere? Welche Personen lernen es schneller bzw. leichter und bei welchen tauchen individuelle Probleme mit der jeweiligen Technik verstärkt auf? Über den Umkehrschluss, anhand von prognostisch ungünstigen Faktoren für das Erlernen eines Entspannungsverfahrens, ist es möglich sich den Antworten anzunähern.
Es hat sich gezeigt, dass sich für das Erlernen eines Entspannungsverfahrens z.B. Erlebnis- und Vorstellungsarmut ungünstig auswirken. Darüber hinaus haben „zwanghaft strukturierte Persönlichkeiten [...] oft Schwierigkeiten loszulassen, geschehen zu lassen, einzuwilligen in naturhafte Verläufe gewünschter Richtung“ (Kraft 19892, S. 24; Auslassung: E. K.). Ebenso negativ wirken sich hysterische und hypochondrische Charakterzüge aus. Oft fehlt in diesen Fällen von vorn herein die Motivation. Auf der anderen Seite hat eine zu hohe Motivation wie etwa eine starke Anspruchshaltung, oder ein übersteigertes Leistungsbedürfnis ebenso negative Effekte. Denn sowohl die Fähigkeit ein Entspannungsverfahren zu erlernen, als auch die Wahrscheinlichkeit dies vorzeitig aufzugeben, werden dadurch beeinflusst (vgl. ebd.). Belegt werden diese Aspekte durch mehrere empirische Untersuchungen zu Kursen, in denen verschiedene Entspannungsverfahren angeboten werden. Demnach brechen gerade Personen mit den eben genannten Charaktereigenschaften signifikant öfter als andere den jeweiligen Kurs frühzeitig ab, oder wenden die erlernte Methode nach Beendigung des Kurses nicht mehr an. Darüber hinaus benötigten sie in der Regel auch mehr Zeit, um sich die jeweilige Technik anzueignen (vgl. Vaitl; Petermann 20002). Prinzipiell kann jedoch jede Person, wenn sie genug Geduld aufbringt, ein Entspannungsverfahren erlernen. Dies gilt auch für Personen mit den eben genannten Persönlichkeitsmerkmalen. Welches Entspannungsverfahren für wen besser geeignet ist, hängt von individuellen Fähigkeiten, Interessen und Neigungen ab. Grundvoraussetzung ist immer eine positive Einstellung gegenüber der jeweiligen Technik und der Glaube sie erlernen zu können (vgl. ebd.).
Hinsichtlich des Gegenstandes dieser Diplomarbeit stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach den spezifischen Motiven (den Stress betreffend), die dafür ausschlaggebend sind, dass eine Person ein Entspannungsverfahren erlernt. Obwohl hier die Komplexität von individuellen Voraussetzungen in Wechselwirkung mit unterschiedlichsten Stressoren zu bedenken ist, werde ich im folgenden beispielhaft entsprechende physiologische und psychologische Faktoren bzw. Situationen vorstellen.
- Am Arbeitsplatz begegnet eine Person einer Reihe von Stressoren. Sie können physischer Art sein wie Bewegungsarmut durch eine fixierte Arbeitsposition, Lärm und Abgase, große körperliche Beanspruchung und oder psychische Belastungen wie Erfolgs- und Leistungsdruck, Zeitdruck oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten mit dem Chef oder den Kollegen. Wie viele Personen davon betroffen sind, zeigt eine Studie des Karlsruher Instituts für Arbeit- und Sozialhygiene, die das Stressverhalten von etwa 6000 Führungskräften untersucht und sie in vier unterschiedliche Stresstypen eingeteilt hat (vgl. Huber 1989, S. 23; s.Tab.4.).
- 1 Angst und Anspannung 20,5%
- 2 Verdrängung und mangelnde Selbstkontrolle 22,2%
- 3 Herausforderung, Ehrgeiz und Selbstkontrolle 27,6%
- 4 Gesundes und kontrolliertes Leben 22,7%
- Tab.4.: Die vier Stresstypen (vgl. Huber 1989, S. 23)
Demnach hängt vor allem der „streß-anfällige Typ1 mit Leidensdruck und Krankheitssymptomen zusammen. Herausforderungen werden nicht positiv gesehen und mangelnde Energie, Tatkraft und Gelassenheit stehen Gefühlen von Angst, Anpassung und Machtlosigkeit gegenüber. Folge: Leistungseinschränkung unter Druck und unkontrollierte Lebensweise in Stresssituationen. Typ2 reagiert vor allem mit ‚Lustlosigkeit’, während ‚Ehrgeiz-Typ3’ unter ungesunder Daueranspannung und ausgeprägtem ‚Beschäftigungsdrang’ steht, hat nur Typ4 den gesundheitlich notwendigen Ausgleich zwischen Aktivität und Entspannung in seinem Alltagsleben integriert“ (ebd.).
Entspannungsverfahren sind eine adäquate Maßnahme um physischen und psychischen Belastungen zu begegnen. Je nach Art des Arbeitsplatzes kann körperlichen Verspannungen, Haltungsschäden, Leistungsabfall oder Konzentrationsschwächen vorgebeugt werden. Beispielsweise gibt es mittlerweile Literatur zu Progressiver Muskelentspannung, Autogenem Training und Yoga am Arbeitsplatz oder am Computer. Darüber hinaus bieten viele größere Unternehmen interne kostenlose „Entspannungskurse“ für ihre Mitarbeiter an, um ihre Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten oder noch zu steigern.
- Beziehungsprobleme können ein ausschlaggebender Grund sein, sich ein Entspannungsverfahren anzueignen. Häufig ist es der Partner, der den Anstoß dazu gibt (s.w.o.). Stress mit seinen Folgeerscheinungen wie innere Unruhe, Unzufriedenheit, Unausgeglichenheit, Nervosität und Gereiztheit können eine Beziehungskrise auslösen. Seelische Unausgeglichenheit kann durch ein Entspannungsverfahren gemildert werden. Darüber hinaus beeinflusst es mitunter störende Gewohnheiten wie „dem anderen ins Wort fallen“ oder „nicht zuhören können“ in positiver Weise (vgl. Kraft 19892; im Zusammenhang: Indikationen des Autogenen Trainings). Auch nach einer gescheiterten Beziehung sind Aspekte der Selbstfindung oder soziale Aspekte, wie „wieder unter Menschen zu kommen“ oder „vielleicht jemanden kennen zu lernen“ mögliche Motivationsgründe an einem Kurs für Entspannungsverfahren teilzunehmen.
Daneben gibt es noch weitere Faktoren, die mit Stress zusammenhängen und durch Entspannungsverfahren gemildert werden oder ganz verschwinden. Dazu gehören beispielsweise permanente Müdigkeit und Ausgelaugtheit, Schwierigkeiten sich bzw. seine Emotionen zu kontrollieren, Nervosität und Hyperaktivität oder verstärktes Rauchen bzw. Alkoholkonsum. Jeder dieser Faktoren kann letztlich eine Person dazu motivieren ein Entspannungsverfahren zu erlernen.
Die Folgeerscheinungen von unbewältigtem Stress schlagen sich zuerst in einer subjektiv schlechten Befindlichkeit wie Unwohlsein, Ausgelaugtheit, Leistungsnachlass oder Reizbarkeit nieder. Wenn eine Person nichts dagegen unternimmt, kann dieser Zustand wie bereits dargestellt in akute Krankheiten und Beschwerden fließend übergehen. Aufgrund der Vielzahl körperlicher und psychischer Beschwerden, die dann letztendlich der Auslöser für eine Person sein können ein Entspannungsverfahren zu erlernen, greife ich im Folgenden exemplarisch einige stressbedingte Krankheiten heraus und zeige wie diese durch Entspannung gemildert bzw. ganz geheilt werden können.
- Muskelverspannungen können mit einer Entspannungsmethode behandelt werden. Meist sind der Rücken- und Halswirbelbereich bzw. die Wirbelsäule betroffen, die jedoch bei stärkeren Verspannungen oder einer schlechten Sitzhaltung zu Spannungskopfschmerz und Haltungsschäden führen können. Besonders wirksam zur lokalen Behandlung sind hier zum Beispiel die Progressive Muskelentspannung (vgl. Vaitl; Petermann 20002). Unspezifischer, da hier über geistige Entspannung und Ausgeglichenheit eine allgemeine Muskelentspannung erreicht wird, jedoch ebenso effektiv, kann zum Beispiel das Autogene Training sein. Auch geistige und zugleich körperliche Entspannung wie sie beim Yoga über fließende, ruhige Bewegungsabläufe erreicht werden, sind eine Alternative körperliche Verspannungen zu lindern bzw. zu heilen.
- Schlafstörungen können einerseits „relativ bald zusätzliche Beschwerden im emotionalen Bereich, in der Lebensfreude, bei sozialen Beziehungen und teilweise in den mentalen Leistungen“ (Petermann; Vaitl 1994, S. 63) hervorrufen, andererseits sind sie ein Leitsymptom von Ängsten und vor allem Depressionen. Im sozialen Leben und im Tagesablauf erleben die betroffenen Personen „subjektiv mehr Streß, mit dem sie relativ schlecht zurechtkommen“ (ebd., S. 61). Greift eine Person im Falle von Schlaflosigkeit zu „Schlaftabletten“, so ist sie tagsüber oft müde, da die dämpfende Wirkung am darauf folgenden Tag anhält. Zudem verändern schlafinduzierende Medikamente die physiologische Struktur des Schlafes (der Tiefschlafanteil sinkt) und bewirken bei längerer Einnahme eine körperliche und psychische Abhängigkeit (vgl. ebd., S. 62f.). Bei chronischem Gebrauch kann es laut Corazza et al. (2001) zu „Verwirrtheit, Konzentrationsstörungen und Gefühlsveränderungen“ kommen (S. 419). Diese Nachteile der medikamentösen Behandlung fallen weg, wenn eine Person stattdessen ein Entspannungsverfahren als Einschlafhilfe anwendet.
Dessen Effektivität misst sich daran, inwiefern es eine kürzere Einschlaf- bzw. Wiedereinschlafphase bewirkt. Auch hier gibt es grundsätzlich zwei Richtungen von denen aus der Schlaf gefördert werden kann: zum einen über die gezielte Muskelentspannung (z.B. durch Progressive Muskelentspannung) und zum andern über geistige Entspannung und Gelassenheit (z.B. durch Autogenes Training oder Yoga), die eine allgemeine Entspannung der Muskulatur bewirkt. Nach Petermann; Vaitl (1994) kann man die Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Wirkung von Entspannungsverfahren bei Schlafstörungen wie folgt zusammenfassen: „Die Methoden Jacobson-Entspannung [...] und Autogenes Training haben jede für sich bereits sehr vielen Schlafgestörten geholfen, vor allem Ein-, teilweise aber auch Durchschlafgestörten: Im Gruppenmittel verkürzte sich die subjektiv eingeschätzte Schlaflatenz um zehn bis 40 Minuten; die Häufigkeit von Aufwachepisoden blieb zwar für gewöhnlich annähernd gleich, aber die Patienten schliefen ihrer eigenen Einschätzung auch nach Aufwachen nachts meistens schneller wieder ein“ (S. 64; Auslassung: E. K.).
- Herz-Kreislauferkrankungen gehören in den Industrieländern zu den „Spitzenreitern unter den Todesursachen“ (Petermann; Vaitl; 1994, S. 107). Sie werden vor allem durch Risikoverhaltensweisen wie starkes Rauchen, ungesunde Ernährungsgewohnheiten, Alkoholkonsum, Bewegungsarmut und das Typ A-Verhalten begünstigt. Bei all diesen Faktoren spielt psychischer und/oder physischer Stress eine Rolle. Entspannungsverfahren wirken diesen Verhaltensweisen entgegen und haben darüber hinaus positiven direkten Einfluss auf Herz-Kreislauferkrankungen. Dass direkte physiologische Effekte wie sinkender Puls bzw. Blutdruck, verringerte Muskelspannung oder tiefere ruhigere Atmung empirisch nachgewiesen sind, habe ich bereits unter 4.4.2 angesprochen. Um diese Aspekte noch einmal zu untermauern, greife ich das Beispiel Blutdrucksenkung heraus. Die Progressive Muskelentspannung, das Autogene Training und Yoga-Übungen sind speziell auf ihre blutdrucksenkende Wirkung hin untersucht worden. Diesen Untersuchungen zufolge „besteht heute kein Zweifel mehr daran, dass diese Verfahren den Blutdruck senken“ (Petermann; Vaitl 1994, S. 115). Ein weiteres Ergebnis empirischer Untersuchungen, ist in diesem Zusammenhang, dass die Medikation bei solchen Erkrankungen durch Entspannungsverfahren herabgesetzt werden kann, was hinsichtlich der Nebenwirkungen und individuell unterschiedlicher Verträglichkeit einen gesundheitlichen Vorteil für die betroffene Person bietet. Bei akuten Herz-Kreislauferkrankungen sind Entspannungsverfahren allerdings nicht als Alternative, sondern als Zusatztherapie zu verstehen. Wenn sie nach einer akuten Phase konsequent beibehalten werden, sind sie jedoch ein effektives Mittel, um einer neuerlichen Erkrankung bzw. Herzattacke vorzubeugen (vgl. Petermann; Vaitl 1994, S. 123f).
- Suchtverhalten (z.B. Rauchen, Alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum, aber auch Essstörungen) wird durch psychischen und physischen Stress zumindest begünstigt, wenn nicht verursacht. Sucht kann als fehlangepasstes Verhalten bzw. fehlangepasste Bewältigungsstrategie bezeichnet werden, die zu psychischer und physischer Abhängigkeit führt (vgl. Schwarzer 19962). Der Nachteil einer therapeutischen Behandlung besteht darin, dass eine Person zum einen in eine Patientenrolle gedrängt wird und zum anderen die Rückfallquoten sehr hoch sind. Dagegen bietet das Erlernen eines Entspannungsverfahrens eine Alternative, die nicht die Sucht in den Vordergrund stellt und den Menschen nicht in eine Patientenrolle drängt. Ich gehe davon aus, dass bei Suchtverhalten eher Verfahren angezeigt sind, die auf den „Geist“ abzielen (z.B. Autogenes Training oder Yoga). Im Rahmen eines Praktikums im Szenenwechsel–N7, eine Einrichtung, die suchtbegleitende, klientenorientierte und niedrigschwellig-akzeptierende Drogenarbeit leistet, habe ich gelernt, dass hauptsächlich die Psyche und nicht so sehr der Körper einer Person „süchtig“ ist. Entspannungsverfahren sind als adäquate Bewältigungsstrategien von Problemen zu verstehen, da sie über eine Art „Ersatzfunktion“ für das Suchtobjekt hinaus, die Fähigkeit zur Selbstkontrolle, die innere Ausgeglichenheit und das persönliche Wachstum fördern.
Darüber hinaus ist empirisch belegt, dass Entspannungsverfahren z.B. bei Angststörungen, Depressionen, Schmerzzuständen, gastrointestinalen Störungen, rheumatischen Erkrankungen, Asthma bronchiale, Schmerzuständen, in der Zahnheilkunde, der Geburtshilfe und der Gynäkologie ihre positive Wirkung entfalten (vgl. Petermann; Vaitl 1994).
Wie hoch der prozentuale Anteil der Personen ist, die aufgrund von körperlichen oder psychischen Beschwerden ein Entspannungsverfahren erlernen, muss an dieser Stelle offen bleiben. Vermutlich wenden in diesem Kontext viele Personen auf Rat eines Arztes, Therapeuten oder Psychologen eine der Methoden an. Oft wird die Technik auch vom Experten selbst gelehrt bzw. verschiedene Methoden miteinander abwechselnd kombiniert, was eine größere Effektivität der Behandlung verspricht.
Ausgewählte Entspannungsverfahren
Entspannungsverfahren sind Methoden, die historisch gesehen weit zurückreichen, in schriftlichen Aufzeichnungen bis ins zweite Jahrtausend vor Christus. Hinweise sind beispielsweise bei den frühgeschichtlichen Sumerern im Gilgamesch-Epos, in den indischen Veden und bei den alten Ägyptern zu finden. Im antiken Griechenland bediente sich der Äskulapkult (um 400 v.Chr.) des Heilschlafes und des Traumheilens. Ferner verwenden viele Naturvölker in Afrika, Indien, Australien und Borneo ähnliche Praktiken. Ihnen ist allen gemeinsam, dass sie entweder der Heilung von Krankheiten (meist durch Priester, Schamanen oder Medizinmänner), oder religiösen bzw. mystischen Zwecken (Geisterbeschwörung, Seelenwanderung, Methode zur Selbstfindung bzw. Erleuchtung) dienen (vgl. Kossak 20002, S. 159).
Wie einleitend schon erwähnt, stelle ich in der vorliegenden Arbeit drei ausgewählte Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress vor: die Progressive Muskelentspannung, das Autogene Training und den Yoga. Ich habe speziell diese drei Methoden ausgewählt, da ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass mittels dieser Verfahren ein umfassendes Stressmanagement gelingt. Da ich mich als Person begreife, und in zunehmendem Maße erfahre und erkenne, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden, sind alle drei Verfahren geeignet, mich im Ganzen zu entspannen, gleichwohl sie schwerpunkthaft unterschiedliche Zugänge wählen. Grundsätzlich ruft jedes Entspannungsverfahren körperliche Veränderungen hervor. „Sie können einmal primäres Ziel einer Entspannungsmethode sein oder sich sekundär als spontane Begleiterscheinungen einstellen“ (Vaitl; Petermann 20002, S. 29). Die Methoden unterscheiden sich also im Grad der Gewichtung, die sie der körperlichen oder geistigen Entspannung beimessen. „So zielen beispielsweise das Autogene Training oder die Progressive Muskelentspannung direkt auf spezifische körperliche Veränderungen ab, z.B. auf muskuläre Entspannung oder Erweiterung der Blutgefäße. [...] Im Unterschied dazu sind die Meditationsverfahren primär an mentalen Veränderungen interessiert, obgleich auch sie nicht ohne körperbezogene Vorübungen auskommen (bestimmte Körperpositionen und Atemübungen [...]) und körperliche Veränderungen hervorrufen“ (S. 29; Auslassungen: E. K.). Die drei ausgewählten Entspannungsverfahren, repräsentieren diese unterschiedlichen Akzentuierungen:
- Progressive Muskelentspannung: Körperliche Entspannung spezifischer Muskelgruppen,
- Autogenes Training: Allgemeine geistig-körperliche Entspannung durch „autosuggestive“ Körpererfahrung,
- Yoga: Allgemeine geistig-körperliche Entspannung durch Bewegung, Körpererfahrung und Kontemplation
Die Progressive Muskelentspannung
Geschichtliche Aspekte
In der Geschichte der Progressiven Muskelentspannung lassen sich grundsätzlich zwei Phasen feststellen. Die erste Phase beginnt 1934 mit der Pionierleistung von Edmund Jacobson (1885-1976), eine physiologische Methode zur Bewältigung von Angst und Spannung zu entwickeln. Die zweite Phase leitet Joseph Wolpe (1915-1997) ein, indem er Jacobsons Methode ändert und sie in ein systematisches Behandlungsprogramm einbaut.
Der Physiologe Edmund Jacobson beginnt sein Werk mit der leitenden Idee, dass es „vielleicht kein allgemeineres Heilmittel als Ruhe“ (Hamm 20002, S. 305) gibt. Er geht davon aus, dass ein solcher Zustand der Ruhe bzw. der Entspannung in einer Reduktion des neuromuskulären Tonus am zuverlässigsten feststellbar ist, und dass umgekehrt durch die Reduktion der muskulären Verspannung auch die Aktivität im zentralen Nervensystem herabgesetzt werden kann (Reziprozitätsprämisse). Dieses Wechselspiel zwischen zentralnervösen, mentalen Prozessen und peripheren, muskulären Veränderungen beginnt er 1920 in einer Reihe von Untersuchungen empirisch nachzuweisen (vgl. Hamm 20002, S. 305). Jacobson untersucht die Schreckreaktion bei plötzlich auftretenden lauten Geräuschen, wobei er feststellt, dass Personen, die gelernt haben, ihre Muskeln zu entspannen, nicht aufschrecken. Der Grad der Muskelspannung beeinflusst also die Ausprägung des Reflexes. Außerdem stellt er fest, dass innere Bilder, vor allem, wenn sie mit Bewegung assoziiert sind, zu einer leichten, jedoch messbaren Muskelaktivität führen (vgl. Payne 1998, S. 55). So kann er beispielsweise zeigen, dass die Vorstellung bestimmter Armbewegungen mit einer Zunahme der EMG -Aktivität der Bizepsmuskulatur einhergeht. Auch bei visuellen Vorstellungen (z.B. hakenschlagender Hase) können entsprechende Augenbewegungen registriert werden (vgl. Hamm 20002, S. 305). Der Einfluss der Vorstellungskraft auf die Muskulatur bzw. auf verschiedene Körperfunktionen ist in einer Reihe späterer Untersuchungen empirisch nachgewiesen worden. Bezüglich des Umkehrschlusses, dass die Reduktion der Muskelspannung zu einer verringerten Aktivität des Nervensystems führt, sind die empirischen Befunde jedoch umstritten (vgl. ebd., S. 305f.).
Die muskuläre Entspannung erkannt als direkter physiologischer Gegensatz zur Spannung, ist nach Jacobson im Sinne der Reziprozitätsprämisse die logische Behandlung für angespannte und ängstliche Menschen. Durch systematische Spannung und Entspannung verschiedener Muskelgruppen, sowie durch den Lernvorgang, sich auf begleitende Gefühle der Spannung und Entspannung zu konzentrieren und diese zu unterscheiden, ist es möglich fast alle Muskelkontraktionen zu beseitigen und das Gefühl tiefer Entspannung zu erleben (vgl. Bernstein; Borkovec 19782, S. 20). Jacobson prägt für „diese Art tiefgreifender Entspannung [...] den Begriff ‚progressive’ (also fortschreitende) Entspannung“ (Jacobson 19994, S. 135; Auslassung und Hervorhebung: E. K.). Die Konzentration auf diese Empfindungen zu lenken, bezeichnet Jacobson als „erlernte Wahrnehmung“ (Payne 1998, S. 55). Er geht also davon aus, dass seine Methode trainierbar ist und dass sich jedermann die Progressive Muskelentspannung aneignen kann. Jacobson lehnt (im Gegensatz zu anderen Entspannungsverfahren) die Anwendung von Suggestivformeln bei der Progressiven Muskelentspannung ab.
Nach einer 1934 erschienenen Laienveröffentlichung mit dem Titel: „You must relax“ stellt Jacobson seine standardisierte Methode, sein Vorgehen, seine Ergebnisse und die Beschreibung seiner Theorie 1938 in der wissenschaftlichen Veröffentlichung „Progressive Relaxation“ (Jacobson 19994, S. 12) an der Universität von Chicago vor.
Die zweite Phase der Entwicklung der Progressiven Muskelentspannung beginnt 1948 mit Joseph Wolpes Arbeiten über die Gegenkonditionierung von Furchtreaktionen. Wolpe greift Jacobsons Technik auf und verwendet sie in modifizierter Form. In Wolpes Untersuchungen an Katzen zeigt sich, dass eine konditionierte Furchtreaktion durch das Hervorrufen einer damit unvereinbaren Reaktion während schrittweiser Darbietung des gefürchteten Reizes abgebaut werden kann. Die unvereinbare Reaktion hemmt die Furchtreaktion so lange, wie sie intensiver als letztere ist. Auf seiner Suche nach einer beim Menschen leicht einzuführenden, unvereinbaren Reaktion stößt Wolpe auf die Techniken, wie sie in Jacobsons Progressiver Muskelentspannung enthalten sind. Entspannung als physiologischer Gegensatz zu Spannung scheint ihm die ideale Reaktion für sein Programm der Gegenkonditionierung zu sein. Wegen des Zeitaufwandes, der für Jacobsons Entspannungstrainings notwendig ist, ergeben sich folgende Entwicklungen: die Einführung von stufenweiser Darbietung zuerst wirklicher, später vorgestellter gefürchteter Reize und die Abänderung des Entspannungstrainings. Außerdem bestimmt der Therapeut das gesamte Vorgehen während der Trainingssitzungen durch mündliche Anweisungen (Suggestionen und Hypnoseverfahren), um die Wahrnehmung der Körpergefühle zu erleichtern. Wolpes Arbeit ist demnach in zweifacher Hinsicht bedeutsam: zum einen ist durch die Entwicklung eines wirksameren Entspannungstrainings der Zeitanteil, den das Training im Rahmen einer Therapie benötigt, verringert, zum anderen verlagert sich der Schwerpunkt der Behandlung von der eigentlichen Angstreaktion auf die spezifischen Bedingungen, unter denen diese überhaupt auftritt. Er entwickelt also ein strukturiertes, situationsspezifisches Lernprogramm, in dem die Entspannung nur ein Gesichtspunkt ist (vgl. Bernstein; Borkovec 19782, S. 20f.). Dieses Behandlungsprogramm, die systematische Desensibilisierung, eine in der Verhaltenstherapie wichtig gewordene Technik, ist beispielsweise in Wolpes Buch „Praxis der Verhaltenstherapie“ (1972) beschrieben. Der Grundsatz der Unvereinbarkeit mancher emotionaler Reaktionen, wie Angst und Entspannung, wird also hierbei angewendet. Da Angst ein Hauptgrund für „fehlangepasste Vermeidungshandlungen“ (Zimbardo 19955, S. 666) ist, und eine ängstliche Person demzufolge Stress nicht erfolgreich bewältigen kann, scheint es von Bedeutung zu sein, Angst durch Entspannung vorzubeugen, um das eigene Stressmanagement zu verbessern.
Seit den 1960ern wird die Progressive Muskelentspannung im deutschsprachigen Raum rezipiert, insbesondere im Zusammenhang mit der Verbreitung der Verhaltenstherapie in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, der sie in einer vereinfachten Form als einleitende Entspannungstechnik dient (Schott; Wolf-Braun 20002, S. 154). Im geschichtlichen Verlauf zeichnen sich seit Wolpes Änderungen an Jacobsons Vorgehen zwei Tendenzen in der Progressiven Muskelentspannung ab. Erstens kommt es zu einer Spezifierung wirksamerer Trainingsbedingungen, was zu einer „Flut von Varianten im Vorgehen“ (Bernstein; Borkovec 19782, S. 22) führt, deren Wirksamkeit nicht systematisch untersucht wird. Zweitens werden die Meßmethoden für die physiologischen Wirkungen der Entspannung verfeinert, was in gewissem Umfang zu gesichertem empirischem Wissen über die Wirksamkeit der Progressiven Muskelentspannung führt.
Gegenwärtig übernehmen Gesundheitskassen (ebenso wie beim Yoga und dem Autogenen Training) einmal im Jahr pro Mitglied die Kosten für einen Kurs zum Erlernen der Progressiven Muskelentspannung und die „AOK-Die Gesundheitskasse“ bietet für Mitglieder sogar eigene Kurse an. Dies fällt in den Bereich der Prävention gemäß §20 Abs. 1 und 2 SGB V vom 21. Juni 2000 der Gesetzlichen Krankenkassenversicherung im Rahmen der Gesundheitsförderung (vgl. Bartsch et al. 2000, S. 66). Der Blick in das Programmheft der Volkshochschule in Augburg (Frühjahr 2003) zeigt gemessen am Angebot an Yoga- und Autogenen Trainings-Kursen (s.5.2.1; s.5.2.2) mit drei Kursen für Progressive Muskelentspannung eine vergleichsweise geringe Nachfrage an dieser Entspannungsmethode. Die Progressive Muskelentspannung, die vorwiegend im therapeutischen Bereich eingesetzt wird, scheint sich also noch nicht in der Allgemeinbevölkerung etabliert zu haben. Dieses Entspannungsverfahren ist jedoch nicht nur als therapeutisches Mittel anwendbar, sondern es kann auch für eine relativ gesunde Person als „Strategie zu Bewältigung von Angst- und Stresssituationen“ (Hamm 20002, S. 311) von großem Nutzen sein.
Methodische Vorgehensweise
Nach Jacobson ist das zentrale Ziel seiner Entspannungsmethode „die willentliche, kontinuierliche Reduktion der Spannung (Kontraktion) einzelner Muskelgruppen des Bewegungsapparates“ (Hamm 20002, S. 306). Hamm (20002) legt die Betonung auf das Wort „willentlich“, da Jacobson wie bereits angesprochen „explizit auf suggestive Elemente bei seinen Übungen“ verzichtet (ebd.). Eine Person soll vielmehr lernen, sich für den eigenen Körper zu sensibilisieren: sie „soll [...] bewusst wahrnehmen lernen, welche ihrer Muskeln verspannt, also kontrahiert sind, um dann zu wissen, wo sie sich entspannen soll. In dieser sogenannten ‚Kultivierung der Muskelsinne’ sieht Jacobson das Hauptziel seines Trainings“ (ebd.; Auslassung: E. K.). Das Verfahren baut auf dem Prinzip der Anspannung (für die Dauer von 1 bis 2 min.) und anschließender Entspannung (für die Dauer von 3 bis 4 min.) der jeweiligen Muskelgruppe auf. In den Anspannungsphasen kommt es nicht darauf an, möglichst stark zu kontrahieren, sondern im Gegenteil möglichst subtile Anspannungen einzelner Muskelgruppen wahrnehmen zu lernen. Die Person soll sich auf die entsprechenden Empfindungen in den An- und Entspannungsphasen konzentrieren. Dadurch lernt sie immer schwächere Kontraktionen zu unterscheiden und selbst minimale Verspannungen abzubauen. „Die Beseitigung der Restspannung ist ein wesentliches Merkmal der hier vorgestellten Methode“ (Jacobson 19994, S. 136). Es werden alle Muskelgruppen des Bewegungsapparates von der Kopfregion bis zu den Zehen sukzessive (schrittweise) angespannt und anschließend entspannt. In folgender Reihenfolge gibt Jacobson zu sieben Übungsbereichen mehrere Einzeltrainingseinheiten an:
- Armübungen (für Oberarm-, Unterarm und Fingermuskulatur);
- Beinübungen (für Hüftbeuger, Gesäß-, Oberschenkel-, Unterschenkel-, Waden- und Zehenmuskulatur);
- Übungen im Rumpfbereich (für Bauch-, Rücken-, Zwischenrippenmuskulatur, Zwerchfell, Brust- und Schultermuskulatur);
- Nackenübungen (für Nackenmuskulatur);
- Übungen der Augenregion (für Stirn-, Gesichts-, Augenmuskulatur);
- Visualisationsübungen (Wahrnehmung selbst schwacher Kontraktionen der Augenmuskulatur);
- Übungen der Sprachwerkzeuge (für Kau-, Mundboden-, Gesichts und Zungenmuskulatur) (vgl. Hamm, 20002, S. 307f.).
Die einzelnen Übungen können sowohl im Sitzen als auch im Liegen durchgeführt werden. Alle sieben Bereiche zu erläutern, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zur Veranschaulichung der Methode stelle ich deshalb drei Teilübungen exemplarisch vor:
- Armübung: Die Person befindet sich in einer liegenden Position und hat die Augen geschlossen. Sie hebt den Unterarm im rechten Winkel zur Unterlage an und ballt die Faust (1-2 min.). Währenddessen soll sie auf das Gefühl der Spannung im ganzen Arm achten. Dann lässt sie den Arm fallen und konzentriert sich auf die Lockerung des Armes (3-4 min.). Nach einer Ruhepause wird die Übung wiederholt (vgl. Jacobson 19994, S. 121).
- Nackenübung: Bei dieser Übung soll eine Person in sitzender Position den Kopf zuerst nach hinten und dann nach vorn (gegen einen externen Widerstand) drücken. Schließlich soll der Kopf noch nach links und nach rechts gebeugt werden. Zwischen diesen vier Anspannungsphasen erfolgen Entspannungsphasen (vgl. Hamm 20002, S. 308).
- Visualisationsübung: Zur Wahrnehmung selbst schwacher Kontraktionen der Augenmuskulatur stellt sich eine Person (in sitzender oder liegender Position, mit geschlossenen Augen) zunächst z.B. einen vorbeifahrenden Zug für die Dauer von etwa einer Minute vor. Das löst horizontale Augenbewegungen aus. Nach einer Pause blickt sie imaginär zum Beispiel auf die Spitze eines Baumes. Dadurch werden vertikale Augenbewegungen ausgelöst. Schließlich sollen komplexe Augenbewegungen etwa durch die Vorstellung eines flüchtenden, hakenschlagenden Hasen ausgelöst werden. Nach einer Ruhepause wird die Übung (mit geöffneten Augen) wiederholt (vgl. Hamm 20002, S. 308).
Nach der ursprünglichen Version der Progressiven Muskelanspannung ist eine tägliche Übungszeit von einer Stunde und über 50 Trainingssitzungen (pro Sitzung etwa 3 Muskelgruppen) vorgesehen. Das heißt, es vergehen drei bis sechs Monate bis eine Person dieses Entspannungsverfahren vollkommen beherrscht. Ist das der Fall, kann sich die sogenannte „differentielle Entspannung“ (ebd., S. 309) anschließen. Sie beinhaltet die Umsetzung der Progressiven Muskelentspannung im Alltag (z.B. beim Lesen und Schreiben am Arbeitsplatz oder beim Autofahren). Dabei sollen die notwendigen Bewegungen ökonomisch durchgeführt und alle nicht benötigten Muskelgruppen maximal entspannt gehalten werden. Jacobson schlägt zum Erlernen der differentiellen Entspannung einen schrittweisen Wechsel der Entspannungsinduktion, z.B. vom Liegen zum Sitzen zu einfachen sitzenden Tätigkeiten, vor (vgl. Jacobson 19994, S. 168ff.).
Nutzen und Risiken
Empirische Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf den Nachweis physiologischer Veränderungen durch die Progressive Muskelentspannung. Jacobson hat gezeigt, dass nach seinem Entspannungstraining die Pulsfrequenz und der Blutdruck sinken. Anfang 1960 wird in einer Reihe von Untersuchungen eine Senkung der Leitfähigkeit der Haut und der Atemfrequenz, eine stärkere Abnahme der subjektiv empfundenen Spannung sowie eine abgeschwächte Reaktion dieser Parameter auf Angststimuli festgestellt (vgl. Bernstein; Borkovec 19782, S. 22). Ebenso wird bei den untersuchten Personen eine Abnahme der subjektiven, durch bestimmte Stimuli ausgelösten Angstreaktion bzw. des emotionalen Stresses festgestellt. Im Verlauf dieser Studien erweist sich die Progressive Muskelentspannung im Vergleich zu von den Versuchspersonen selbst gestalteten Bemühungen, sich zu entspannen, als effektiver, einen subjektiv empfundenen Entspannungszustand mit herabgesetzter Muskelspannung und Absenkung von Blutdruck, Puls und Atemfrequenz herbeizuführen. Überdies werden positive Wirkungen bei Migräne, Asthma bronchiale und bei essentieller Hypertonie nachgewiesen. Untersuchungen über eine verbesserte Lern- und Merkfähigkeitsleistung, eine Reduktion des Angstpotentials, sowie über die Therapie von Schlafstörungen durch die Anwendung der Progressiven Muskelentspannung, zeigen zudem weitere Einsatzmöglichkeiten des Verfahrens auf (vgl. Olschewski 19963, S. 27f.). Demgegenüber stehen jedoch auch einige Arbeiten, die keine signifikanten Unterschiede zwischen den Praktizierenden und der Kontrollgruppe finden. Das liegt zum einen daran, dass die Anzahl der Trainingssitzungen der Praktizierenden bei den negativen Befunden deutlich niedriger ist als bei den positiven. Studien zeigen größere Effekte bei Langzeit-Trainierten als bei Unerfahrenen. „Nur in Progressiver Muskelentspannung ausreichend geübte Personen sind in der Lage, auch über die Trainingssitzungen hinaus stabile physiologische Veränderungen durch Entspannungsinstruktionen zu induzieren“ (Hamm 20002, S. 316). Zum anderen wird die Bedeutung der Anwesenheit eines Übungsleiters unterstrichen: „Studien, welche direkt Tonband mit vom Therapeuten präsentierten Instruktionen verglichen haben, fanden konsistent stärkere und stabilere Effekte bei persönlichen Instruktionen“ (ebd.). Dies wird auf die individuell angepasste Erfolgsrückmeldung durch den Therapeuten zurückgeführt (vgl. Hamm 20002, S. 315ff.).
Im Gegensatz zur Reduktion einzelner physiologischer Erregungsindikatoren, kann eine generelle Reduktion der Aktivität des autonomen Nervensystems bisher nicht nachgewiesen werden. Positivere Ergebnisse diesbezüglich werden bei Experimenten in Belastungssituationen erzielt. So zeigt sich, dass in Progressiver Muskelentspannung trainierte Personen signifikant geringere elektrodermale Spontanfluktuationen (Hautleitwertniveau) auf einen emotional belastenden Film aufweisen, als bei untrainierten Kontrollpersonen. Des Weiteren teilen geübte Personen während der Darbietung lauter Töne (100 db) weniger Angstsymptome mit, als ungeübte Personen. Auch die subjektiv erlebte Schmerzintensität ist in Tests mit Kaltwasser oder elektrischer Reizung bei geübten Personen geringer. Der Nutzen der Progressiven Muskelentspannung tritt also während einer Stressinduktion deutlicher zu Tage, als unter Ruhebedingungen. Dies wirkt sich nicht nur erkennbar auf physiologische Indikatoren aus, sondern auch positiv auf die Gefühlslage und psychische Stabilität der praktizierenden Person (vgl. ebd., S. 317f.).
Bei der Angstbehandlung, historisch gesehen eine Hauptdomäne der Progressiven Muskelentspannung, sind die Untersuchungsergebnisse widersprüchlich, so dass sie hier lediglich als begleitende Maßnahme eingesetzt werden sollte (vgl. Hamm 20022, S. 318ff).
Ein Problem bei der Progressiven Muskelentspannung betrifft die bereits angesprochene Vielfalt der angewandten Methoden, bei denen teilweise nur der gemeinsame Name daran erinnert, dass es sich um ein und dasselbe Entspannungsverfahren handelt. Bis heute fehlt es an standardisierten Schlüsselvariablen wie z.B. Einfluss suggestiver Entspannungsformeln, Stärke der Kontraktion, Wichtigkeit von Anspannungs- und Entspannungszyklen, Art, Anzahl und Abfolge der zu trainierenden Muskelgruppen. Dadurch kommt es zu unterschiedlichen empirischen Ergebnissen hinsichtlich der Wirkung der Progressiven Muskelentspannung. Ein weiteres Problem ist die relativ lange Lernphase verbunden mit einem hohen Zeitaufwand, speziell bei der Originalversion von Jacobson. Dies kann bei einer Person zu Verdruss und vorzeitiger Aufgabe führen, bevor die Methode Wirkung zeigt (vgl. ebd., S. 314).
In der mir vorliegenden Literatur habe ich keinen Hinweis auf mögliche Risiken für die körperliche und psychische Gesundheit einer Person durch die Progressive Muskelentspannung gefunden. Gestützt durch empirische Befunde gehe ich davon aus, dass sich bei richtiger Anwendung und mit genügend Übung bei der praktizierenden Person eine erhöhte Körpersensibilität und eine verbesserte Fähigkeit zur Entspannung einzelner Muskelgruppen einstellt. Auch eine bessere psychische Resistenz gegenüber stressverursachenden Situationen ist zu erwarten. Daraus lässt sich schließen, dass Personen, die dieses Entspannungsverfahren anwenden, bewusster mit ihrem Körper bzw. ihrer Gesundheit umgehen können. Dabei habe ich keine empirische Studie gefunden, die sich nicht an der kurativen Medizin orientiert. In diesem Zusammenhang interessiert mich beispielsweise, ob die Anwendung der Progressiven Muskelentspannung das psychische und physische Wohlbefinden einer Person verändert und wie sich das ausdrückt. Ferner finde ich die Frage spannend, ob und wie Entspannung die Lebensweise einer Person (z.B. das Gesundheitsverhalten betreffend) beeinflusst. Schließlich ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, ob durch Entspannung das Gefühl der Kohärenz (s.2.4.4) beeinflusst werden kann.
Das Autogene Training
Geschichtliche Aspekte
Das Autogene Training wird 1930 von dem Berliner Psychiater und Neurologen Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) begründet. Dabei wird er durch Oskar Vogts Arbeiten über Hypnose und Selbsthypnose inspiriert (vgl. Schultz 198217, S. 1). Der Berliner Neuropathologe Oskar Vogt (1870-1959) vertritt um 1900 die Ansicht, dass Hypnose und Schlaf auf die gleiche Weise durch ein reflektorisch arbeitendes Schlafzentrum gesteuert seien. Um Schlafphänomene besser untersuchen zu können, hypnotisiert er seine Probanden und befragt sie anschließend über ihre Empfindungen. Fast alle geben Schwere- und Wärmeerlebnisse an, woraufhin diese für Vogt als zuverlässiger Indikator für eine gelungene Hypnose-Einleitung gelten. Ihm fällt auf, dass viele der von ihm untersuchten Personen nach einer Reihe von Hypnose-Sitzungen in der Lage sind, sich selbst in einen hypnotischen Zustand zu versetzen, Ruhe und Entspannung zu erleben, sowie Schwere und Wärme in den Gliedmaßen zu spüren. Nach einer solchen „autohypnotischen Ruhe“ fühlen sie sich erfrischt, berichten über nachlassende Erschöpfung und weniger körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel Kopfschmerzen (vgl. Vaitl 20002, S. 206). Die Autohypnose wird von Vogt als „prophylaktische Ruhepause“ (Schultz 198217, S. 2) bezeichnet.
Angeregt durch diese Beobachtungen beginnt Schultz das therapeutische Potential der Autohypnose zu erforschen. Er sucht vor allem eine Alternative zur damals gängigen Hypnotherapie, die er wegen der Passivität einer Person durch die Hypnose und deren Abhängigkeit vom Hypnotiseur ablehnt. Vogts Erkenntnis, dass „es bei gebildeten und kritischen Versuchspersonen angängig sei, die Umschaltung in den hypnotischen Ausnahmezustand der Selbstentscheidung [...] zu überstellen“ (Schultz 198217, S. 1; Auslassung: E. K.) nimmt Schultz zum Anlass, seinen Patienten die Instruktionen des Hypnotiseurs beizubringen. Die regelmäßig auftretenden Erscheinungen (wie Schwere und Wärme) hält er für eine selbsterzeugte, das heißt „autogene“, psychovegetative „Umschaltung“ (Schultz 198217, S. 1) in einen Ruhezustand. Dazu bedarf es keines Hypnotiseurs mehr und den Patienten wird eine gewisse Selbstregulation körperlicher Vorgänge eröffnet (vgl. Vaitl 20002, S. 207). Noch interessanter ist für Schultz der Umstand, dass sich ihre psychische Gesundheit durch diese Übungen zu verbessern scheint. Schultz entwickelt also eine auf diesen selbstgenerierten Zustand basierende Behandlung mit dem Ziel, diesen entspannten Zustand durch das Aufsagen vorgegebener Formeln durch die Patienten zu erlangen. Die Formeln erzeugen durch Imagination und Autosuggestion einen Wechsel weg vom gestressten hin zum entspannten Zustand (vgl. Payne 1998, S. 249f.).
In einem nächsten Schritt versucht Schultz, andere körperliche Funktionen „autogen“ zu beeinflussen. Zu den beiden ersten Grundübungen der „Schwere“ und „Wärme“ kommen noch die „Atemübung“, die „Herzübung“, die „Sonnengeflechtübung“ und die „Stirnkühleübung“ hinzu. Diese sechs, physiologisch orientierten Übungen bilden fortan den Kern des Verfahrens, dem Schultz den Namen „Autogenes Training“ gibt. Der Begriff „Training“ bringt zum Ausdruck, dass es sich um ein zu übendes Verfahren handelt, welches zwar von einem Fachmann vermittelt wird, aber nur dann zu den gewünschten physiologischen Effekten führt, wenn eine Person diese Übungen über einen mehr oder weniger langen Zeitraum hin selbst durchführt. Da der Begriff „Training“ zu Einstellungen führen kann, die der körperlichen Entspannung widersprechen, spricht Schultz auch im Untertitel seines Standardwerks „Das Autogene Training“ (erstmals 1932 publiziert) von einer „konzentrativen Selbstentspannung“. Damit ist im Gegensatz zur aktiven Konzentration (der willentlich gesteuerten Hinwendung der Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt) eine spezielle Form der Konzentration gemeint: die passive Konzentration. Vaitl (20002, S. 207) umschreibt sie mit Begriffen wie „gleichschwebende Aufmerksamkeit“ oder „diffus-passive Wahrnehmung körperlicher Vorgänge“. Schultz sieht die passive Konzentration als eine notwendige Bedingung dafür, dass sich die angestrebten physiologischen Effekte einstellen.
Im Laufe der Jahre werden die Verfahrensvorschriften für die sechs Standard- oder Unterstufenübungen noch weiter verfeinert und um die sogenannten Oberstufenübungen (meditative Übungen) erweitert (vgl. Vaitl 20002, S. 207). Ab dem Jahre 1928 kommt es zu einer Expansion des Autogenen Trainings, ausgelöst durch den Zusammenschluss von psychotherapeutisch orientierten Ärzten zur allgemeinen ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie. Diese fordert den Einsatz des Autogenen Trainings als kostensparende Kurzzeittherapie (vgl. Schott; Wolf-Braun 20002, S. 151). Im Nationalsozialismus wird die Bedeutung einer „Neuen deutschen Seelenheilkunde“ großgeschrieben und Schultz stellt das Autogene Training in den Kontext einer „ärztlichen Seelenführung“, die es auf Disziplinierung, Abhärtung und Leistungssteigerung absieht. In den Kriegsjahren kommt es als suggestives Verfahren verstärkt zur Anwendung (vgl. Schott; Wolf-Braun 20002, S. 151f.).
Nach dem zweiten Weltkrieg wird im Zusammenhang mit den Fortschritten der psychosomatischen Medizin das Autogene Training weiter ausgebaut (vgl. Schott; Wolf-Braun 20002, S. 153). Bis heute entstehen eine Vielzahl von Varianten des Autogenen Trainings, sei es durch verkürzte Anwendungsmöglichkeiten, die Veränderung der Reihenfolge der Formeln oder das Hinzunehmen weiterer Formeln (vgl. Haring 1979; Hoffmann 200014; Langen 1968).
Das Autogene Training hat nicht nur in der Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie breite Anerkennung gefunden, sondern scheint auch in weiten Kreisen der Bevölkerung als Selbsthilfe- und Selbstheilungstechnik bekannt zu sein. Dazu haben Vorträge und Kurse an Volkshochschulen und seine Anerkennung als psychotherapeutisches Verfahren durch die Krankenkassen (damit wird es als ärztliche Leistung honoriert) beigetragen. Die Volkshochschule der Stadt Augsburg bietet beispielsweise im Frühjahr 2003 insgesamt 8 Kurse zum Erlernen des Autogenen Trainings an.
Methodische Vorgehensweise
Schultz definiert das Autogene Training als „[e]in vom Selbst (autos) sich entwickelndes (gen = werden) und das Selbst gestaltendes systematisches Üben“ (Schultz 198217, S. 1; Anpassung: E. K.). Es ist eine Form der Selbstkontrolle sowie eine Methode zur Selbsthilfe, die bei einer Person einen körperlich und psychisch entspannten Zustand hervorruft. Um das Verfahren erfolgreich praktizieren zu können, müssen folgende Rahmenbedingungen beachtet werden: die Vorbereitungsphase, die Übungshaltung und das sogenannte Zurücknehmen (vgl. Vaitl 20002, S. 208f).
- Die Vorbereitungsphase umfasst zum einen psychologische Maßnahmen. Zuerst wird der autogene Charakter der Übungen betont. Damit können falsche Vorstellungen, Ängste, Befürchtungen und übertriebene Hoffnungen abgebaut werden, die sich daraus ergeben, dass das Autogene Training irrtümlich für eine Form der Hypnose gehalten wird. Im nächsten Schritt wird auf die prinzipielle Erlernbarkeit des Verfahrens hingewiesen. Bei konsequentem Training stellt sich bei jeder Person ein Erfolg ein. Besonders motivierend ist erstens der Hinweis, „daß die angestrebten körperlichen Veränderungen nichts Außergewöhnliches oder gar Absonderliches darstellen, sondern lediglich Funktionsreserven, die in jedem Menschen biologisch angelegt sind, freisetzen bzw. reaktivieren“ (Vaitl 20002, S. 209). Ein zweites motivierendes Moment stellt der Hinweis dar, dass bei der Entwicklung neuer vegetativer Fertigkeiten ebenso beharrlich geübt werden muss, wie beim Erlernen neuer motorischer Fertigkeiten. Schließlich sollen in der Anlernphase möglichst wenig Erklärungen über die Wirkungsweise und Hintergründe der einzelnen Übungen gegeben werden. Die übende Person sollte anfangs selbst Erfahrungen machen. Diese werden dann später detailliert besprochen.
Die Vorbereitungsphase umfasst zum anderen verfahrenstechnische Maßnahmen. Äußere und innere Störeinflüsse müssen möglichst gering gehalten werden. „Da es sich bei den physiologische Reaktionen, die eingeübt werden sehr wahrscheinlich um eine konditionierte Entspannungsreaktion handelt, müssen die Hinweisreize aus der Umgebung konstant gehalten werden, um einen Konditionierungsprozess überhaupt erst in Gang zu bringen“ (ebd., S. 209). Das heißt, es sollen konstante Übungsbedingungen und eine bequeme Übungshaltung in einem ruhigen Raum, bei gedämpfter Beleuchtung und ohne störende Geräusche (z.B. Telefonklingeln) geschaffen werden (vgl. ebd., S. 209f.).
- Bezüglich der Übungshaltung wird vielfach diskutiert, ob eine liegende oder eine sitzende Position besser geeignet ist. Ursprünglich wurde das Autogene Training im Sitzen in der sogenannten „Droschkenkutscherhaltung“ (Schultz 198217, S. 18) durchgeführt. In dieser Haltung benötigt eine Person, trotz fehlender Rückenstütze, keine Muskelkraft, um sitzen zu bleiben. Wichtig hierbei ist, dass beide Füße etwas voneinander entfernt fest auf dem Boden stehen, wobei der Winkel der Knie mehr als 90 Grad beträgt und die Arme locker herunterhängen oder auf den Oberschenkeln liegen, ohne aber den Oberkörper zu stützen (vgl. ebd., S. 17f.). Der Vorteil der Sitzhaltung ist, dass die Person die Konzentration leichter bewahrt, (also nicht so schnell einschläft) und diese Haltung fast überall (sogar in der Straßenbahn) einnehmen kann. Beliebter ist es mittlerweile, die Übungen auf dem Rücken liegend durchzuführen. Dies hat den Vorteil, dass sich gerade in der Anlernphase die gewünschten Effekte schneller als in einer Sitzhaltung einstellen. Hinzu kommt, dass „das Gefühl, des Abschaltens und Ausruhens eher mit dem Liegen als mit dem Sitzen verknüpft“ (Vaitl 20002, S. 210) ist. Dies ist ganz im Sinne von Schultz, der hinsichtlich der Übungshaltung folgendes empfiehlt: „Ist Gelegenheit, in liegender Stellung zu üben, so wählt man am besten die [...] Horizontalrückenlagerung“ (Schultz 198217, S. 19; Auslassung: E. K.). Schultz vergleicht die „Liegeübungshaltung“ (ebd., S. 352) mit Savasana (Dead Pose), eine Körperhaltung, die im Yoga zur Entspannung eingenommen wird (ebd.). Die Übungshaltung im Liegen, ist in Abb.4. dargestellt und in ihrer Ausführung beschrieben.

Ausgangshaltung ist die Rückenlage. Die Fersen liegen etwa einen halben Meter weit auseinander, die Fußspitzen fallen entspannt nach außen. Die Arme ruhen in etwa einem viertel Meter Abstand vom Körper, die Handflächen zeigen nach oben. Die Augen sind geschlossen bis dies von einem energisch gedachten Kommando - der sogenannten Zurücknahme wie zum Beispiel „Arme fest! Atmung tief! Augen auf!“ (Kraft 19892, S. 67) beendet, selbst wenn keine Entspannungsreaktion beobachtet wird. Sie sollte immer in der selben Weise erfolgen: „Anspannen der Arm- und Beinmuskulatur (=Zurückführen des neuromuskulären Tonus auf ein Normalniveau)“, „zwei bis drei tiefe Aus- und Einatemzüge“ und „Öffnen der Augen“. Geschieht diese Rückführung auf ein normales Aktivierungsniveau nicht, können Missempfindungen wie Benommenheit, Abgeschlagenheit, Kopfdruck oder Übelkeit die Folge sein (vgl. Vaitl 20002, S. 212).
Als Mindestalter für eine Kursteilnahme wird etwa 6 bis 8 Jahre angegeben. Eine Altersbeschränkung nach oben existiert nicht. Ferner gibt es keine Anforderungen hinsichtlich intellektueller Fähigkeiten. Beispielsweise wurde das Autogene Training mit epileptischen Kindern zwischen 7 und 15 Jahren durchgeführt, wobei „[a]lle unter schweren Anfällen oder epileptischen Verhaltensstörungen [litten]. Wie zu erwarten war, schlug das Verfahren bei den älteren Kindern schneller und besser an, die stärker Intelligenzgestörten lernten langsamer, verwirklichten aber schließlich die Übungen auch, manchmal durch Nachahmung. Der Durchschnitts-IQ war 62 und entsprach demjenigen eines normalen achtjährigen Kindes“ (Kraft 19892, S. 23; Anpassungen: E. K.).
Bezüglich der methodischen Vorgehensweise lassen sich wie bereits angesprochen grundsätzlich zwei Übungskomplexe unterscheiden: der bekannteste und verbreiteste Übungskomplex sind die Standard-Übungen (sogenannte Unterstufenübungen) und die meditativen Übungen (sogenannte Oberstufen-Übungen). Nach Vaitl (20002) basieren sie auf drei Hauptprinzipien: die „Reduktion und Dämpfung extero- und interozeptiver Stimulation, die „mentale Wiederholung psychophysiologisch adaptiver Selbstinstruktionen“ und die „kognitive Aktivität in Form von passiver Konzentration’“ (S. 208). Da das Autogene Training sowohl theoretisch als auch praktisch sehr umfangreich ist, gehe ich im folgenden auf Teilaspekte der Standard-Übungen ein. Diese sind jeweils „nach einem sehr einfachen Schema“ (ebd., S. 213) aufgebaut. Die praktizierende Person spricht sich im Geist bestimmte Formeln vor, die sich direkt auf den zu erwartenden physiologischen Effekt beziehen. So zielt beispielsweise die erste Standardübung (die Schwereübung) auf die neuromuskuläre Entspannung ab, und die entsprechende Formel lautet dann: „Der rechte Arm ist schwer“. Aussagestruktur und Inhalt der Formeln sollen weder Negationen enthalten, noch aktive Anstrengungen der Person betonen. Unterstützende Formeln wie „Ich bin ganz ruhig“ können zusätzlich zu Beginn der Standard-Übungen oder zwischen den einzelnen Übungen angewendet werden. Falls die Person mit den Gedanken abschweift, soll sie wieder zur jeweiligen Formel zurückkommen. Für die schnellere Zielrealisierung ist die Phantasiefähigkeit hilfreich: so kann sich die übende Person bei der Wärmeübung beispielsweise vorstellen, dass sie an einem warmen Sandstrand liegt. Die Übungen sollen zwei bis drei mal täglich (und nicht öfter) ausgeführt werden, wobei anfangs ein bis drei Minuten Übungszeit ausreichen. Wenn alle Übungen beherrscht werden, wird die Übungszeit etwa 20 Minuten pro Übung betragen (vgl. Lindemann 19795; Kraft 19892; Vaitl 20002). Insgesamt benötigt eine Person bei systematischem Üben 6 bis 12 Wochen, bis sie alle Standard-Übungen beherrscht. Dabei gelingen das Umschalten (von der Vorstellung zur Empfindung) und die Generalisierung (Übertragung der Entspannung auf Körperteile, die nicht explizit durch eine Formel angesprochen werden) in der Regel immer schneller und leichter.
Nutzen und Risiken
Die Indikationen im klinischen Bereich, in der Psychotherapie und in der Rehabilitation sind sehr breit gefächert. Empirisch nachgewiesene Erfolge durch das Autogene Training gibt es z.B. bei Störungen der Atemtätigkeit und funktionellen Störungen des Herz-Kreislaufsystems, bei Bluthochdruck, bei Durchblutungsstörungen, zur Schmerzreduktion, bei der Geburtshilfe, und bei Schlafstörungen (ausführlicher dazu vgl. Vaitl 20002; Petermann; Vaitl 1994). Auch für Rehabilitationsmaßnahmen nach Verletzungen, bei Epileptikern, bei behinderten und chronisch kranken Personen zeigt sich das Verfahren als hilfreich. Bei „gesunden“ Personen sind die allgemeinen Wirkungen des Autogenen Trainings „Erholung, Entspannung, Erhöhung der Konzentration sowie eine Resonanzdämpfung überschießender Affekte“ (Kraft 19892, S. 26). Um eventuellen Befürchtungen vorzubeugen sei gesagt: Autogenes Training macht nicht gleichgültig oder gar abgestumpft, sondern gelassen. Es verhindert von vornherein emotionale Dauerspannung, die wiederum funktionelle Störungen und psychosomatische Erkrankungen verursachen kann. Neben längerfristigen positiven Veränderungen habitueller Persönlichkeitsmerkmale (wie z.B. psychotische, neurotische und depressive Tendenzen), beeinflusst das Autogene Training auch das aktuelle Wohlbefinden. In einer Untersuchung an einer Gruppe von Studenten wurde festgestellt: „[d]as Autogene Training hatte einen unmittelbaren Einfluß auf die Befindlichkeit. Nach den Übungen berichteten die Studenten von einem gesteigerten Gefühl von Ruhe, Muße und Ausgeglichenheit, empfanden die nachlassende Anspannung als wohltuend und erlebten eine angenehme Müdigkeit. Auch waren sie am Ende des Trainings mit ihrem Körper zufriedener, hielten sich für genussfreudiger, hatten ein angenehmes Körpergefühl und eine gehobene Stimmung. Gleichermaßen verbesserten sich ihre vegetativen Beschwerden. In der Kontrollgruppe dagegen fanden sich kaum vergleichbare positive Veränderungen des körperlichen Wohlbefindens, dagegen nahmen hier sowohl die psychischen als auch die vegetativen Beschwerden zu, was sicherlich aufgrund der Messungen vor und nach dem Semester bei der Kontrollgruppe einen durch den Studiumsverlauf bedingten Effekt wiederspiegelt“ (Vaitl 20002, S. 243; Anpassung: E. K.).Als Beispiel für den weitreichenden Einfluss des Autogenen Trainings im Alltag, wähle ich folgenden Auszug aus dem Protokoll eines Kursteilnehmers nach Lindemann (19795).
84. Tag: Morgens: Natürlich, es klappte. Der ganze Körper ist Ruhe, Schwere und Wärme. Im Büro bin ich mit Sicherheit ruhiger und ausgeglichener als früher, zu Hause aber leider noch nicht immer. Die Nachmittagsübung erfolgreich in einer Besprechungspause durchgeführt. [...] 99. Tag: Insgesamt fühle ich mich mit dem AT [Autogenen Training] viel besser als ohne Training. Schon wenn ich mir das Wort Ruhe’ vorstelle, bin ich ruhig. Immer wieder merke ich den Erfolg im Dienst, bei ungewöhnlichen Situationen und im Gespräch mit aggressiven Klienten. Aber im Zusammenleben mit meiner Frau erkenne ich, wie schwer es ist in allen Situationen die Ruhe zu bewahren. In den nächsten Kurs schicke ich meine Frau, ich werde auf das Kind aufpassen. Wir hätten tatsächlich beide zusammen hingehen sollen, wie der Doktor es empfohlen hatte. Wenn ich heute nach erst drei Monaten des Übens abwägen soll, wie sich das AT auf mich ausgewirkt hat, so würde ich sagen, der Vorsatz Ich bin vollkommen ruhig und gelassen’ hat sich wortwörtlich verwirklicht; das Zusammenleben mit meiner Frau ist dadurch besser geworden, und das Schlafen ist eine Pracht geworden. – Ich habe die feste Absicht, regelmäßig weiter zu üben (S. 61f.; Auslassung und Einfügung: E. K.).
Während des Autogenen Trainings können formelunabhängige Begleiterscheinungen auftreten. Diese werden auch als „paradoxe Phänomene“ oder „Entladungen“ (Vaitl 20002, S. 235) bezeichnet. Vaitl (20002) unterscheidet motorische (z.B. Muskelzuckungen, Husten, verstärktes Schwitzen), sensorische (z.B. Gefühle des Drehens, Schwebens, Fallens), affektbetonte, psychische (z.B. Liebesbedürfnis, Angstgefühl, Einsamkeitsgefühl) und mentale (z.B. unkontrolliert einströmende Gedanken, Konzentrationsschwierigkeiten, falscher Formelablauf) Begleiterscheinungen (vgl. S. 236f.). Treten die paradoxen Phänomene nur vorübergehend und vereinzelt auf, stellen sie keine Kontraindikation hinsichtlich der Fortführung des Autogenen Trainings dar. Grundsätzlich gibt es nur wenige Kontraindikationen, die die Einleitung und Fortführung des Autogenen Trainings als riskant erscheinen lassen, wie z.B. akute und chronische Psychosen organischer Art (z.B. nach einem Schädelhirntrauma) und endogener Art (z.B. Schizophrenie) (vgl. ebd., S. 250f.). Trotzdem birgt es Gefahren vor allem bei unsachgemäßer Anwendung in sich. Es kommt vor, dass eine Person versucht, es zur Leistungssteigerung (als eine Art Doping-Mittel) über ihre eigentlichen körperlichen und geistigen Grenzen hinaus, zu benutzen. Dies stellt zwar keine akute Gefahr dar, wird aber nicht funktionieren, da das Autogene Training den körperlichen Bedürfnissen zu ihrem Recht verhelfen wird, d.h. bei übermäßiger Belastung und anschließendem Training wird die betreffende Person wahrscheinlich einschlafen (vgl. Kraft 19892). Bedenklich ist es, wenn eine Person bewusst versucht Nebenwirkungen herbeizuführen (z.B. Herztätigkeit oder Atemfrequenz herunterzusetzen). Das Verfahren sollte auch nicht angewendet werden, um der Realität zu entfliehen. Sollten anstehende Probleme nicht selbst bewältigt werden können, ist ein Gespräch mit einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft angezeigt. Der Dozent sollte genügend theoretisches Wissen über und eigene Erfahrung mit dem Autogenen Training haben. Dies gilt vor allem für die angesprochenen Begleiterscheinungen, die von folgenden physiologischen Phänomenen wie starkem Herzrasen, Zittern, Schweißausbrüchen, Ohnmachtsanfällen sowie allen Arten von unerklärbaren Schmerzzuständen, die dauerhaft auftreten, zu unterscheiden sind. Dann ist es angezeigt das Autogene Training abzubrechen (vgl. Vaitl 20002, S. 250). Lernende mit Herzfehlern sollten sehr vorsichtig mit der Herzübung umgehen, oder sie ganz weglassen. Und bei Praktizierenden mit Wirbelsäulen- oder Halswirbelschäden ist die Übung im Liegen vorzuziehen. Allgemein können besonders in der Droschkenkutscherhaltung (aber auch im Liegen z.B. bei einer zu großen Nackenstütze) zeitweilige Muskelverspannungen vor allem im Halswirbelbereich auftreten.
Der Yoga
Geschichtliche Aspekte
Yoga gehört wohl zu den ältesten Praktiken, die auch heute noch als Entspannungsverfahren angewendet werden, gleichwohl seine Bedeutung weit über die reine Entspannung hinausgeht. Die verschiedenen Yoga-Praktiken waren und sind wesentlicher Bestandteil der hinduistischen Religion mit dem höchsten Ziel, den Zustand des Samadhi, die endgültige Befreiung (Moksa), zu erlangen (vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S. 12).
Das Wort Yoga ist ein Nomen der indischen Sanskrit-Sprache, abgeleitet von der Verbalwurzel yuj. Diese Wurzel verweist auf einen sehr alten indogermanischen Stamm, der sich noch heute in vielen indogermanischen Sprachen findet (z.B. lat. iugum, frz. joug, span. yugo, engl. yoke, dt. Joch). Die ursprüngliche Bedeutung der Wurzel yuj liegt im Anschirren der (Zug-) Tiere, im Einspannen unter das Joch. Aus der Urbedeutung des Anjochens ergeben sich zwei Bedeutungen: erstens die Vereinigung (wie man verschiedene Zugtiere unter einem Joch vereinigt) und zweitens die Beherrschung (wie man die Zugtiere durch das Joch beherrscht). Dabei können beide Begriffe sowohl die Methodik als auch das Ziel diverser Yoga-Wege bezeichnen (vgl. Fuchs 1990, S. 11). Der Begriff Yoga ist einer der vielschichtigsten Begriffe der indischen Kultur. Grundsätzlich lassen sich drei Bedeutungsfelder unterscheiden:
- Yoga als Ober- oder Unterbegriff für eine Reihe praktischer Übungs- und Heilstechniken. In dieses Feld passen die meisten der heute bekannten Yogaformen, wie beispielsweise der Hatha-Yoga;
- Yoga als Name für eines von sechs klassischen Systemen der indischen Philosophie. Es beinhaltet in erster Linie die Yoga-Sutren des Patanjali;
- Yoga als allgemeiner Ausdruck für Fertigkeit, Fähigkeit, Technik, Vereinigung. In diesem Zusammenhang tritt Yoga oft als terminus technikus einer bestimmten Fachsprache auf, wie zum Beispiel in der Mathematik als Bezeichnung für die Summe einer Addition (vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S. 3).
Eingang in die vorliegende Arbeit finden die ersten beiden Bereiche: der Hatha-Yoga (als Beispiel für ein praktisches Übungs- und Heilsverfahren im Rahmen der methodischen Vorgehensweise) und die Yoga-Sutren des Patanjali (in einem Exkurs zu philosophischen Aspekten des Yoga). Zunächst erörtere ich jedoch die historische Entwicklung des Yoga und dessen Rezeption in Deutschland. Bögle (1996) führt den Yoga grundsätzlich auf zwei Traditionen zurück: zum einen auf die der indischen Urbevölkerung und zum anderen auf die der arisch-brahmanischen Eroberer (vgl. S. 20). Die Wurzeln des Yoga finden sich bereits in der frühen Hochkultur im Industal (belegt durch Siegelsteine mit Figuren in Yogasitzhaltung) um 7000-2000 vor Christus. In den Stammeskulturen der JägerInnen und SammlerInnen führen intensive Beobachtungen der Tierwelt zu einer Nachahmung von Körperhaltungen, Schamanen praktizieren unter anderem Pranayama (Atemtechniken). Mit der Einwanderung der Arier um 1500-800 vor Christus nach Indien kommt es zu Überlagerungen durch die brahmanische Kultur sowie zu einer gegenseitigen Beeinflussung: das brahmanische und später hinduistische religiöse Verständnis von Yoga, vorrangig am Kontakt zum höheren, wahren Selbst interessiert, vermischt sich mit der Samkhya-Philosophie, die vorrangig daran interessiert ist, Leid durch die „Befreiung der Seele von den Banden der Materie und des Denkens“ (Schultz 198217, S. 351) zu vermeiden (vgl. Bögle 1996, S.11ff.). Im Laufe der Geschichte entsteht eine enorme Vielschichtigkeit, Heterogenität und Variabilität in den Inhalten: unterschiedliche philosophische sowie weltanschauliche Standpunkte finden Eingang in den Yoga. Dabei gibt es eine deutliche Systematik und Ordnung in der Praxis des Yoga: Schritte, Stufen und das Ziel des Yoga-Weges sind bei allen Richtungen gleich (vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S. 13f.). Spezielle Darstellungen eigentlicher Yogaverfahren in der indischen Literatur liegen beispielsweise in der Yoga-Sutra des Patanjali vor. Weitere Darstellungen von Yogaverfahren finden sich in der Hatha-Yoga-Pradipika (1500 n.Chr.) sowie in der Gheranda-Samhita (1600 n.Chr.) (vgl. Schultz 198217, S. 350).
Die Geschichte der Yoga-Rezeption in Deutschland, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts greifbar wird, beginnt bereits früher mit der neuzeitlichen Erschließung des indischen Yoga. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts finden sich in den Aufzeichnungen der Missionare und Kaufleute vermehrt Hinweise auf Fakirismus, worunter auch die indischen Yogis subsumiert werden. Deren westliche Darstellung ist sowohl undifferenziert als auch überwiegend negativ, ihnen wird z.B. eine „unverschämte Dreistigkeit“ (zitiert nach Fuchs 1992, S. 28) nachgesagt. Das Alltagsbewusstsein in Deutschland wird davon zum Teil bis in die Moderne geprägt, selbst in einem Fachbuch über das autogene Training warnt Mensen noch 1997 seine Leserschaft vor einem „psychischen Nährschaden“ und einer „Selbstvergiftung durch unassimilierbare kulturelle Fremdkörper“ durch Yogaübungen (Mensen (1997, S. 198). Seit Mitte des 18. Jahrhunderts bemüht sich die Wissenschaft um dieses Thema durch philologische Arbeiten, die Übersetzung grundlegender indischer Texte, Studien über Yoga und die Errichtung eines Lehrstuhls für Indologie in Bonn (1818). Im 19. Jahrhundert findet mit der Aufnahme des Yoga in die theosophische Philosophie und die Anthroposophie das erste Mal eine organisierte und systematische Rezeption statt. Bedingt durch zahlreiche Schriften über den Yoga, werden zwei grundsätzliche Neuerungen eingeführt: die Weitergabe von Yoga ohne persönlichen Lehrer (Guru) und die Verbreitung des Yoga in und für die Öffentlichkeit. Die Anerkennung der Methoden des Yoga gegen Ende der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts durch die westliche Wissenschaft, führt zu einer immer größer werdenden Popularität der praktischen Ausübung des Yoga (vgl. Fuchs 1992, S. 28ff.). Schultz, der Begründer des Autogenen Trainings bezieht sich in mehreren Publikationen sowie in seinem Grundlagenwerk „Das autogene Training“ direkt auf den indischen Yoga und beschäftigt sich explizit mit dessen Verhältnis zum Autogenen Training (vgl. Schultz 198217, S. 350ff.)
Ein weiterer wichtiger Beitrag für die Aufnahme und die Umsetzung des Yoga in Deutschland ist die Gründung der ersten Yoga-Schule von Boris Sacharow im Jahre 1939 in Berlin. Nach dem zweiten Weltkrieg gibt er Yoga-Kurse und wird bekannt durch seine zahlreichen Publikationen, insbesondere durch die Übersetzung und Interpretation des wichtigen Hatha-Yoga Textes der Gheranda-Samhita. Ab Mitte der 1950er Jahre werden diverse Yoga-Institutionen gegründet: neben weiteren Schulen erstmals private Einrichtungen sowie den Bund der Yoga-Freunde. Außerdem werden einige indische Yoga-Organisationen und -Vertreter aktiv, wie z.B. die Sivananda-Organisation, die das Sivananda-Yoga-Vedanta-Zentrum gründet. Mitte der 1960er Jahre werden der Berufsverband Deutscher Yogalehrer e.V. und die Deutsche Yoga-Gesellschaft gegründet. Ungefähr zehn Jahre später verabschieden sie Rahmenlinien für die YogalehrerInnen Ausbildung, die jedoch bis heute noch nicht staatlich anerkannt und damit ohne allgemeine Rechtsverbindlichkeit für die Berufsausübung ist. Ab 1988 beginnen mehrere Krankenkassen Zuschüsse zu Yoga-Kursen zu zahlen, falls eine erfolgreiche Abschlussprüfung der YogalehrerInnen bei den großen Yoga-Verbänden nachgewiesen wird. Die Weiterbildung der YogalehrerInnen wird zunehmend in die Hände professioneller Pädagogen gelegt, die neue Lehr- und Lerntechniken diskutieren und erproben, sich so z.B. im Gegensatz zu traditionellen Modellen an progressiven Methoden (z.B. TeilnehmerInnenbezogenheit, im Gegensatz zum hierarchischen Lehrer-Schüler Verhältnis des indischen Yoga) orientieren. In den 1990ern haben die Kurse der Volkshochschule den quantitativ stärksten Anteil am Yoga-Unterricht: 750 bundesdeutsche Volkshochschulen bieten 1989 rund 12.600 Yoga-Kurse an, wobei Frauen mit circa 80%, mehrheitlich im Alter von 30 bis 50 Jahren, den weitaus größten Teil der KursteilnehmerInnen stellen (vgl. Fuchs 1992, S. 37ff.). An der Volkshochschule Augsburg werden im Frühjahrs-Semester 2003 insgesamt 34 verschiedene Yoga-Kurse für unterschiedliche Zielgruppen (Anfänger, Fortgeschrittene, Frauen, Senioren, Menschen mit Rückenproblemen u.s.w.) angeboten. Selbst Fitnessstudios (z.B. „Fitness Company“) bieten mehrmals die Woche Yoga-Kurse an, wobei der indische Yoga in diesem Fall eine Veränderung erfährt, insofern, als dass der meditative Aspekt zugunsten des körperlichen Trainings vernachlässigt wird.
Exkurs: Philosophische Aspekte - die Yoga-Sutren des Patanjali
Einer der wichtigsten Grundlagentexte des Yoga sind die Yoga-Sutren des Weisen Patanjali. Sutra bedeutet so viel wie Merksatz oder Ausspruch (vgl. Patanjali 19824, S. 9). Patanjali fasst in den Yoga-Sutren das zu seiner Zeit vorhandene Wissen über den Yoga zusammen und gibt ihm eine Struktur. Die Yoga-Sutren enthalten eine methodische Darlegung über die Natur des Geistes (der unruhig und zerstreut ist), eine Analyse der normalen menschlichen Situation (die von Unklarheit und Leid gekennzeichnet ist) sowie eine Erklärung des achtfachen-Yogaweges (vgl. Patanjali 19824). An dieser Stelle gehe ich auf die Yoga-Sutren ausführlich ein, da sie für den gesamten Yoga bis zum heutigen Tag von Bedeutung sind: sie sind nach Trökes (2000) „zeitlos gültig“ (S. 21). Ich bin mit Trökes (2000) einer Meinung, dass Patanjali „mit psychologischem Blick [diagnostiziert] [...], was den Geist des Menschen unklar macht, was sein inneres Wachstum und seine Selbsterkenntnis behindert, und [...] einen für jeden Menschen nachvollziehbaren Übungsweg auf[weist], diesen Schwierigkeiten zu begegnen“ (S. 17; Anpassungen: E. K.).
Patanjali (19824) stellt gleich zu Beginn der Yoga-Sutren fest, dass die Disziplin des Yoga „jener innere Zustand [ist], in dem die seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe kommen“ (S. 21; Anpassung: E. K.). Der „Sehende“ kann mittels Yoga in seiner „Wesensidentität“ ruhen, ohne sich „durch die Identifizierung mit den seelisch geistigen Vorgängen“ aus der Ruhe bringen zu lassen (ebd.). Der Geist einer Person ist demnach ständig beschäftigt: nicht nur mit dem, „was gerade anliegt“, sondern auch mit der Verarbeitung von Sinneseindrücken. Dazu beschäftigen ihn sowohl Vergangenes als auch Zukünftiges (vgl. Trökes 2000, S. 21). Dass der Geist permanent beschäftigt ist, soll an folgendem verdeutlicht Beispiel werden.
Bsp.5.: Die permanente Beschäftigung des Geistes Eine Person steht an einem heißen Sommertag an einer verkehrsreichen Kreuzung: sie will die Straße überqueren und wartet bis die Fußgängerampel auf Grün umschaltet. Neben ihr stehen mehrere Personen. Hinzu kommt noch ein Fahrradfahrer in schnellem Tempo, der mit quietschenden Bremsen neben der besagten Person anhält. Viele verschiedene Reize (Stressoren), wie Hitze oder Lärm, strömen auf sie ein. Außerdem erschrickt sie für einen Moment, als der Fahrradfahrer unerwartet neben ihr auftaucht. Sie erinnert sich daraufhin an ein lang zurückliegendes Erlebnis: sie hatte vor einigen Monaten (in einer ähnlichen Situation) eine Person mit dem Fahrrad angefahren, weil die Bremsen versagten. Dabei fällt ihr ein, dass sie ihr Fahrrad demnächst mal wieder überholen muss. Sie überlegt sich, wann sie diesen weiteren Termin einschieben kann. Dies geschieht alles gleichzeitig mit dem „was anliegt“, nämlich sich auf das Umschalten der Ampel zu konzentrieren. Wegen der Reizüberflutung verpasst sie die Grünphase und reagiert mit Emotionen, wie Ärger und Wut.
Es gibt mehrere Gründe, die eine Person daran hindern, ruhiger, klarer und zufriedener zu werden. Nach Patanjali sind es fünf Hindernisse, die Kleshas (Schmerz, Kummer, Leid).
- „Falsches Wissen“ (Trökes 2000, S. 22; Hervorhebung: E. K.) ist das Hauptklesha. Es bezieht sich darauf, dass die Wahrheit immer subjektiv ist. „Unser Wissen ist geprägt durch unsere Erziehung, unsere Erfahrungen, unsere Weltsicht und unsere Glaubenssätze“ (ebd.). Hier zeigt sich meiner Meinung nach eine deutliche Parallele zur konstruktivistischen Erkenntnistheorie. Diese besagt im Kern, dass sich eine Person aufgrund von gemachten Erfahrungen immer in Vorurteilen bewegt, die Strukturen des Denkens also nicht objektiv sein können. Der Blick auf die Wirklichkeit ist also subjektiv gefärbt, und im Prinzip erfindet eine Person „die Realität“ nur, was bedeutet, dass die Wirklichkeit ein höchst individuelles Konstrukt darstellt (vgl. Watzlawick 200113).
- Das nächste Klesha ist die „falsche Einschätzung der eigenen Person/des Egos“ (Trökes 2000, S. 22; Hervorhebung: E. K.). Es kommt zustande durch die Fremdbeurteilungen, denen eine Person von Geburt an ausgesetzt ist, und nach denen sie ihr Selbstbild konstruiert. Im schlimmsten Fall identifiziert sie sich mit negativen Eigenschaften und Merkmalen, die ihr zugeschrieben werden und übernimmt diese in der Folge. Die pädagogische, psychologische und soziologische Fachliteratur spricht in diesem Zusammenhang von Etikettierungsprozessen (vgl. Keller; Novak 19932, S. 132).
- Das „drängende Verlangen, etwas haben zu wollen“ (Trökes 2000, S. 22; Hervorhebung: E. K.) ist das dritte Hindernis und bezieht sich zum einen auf das Grundbedürfnis einer jeden Person nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zuwendung und Liebe. Damit sind aber auch Bedürfnisse materieller Art gemeint. Gerade im Deutschland des 21. Jahrhunderts, werden Bedürfnisse jeglicher Art geweckt. Eine Person versucht diese zu befriedigen, was allerdings keineswegs zu mehr innerer Ruhe und dauerhaftem Glück führt. „Rastloses“ Konsumverhalten kann ganz im Gegenteil zu physischem und psychischem Stress führen (ich denke da z.B. an volle Kaufhäuser und eine Masse schlechtgelaunter Personen).
- Das „Nicht-Haben-Wollen“ (Trökes 2000, S. 23; Hervorhebung: E. K.) meint, dass eine Person beträchtliche Energien dafür aufwendet, Unangenehmes zu vermeiden und Schutzschilde um die Seele aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Dieses Hindernis gleicht meiner Meinung nach dem von Freud eingeführten Begriff der Verdrängung. Freud bezeichnet damit „den Prozeß, durch welchen eine Person sich vor der Erinnerung an nicht annehmbare oder schmerzhafte Information schützt, indem sie sie aus dem Bewusstsein verstößt“ (Zimbardo 19956, S. 341). Er geht aber, im Gegensatz zu Patanjali davon aus, dass eine Person dadurch ihren Seelenfrieden erlangt.
- Das letzte der fünf Kleshas, ist die „Angst [...], das Hindernis, das am tiefsten in uns verwurzelt ist“ (Trökes 2000, S. 24; Anpassung und Hervorhebung: E. K.). Gemeint ist insbesondere die Angst vor dem Tod, ferner die Angst davor, nicht geliebt zu werden, aber auch Ängste auf die Ungewissheit der Zukunft bezogen. Der Fluss des Lebens bringt einen ständigen Wandel mit sich. Beispielsweise dokumentiert die familienpsychologische und familiensoziologische Forschung seit geraumer Zeit einen tiefgreifenden Wandel familiärer Strukturen und Beziehungen als Teil umfassender gesellschaftlicher Veränderungen. Quantitative Daten, wie beispielsweise die kontinuierlich sinkende Geburtenrate (von 2,37 Kindern pro Frau im Jahr 1960 auf 1,39 Kinder pro Frau im Jahr 1996) oder die hohe Scheidungsrate (im Jahr 2002 bei ca. 40% liegend), belegen die Auswirkungen einer Pluralisierung der Lebensstile, einer Diskontinuität in der familialen Entwicklung und der Schwierigkeit der Bewältigung von Belastungen, die aus normativen Lebensereignissen, wie dem Übergang zur Elternschaft, resultieren (vgl. Fthenakis 2000).
Der erste Schritt, die Wirkung der Kleshas abzuschwächen, ist eine ständige Achtsamkeit zu entwickeln. Eine Person soll nach Patanjali irritierende Situationen und damit auch das entsprechende Reiz-Reaktionsschema bewusst verlassen (innehalten) (vgl. Trökes 2000, S. 24). Damit kann sie quasi auf einer Metaebene über den Grund ihrer Irritation reflektieren. Die Kunst auf einer Metaebene über Störungen nachzudenken, wird auch in der modernen pädagogischen Literatur beschrieben, z.B. von Friedemann Schultz von Thun (20018).
Das Thema Achtsamkeit findet sich auch in modernen (westlichen) psychologischen Sachbüchern wieder. Beispielsweise stellt Schaufler (2000) in ihrem Buch „Frauen in Führung!“ Achtsamkeit in Zusammenhang mit Stressbewältigung. Sie weist darauf hin, Achtsamkeit bedeute „sich in acht nehmen vor Überlastung und auf das eigene Wohlbefinden achten“ (S. 125). Dazu gehöre sowohl auf die innere Stimme zu hören, als auch die Signale des Körpers zu deuten (vgl. ebd.). Patanjali stellt klar, dass sich keines der fünf Hindernisse auf dem Weg zu mehr Ruhe, Klarheit und Gelassenheit jemals völlig beseitigen lässt. Der bewusste Umgang mit ihnen trägt jedoch dazu bei, sie abzuschwächen. Das Konzept der kleshas ist laut Trökes (2000) „ein wirkungsvolles Mittel [...] unseren Geist und unser Handeln zu klären und zu versuchen, zukünftiges Leid für uns und andere zu erkennen und zu vermeiden“ (S. 24; Auslassung: E.K.). Insofern trägt dieses Konzept auch zur Vermeidung von Distress bei. Eine Person muss dafür lernen, den analytischen Teil ihres Verstandes gezielt und konstruktiv einzusetzen, um zu unterscheiden und zu differenzieren.
Das Erlernen der Unterscheidungsfähigkeit ist ein Prozess, der einmal in Gang gesetzt, ein Leben lang anhalten wird. Dieser Gedanke entspricht dem Konzept des „Lebenslangen Lernens“, das ebenso in der Pädagogik des 21. Jahrhunderts gefordert wird. In einer postmodernen Gesellschaft, gekennzeichnet durch rasche Veränderungen (z.B. im Bereich der Technik), ist es eben auch für Erwachsene wichtig weiterzulernen, allein schon um einen Arbeitsplatz zu sichern oder zu bekommen. Um diesen Lernprozess zu unterstützen, hat Patanjali ein methodisches Vorgehen entwickelt, den „achtfache[n] Yogaweg (astanga yoga)“ (Patanjali 19824, S. 116; Anpassung: E. K.). An dieser Stelle sei ausdrücklich betont, dass der Yoga keine Lehre, sondern eine Methode ist. Sie lässt sich mit unterschiedlichen Lehren und Inhalten verbinden und ist insofern tolerant. Der Indologe Erich Frauwallner (1953) drückt dies in seiner Definition von Yoga wie folgt aus: „Unter Yoga versteht der Inder das Streben, vermittels systematischer Schulung des Körpers und des Geistes auf dem Wege innerer Sammlung durch unmittelbares Schauen und Erleben die erlösende Erkenntnis oder die Erlösung selbst zu erlangen. Es ist also keine Lehre, sondern eine Methode, und kann als solche mit den verschiedensten Lehren in Verbindung treten“ (S. 133). Gleichzeitig birgt diese Definition einen hohen Anspruch des Yoga in sich. Er dient „dem höchsten Ziel des Menschen: seiner spirituellen Selbstverwirklichung“ (Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S. 1). Die acht Stufen des Patanjali sind wie eine Treppe miteinander verbunden, so dass eine auf der anderen aufbaut. Damit ist jede Stufe unverzichtbar, keine ist besser oder wertvoller als eine andere. Bei diesem Modell handelt es sich gleichzeitig um einen Kreis (mandala), vorstellbar als ein „Kreislauf [...], genauer eine Ellipse, ein Gefüge, in dem wir uns bewegen und Kraft und Dynamik entwickeln können. In diesem gibt es aufwärts- und abwärtsstrebende Ströme. Ihr geordnetes Zusammenwirken macht uns dem Weg zum Höchsten und die Rückkehr in noch unbewegte Tiefenschichten sicher und leicht“ (Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S. 75). Den achtgliedrigen Yoga-Weg nach Patanjali (19824, S. 115ff.) stelle ich zusammengefasst in Abb.5. graphisch dar.
- 8. Samadhi: Einssein
- 7. Dhyana: Meditation
- 6. Dharana: Konzentration
- 5. Pratyahara: Zurückziehen der Sinne
- 4. Pranayama: Atemregulierung
- 3. Asana: rechte Körperhaltung
- 2. Niyama: Umgang mit sich Selbst, Reinheit, innere Ruhe, stetiges Bemühen, Selbstentwicklung, Hingabe an das Göttliche
- 1. Yama: Umgang mit der Welt, Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nicht-Stehlen, reiner Lebenswandel, Nicht-Besitzergreifen
Abb.5.: Stufenmodell: Der achtgliedrige Yoga-Weg nach Patanjali (19824, S. 115ff.) Im Rahmen dieser Diplomarbeit setze ich in den nächsten beiden Abschnitten (5.3.2; 5.3.3) den Fokus auf die dritte und vierte Stufe des vorgestellten Yoga-Pfades: die Körperhaltungen (Asanas) und die Regulierung des Atems (Pranayama), da sie zentrale Elemente des Hatha-Yoga darstellen.
Methodische Vorgehensweise
Grundsätzlich werden verschiedene Yogaarten unterschieden: „Der berühmte indische Yogin Svami Vivekananda (1863-1902) [...], nennt vor allem vier Hauptwege des Yoga: den Karma-Yoga (Yoga der Arbeit/des Tuns), den Jnana-Yoga (Yoga der Erkenntnis), den Bhakti-Yoga (Weg der Liebe/der Hingabe), und den Raja-Yoga (Yoga der Beherrschung). Eine spätere Entwicklung der indischen Kultur ist der – heute im Westen so populäre – Hatha-Yoga (Yoga der Kraft/des Impulses)“ (Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S.1). Der Begriff Hatha-Yoga taucht zum ersten Mal zwischen dem 9. und 12. Jh. in Nordindien auf und wird bald zum Oberbegriff für ein ganzes System tantrisch beeinflusster, körperbezogener Yoga-Praktiken (vgl. ebd., S. 11).
Das Wort Hatha (wörtlich Gewalt, gewaltsame Anstrengung) setzt sich zusammen aus den Silben ha (Sonne) und tha (Mond). In der Kombination mit dem Begriff Yoga ist es (im übertragenen Sinne) als die Vereinigung von Sonne und Mond zu verstehen (vgl. Eliade 1977, S. 238). Sonne und Mond stehen für die verschiedenen Seiten in einer Person, die sich unter anderem in zwei Energiebahnen (Nadi) zeigen, aber auch in jeglicher Trennung, zum Beispiel zwischen Geist und Körper oder Atem und Seele. Nach hinduistischem Glauben bilden die Knotenpunkte der beiden wichtigsten Energiebahnen (Ida und Pingala), durch welche die Lebensenergie (Prana) fließt, die sieben Chakren. Sie sind die Energiezentren einer Person und liegen alle auf der Wirbelsäulenachse vom Steißbein bis zum Scheitel. Der Hatha-Yoga umfasst Asanas (Yoga-Stellungen), Pranayama (Atemübungen) und Tiefenentspannungstechniken. Außerdem gibt es im Hatha Yoga Ratschläge für eine gesunde Lebensführung, u.a. vegetarische Vollwerternährung.
Wie bereits in den Kapiteln über die Progressive Muskelentspannung und das Autogene Training, gehe ich auch in diesem Kapitel über den Yoga nur auf Teilaspekte des Hatha-Yoga ein, denn gerade hier gibt es eine Vielzahl von Körperhaltungen. Beispielsweise zeigt B.K.S. Iyengar in seinem Buch „Licht auf Yoga“ (1965) alleine 200 Haltungen plus Varianten. Patanjali hingegen spricht nur von einer einzigen Haltung, dem Lotossitz. Er beschreibt ihn im Sutra 46 so, dass daraus die Qualitätsmerkmale für alle anderen Asanas abgeleitet werden können: „Die Sitzhaltung soll fest und angenehm sein“ (Patanjali 19824, S. 121). Die Körperhaltung ist also durch zwei Qualitäten gekennzeichnet: Sthira (Weichheit und Leichtigkeit) und Sukha (Stabilität, Festigkeit und Konzentration). Die Gleichzeitigkeit von Konzentration und Wohlbefinden, von Stabilität und Weichheit, ist die Grundlage der Asanas, die mit dem Doppelwort Sthirasukha begrifflich gefasst wird (vgl. Trökes 2000, S. 26). Die Yogastellungen sollen den Körper in einen ausgewogenen Zustand zwischen fehlender Spannung und Verspannung führen. Die Regungslosigkeit in der Haltung soll dem Geist helfen, ebenfalls still zu werden. Sie dient der Sammlung und Zentrierung einer Person und ist insofern genau „das Gegenteil, von dem, was wir sonst den ganzen Tag über machen: unaufhörlich geistig in Bewegung sein“ (Trökes 2000, S. 26). Demnach stellen grundsätzlich alle Asanas eine wirksame Maßnahme der Stressbewältigung dar, indem sie den Geist beruhigen. Dabei steht nicht ausnahmslos die äußere Form der jeweiligen Haltung im Vordergrund, sondern auch welches Gefühl und welche Einstellung eine Person dazu entwickelt. Sthirasukha lässt sich vor allem dadurch erreichen, dass man sich während der Übung auf den Körper, den Atem und den Geist konzentriert und sie zu einer harmonischen Einheit verbindet. Die bewusste Verbindung von Atem, Bewegung und geistiger Einstellung sollen folgende Übungen verdeutlichen.

Ausgangshaltung ist der aufrechte Stand. Das Gewicht wird im Stand auf das linke Bein verlagert. Das rechte Bein wird angewinkelt und aus dem Hüftgelenk nach außen gedreht. Mit der rechten Hand wird von vorne das rechte Fußgelenk umfasst und der Fuß so weit wie möglich an die Innenseite des linken Oberschenkels nach oben gezogen. Dabei drückt der Fuß gegen den Oberschenkel und umgekehrt. Die Hände werden mit dem Ausatmen vor der Brust aneinandergelegt und dann mit dem Einatmen nach oben über dem Kopf ausgestreckt. Danach wird das Standbein gewechselt und die Asana wiederholt. Geistige Entsprechung: Ich bin im Gleichgewicht.

Ausgangshaltung ist die Rückenlage. Die Arme sind neben dem Körper ausgestreckt und die Handflächen drücken gegen den Boden. Mit dem Einatmen werden die aneinandergedrückten Beine nach oben gestreckt. Danach wird der Rumpf gehoben. Dabei wird er mit den Händen in der Nierengegend gestützt, wobei die Daumen zum Bauch und die Finger zum Rücken weisen. Rumpf und Füße stehen in einer Linie senkrecht nach oben. Das Gewicht des Körpers ruht auf den Schulterblättern und den Oberarmen. Geistige Entsprechung: Ich sehe alles aus einem neuen Blickwinkel.
Ausgangshaltung ist die Sitzhaltung (z.B. Schneidersitz) mit aufgerichtetem Oberkörper. Die Nasenlöcher werden abwechselnd mit rechtem Daumen und Ringfinger geschlossen. Erst wird links eingeatmet, dann der Atem angehalten und schließlich rechts ausgeatmet, wobei das zeitliche Verhältnis Einatmen:Anhalten:Ausatmen 2:8:4 beträgt. Im Anschluss daran wird rechts eingeatmet, dann die Luft angehalten und schließlich links ausgeatmet. Eine Runde Wechselatmung besteht aus diesen sechs Schritten. Anfänger beginnen mit 10 Runden und steigern sie allmählich auf 20 Runden (vgl. Bund der Yoga Vidya Lehrer 20006, S. 115).
Grundsätzlich können alle Körperhaltungen nach ihren Ausgangspositionen kategorisiert werden: im Stehen (z.B. Berg, Baum), in der Rückenlage (z.B. Savasana), in der Bauchlage, in der Umkehrhaltung (z.B. Kerze), im Knien und im Sitzen (vgl. Ebert 1986). Außerdem wird allen Übungen eine energieaufbauende, eine energieneutrale oder eine energieabbauende Wirkung zugesprochen und gemäß des jeweiligen persönlichen Zustandes (z.B. Stress) eingesetzt. Prinzipiell ist eine unbegrenzte Anzahl von Stellungen möglich. Diese können in einer dynamischen Bewegungsfolge aneinander gereihter Stellungen (z.B. Sonnengruß=Suryanamskar) oder als primär statische, sogenannte verharrende Übung, durchgeführt werden (vgl. Lysebeth 1970). Da Anatomie, Bedürfnisse und Voraussetzungen von Personen individuell verschieden sind, kann eine bestimmte Asana für eine Person geeignet, und für eine andere kontraindiziert sein. Das ist ein Grund dafür, dass das Erlernen des Yoga bei einer qualifizierten Lehrerin oder einem qualifizierten Lehrer, die individuell geeignete Asanas auswählen, in jedem Fall z.B. Büchern vorzuziehen ist.
Bezüglich der Übungsdauer werden in der Literatur unterschiedliche Angaben gemacht. Einmal täglich 10 Minuten werden dabei aber generell als Minimum empfohlen. Größtenteils werden jedoch ein- bis zweimal täglich 20-30 Minuten angegeben, wobei morgens und abends (bei Sonnenauf- und untergang) die günstigsten Zeiten sein sollen. In den meisten Praxishandbüchern wird zu Beginn und vor allem am Ende jeder Yoga-Übungseinheit die sogenannte „Tiefenentspannung“ (ca. 10-15 min.) empfohlen. Dabei liegt die Person in Savasana (s.5.2.2) und entspannt systematisch alle Teile des Körpers und schließlich auch den Geist. Ein Grundverständnis für das Hatha-Yoga kann eine Person bereits nach 6 bis 8 Wochen erlangen. Yoga ist jedoch ein Entspannungsverfahren und gleichzeitig eine Philosophie, bei der eine Person bis zum Lebensende nie auslernt.
Nutzen und Risiken
Ein zentraler Gesichtspunkt des Hatha-Yoga, ist die Flexibilität des Körpers zu erhalten bzw. wiederzugewinnen. Während beim Kleinkind der Körper noch sehr biegsam und elastisch ist, setzt mit zunehmendem Alter eine Versteifung der Bänder und eine Verkürzung der Muskeln ein. Dieser natürliche Prozess kann durch die Asanas auf ein Minimum reduziert werden, der Körper bleibt bis ins hohe Alter elastisch und vital (vgl. Vishnudevananda 1984). Der vierfachen Wirbelsäulenkrümmung (in Hals-, Brust-, Lenden- und Beckenbereich), die für Spannkraft und Belastbarkeit sorgt, kommt dabei besondere Bedeutung zu. Beispielsweise beugen Personen, die lange Zeit sitzend verbringen, oft den Kopf und Nacken nach vorne, wodurch sich die Bänder im Rücken- und Nackenbereich langsam versteifen und der Rücken sich rundet. Schulter- und Nackenverspannungen oder Wirbelsäulenverkrümmungen, aber auch Kopfschmerzen können die Folge sein. Die verschiedenen Yogaübungen unterscheiden sich „von sonstigen Haltungen dadurch, dass sich extreme Gelenkstellungen und Muskeldehnungen ergeben und Körperpositionen eingenommen werden, die unter natürlichen Bedingungen nicht vorkommen“ (Ebert 1986, S. 57). Somit ist es möglich, die Flexibilität der Bänder und die ursprüngliche Krümmung der Wirbelsäule zu erhalten bzw. in gewissen Grenzen wiederzuerlangen.
Die Erlangung einer natürlichen Spannkraft (Eutonie) und die Steigerung von Kraft und Ausdauer sind weitere positive Aspekte der Übungen. Durch die vielseitigen starken Streckungen und Dehnungen bei den Yoga-Übungen und durch abwechselnde Entspannungs- und Anspannungsübungen wird die Wahrnehmung der eigenen Körperspannung gesteigert, erschlaffte Muskulatur gestärkt und verhärtete Muskulatur gedehnt. Ein Ziel des Yoga ist es, den ganzen Tag über ein ausgewogenes Mittel zwischen Trägheit und Anspannung zu erreichen. Angenehme Wohlanspannung (Sattwa), eine verbesserte Körpersensibilität und eine erhöhte allgemeine Entspannungsfähigkeit, die nach einigem Üben auch willentlich hervorgerufen werden kann, sind die Folge (vgl. Vishnudevananda 1984). Besonders bei den verharrenden Übungen wird die Muskelkraft und Durchblutung gefördert, was die Herztätigkeit anregt und allmählich das Herz kräftigt.
Durch die Vertiefung der Atmung bei gleichzeitiger Anregung des Blutkreislaufs gelangt mehr Sauerstoff in den Körper. Kohlendioxid und toxische Stoffe im Blut werden schneller abgebaut. Außerdem hemmt das sauerstoffreichere Blut bei Bewegung die Produktion von Milchsäure in den Muskeln, was Ermüdung vorbeugt. Die Drehungen, Beugungen und Streckungen sowie die Bauchatmung bei den Asanas und Pranayama (Atemübungen) bewirken außerdem eine Massage und stärkere Durchblutung der Lungen und der anderen inneren Organe, was ihre Funktionsfähigkeit steigert (vgl. ebd.). Darüber hinaus wird in der Literatur von einer Harmonisierung der Hormondrüsen (Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebennieren, Hypophyse sowie Geschlechtsdrüsen) berichtet. Somit ist es beispielsweise möglich, eine Unterfunktion der Schilddrüse, die sich in Verdauungsbeschwerden, Schlaflosigkeit, Nervosität, schnellem Puls, Herzklopfen, übermäßiger Schweißabgabe, Zittern und Gewichtsverlust äußern kann, zu verhindern (ebd., S. 70).
Das Bewusstsein wachsender Flexibilität, Kraft, Belastbarkeit und das verbesserte Gefühl für den eigenen Körper wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus. Neue Selbstsicherheit und neues Selbstvertrauen entstehen und helfen somit z.B. Verhaltensunsicherheiten oder Angstzustände zu verringern. Hinzu kommen eine größere Achtsamkeit gegenüber sich selbst und anderen, mehr Ausgeglichenheit und innere Ruhe und eine deutlich bessere Konzentrationsfähigkeit, wovon wiederum das unmittelbare Umfeld profitieren kann. Insgesamt wirkt sich Hatha-Yoga, konstant praktiziert und richtig angewandt, positiv auf die ganze Persönlichkeit aus und beeinflusst in der Regel auch die gesamte Lebensweise (wie z.B. eine gesündere Ernährung) des Übenden.
Im Folgenden gehe ich auf die körperlichen und psychischen Wirkungen der von mir unter 5.3.2 vorgestellten Asanas (Baumstellung, Kerze) und der Wechselatmung ein. Dabei handelt es sich um bewusst ausgesuchte Übungen, die meiner Meinung nach besonders geeignet sind, Stress zu bewältigen.
- Baumstellung
Aus medizinischer Sicht steigert der Baum die Hirnaktivität und verbessert das Gleichgewichtsgefühl. Diese Asana trägt weiterhin zu einer harmonischen Ausbildung sowie einer Kräftigung der Beinmuskulatur bei. Die Beine werden besser durchblutet. Außerdem macht die Baumstellung Schultern-, Hüft-, Knie- und Knöchelgelenke geschmeidig und kräftig (vgl. Jacquemart; Saida 1996, S. 122). Das äußere Gleichgewicht entspricht dem inneren Gleichgewicht. Diese Haltung erfordert eine hohe Konzentration, weswegen sie „den zerstreuten Geist sammeln und dem Menschen die Möglichkeit [geben soll], sich wieder in seiner Mitte und damit in seinem Gleichgewicht zu finden“ (Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S. 138; Anpassung: E. K.).
- Kerzenstellung
Der Schulterstand lässt sich grundsätzlich in die Kategorie der Umkehrhaltungen (Viparita Karani Mudra) einordnen. Viparita heißt „nach Innen gekehrt, umgekehrt“. Viparita Karani meint also eine Körperhaltung, in der sich der Praktizierende zurückzieht oder in die Umkehr begibt. Unter diesem Namen werden im Yoga alle Haltungen zusammengefasst, in denen sich der Kopf tiefer als der Nabel befindet (vgl. Trökes 2000, S. 84). Sarvangasana (sarva=ganz, anga=Körper) bedeutet auf sanskrit „Asana des ganzen Körpers“ (Yesudian; Haich 197220, S. 208), da sich ihre Wirkung auf den ganzen Körper erstreckt. Auf physiologischer Ebene bewirkt die Umkehrhaltung, dass der gesamte Blutkreislauf und das Herz entlastet wird. Die Beine und der Beckenboden werden von venösem Blut und Lymphe entstaut. Die Durchblutung im Kopf (z.B. der Augen, der Schleimhäute und der Haut) wird verbessert (vgl. Trökes 2000, S. 86). Aus medizinischer Sicht wirkt die Kerze ferner belebend und vertreibt sowohl nervös bedingte als auch physische Erschöpfung. Sie beseitigt den durch Blutandrang verursachten Kopfschmerz. Durch die Kerze wird das Einschlafen und Durchschlafen erleichtert. Außerdem zeigt sie gute Wirkungen bei einer Reihe pathologischer Zustände, z.B. des Herzens (Herzklopfen), der Atemwege (Asthma), des Halses (Angina) sowie der Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen, deren Funktion sie anregt (vgl. Jacquemart; Saida 1996, S. 152). Zusätzlich erhält der Schulterstand die Flexibilität der Wirbelsäule und löst Nackenverspannungen auf (vgl. Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S. 175). Dieser Asana wird nachgesagt, sie sei die „vollkommenste verjüngende und nervenberuhigende Übung“ (Yesudian; Haich 197220, S. 212). Die Kerze wirkt auf den ganzen Organismus beruhigend und „kann auch nach einem anstrengenden Tag geübt werden, um zu neuer Energie zu kommen“ (Bund der Yoga Vidya Lehrer 20006, S. 175). Insofern stellt sie eine besonders geeignete Übung zur Stressbewältigung dar.
Der Schulterstand vermittelt ein Gefühl der Ganzheit. Dies wird durch den Namen Sarvangasana zum Ausdruck gebracht (s.5.3.2). Die Ausführung der Übung trägt dazu bei „sich [...] so zu akzeptieren wie man ist“ (Bund der Yoga Vidya Lehrer 20006, S 176; Auslassung: E. K.). Die Umkehrhaltung stellt nicht nur im Körper „alles auf den Kopf“, sondern sie lässt einen auch die gewohnte Umgebung mit anderen Augen sehen. Eine Person wird dadurch ermutigt, auch für andere gewohnte Dinge, Menschen, Situationen und Handlungsschemata neue Blickwinkel auszuprobieren. „In die Haltung der Umkehr zu gehen, bedeutet auch, eingefahrene Verhaltensweisen wie z.B. Arbeitssucht, Hektik [...] aufzugeben und etwas Neues auszuprobieren [...]. So ist die Umkehrhaltung ein wichtiger Moment des Innehaltens im geschäftigen Treiben des Lebens, der einem die Möglichkeit gibt, die momentane Situation zu überdenken, neue Entscheidungen zu treffen, zu sich zu kommen und die geistige Flexibilität zu bewahren“ (Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S. 134; Auslassungen: E. K.). Während eine Person den Schulterstand hält, kann sie sich beispielsweise vorstellen, wie viel und was sie „auf den eigenen Schultern“ mit sich herumträgt. Wenn sie sich beim Hinausgehen aus der Position auf Fragen wie „welche Last kann ich ablegen“ oder „welche Bürde geht mich nicht mehr an“ konzentriert (Sivananda 1991, S. 71ff), kann sie meiner Meinung nach dazu angeregt werden, sich selbst zu reflektieren. Selbstreflexion ist eine wichtige Voraussetzung zur kognitiven Stressbewältigung.
- Wechselatmung
Die Wirkungen der Wechselatmung auf körperlicher Ebene sind vielfältig. Beispielsweise trägt sie zu einer Erhöhung der Lungenkapazität bei und dazu, die Atmung unter Kontrolle zu bringen. Gerade die Perioden des Atem-Anhaltens sind ein gutes Training für Herz und Kreislauf. Sie wirkt zudem gegen Allergien, Heuschnupfen und Asthma. Des Weiteren beugt sie Erkältungskrankheiten vor. Die Wechselwirkung wirkt grundsätzlich harmonisierend auf alle Körpersysteme. Auf psychischer Ebene fördert die Wechselatmung die Konzentrationsfähigkeit. Zudem wirkt sie beruhigend: „Wechselatmung hilft, zur inneren Ruhe und Kraft zu finden. Emotionelle Ungleichgewichte werden umgewandelt in das ruhige Gefühl der Stärke und Kraft“ (Bund der Yoga Vidya Lehrer 20006, S. 174).
Obwohl nach neueren Schätzungen über drei Millionen Personen in Deutschland Yoga praktizieren (s.1), existieren zu diesem Verfahren im Vergleich zur Progressiven Muskelentspannung und zum Autogenen Training weit weniger empirische Studien. Was Untersuchungen zu physiologischen Veränderungen und klinische Effektivitätsstudien betrifft, wird Yoga meist als Vergleichskomponente zu einer der beiden Entspannungsmethoden angeführt. Da der Hatha-Yoga Elemente der Progressiven Muskelentspannung und des Autogenen Trainings enthält, ist es nicht verwunderlich, dass sich empirische Ergebnisse dazu im Wesentlichen gleichen (vgl. Bösel 1978; Vaitl; Petermann 20002). Die Vernachlässigung des Yoga im klinischen Bereich erklärt sich mitunter dadurch, dass es dort aufgrund seiner Komplexität seltener Anwendung findet.
Grundsätzlich kann jeder Hatha-Yoga-Übungen ausüben. Probleme treten dann auf, wenn die Übungen unsachgemäß angewandt werden oder der Praktizierende seine eigenen Fähigkeiten überschätzt. Die Asanas müssen von Anfang bis Ende langsam und bedächtig ausgeführt werden, die Dehnung und Streckung spezieller Muskelgruppen, Wirbel und Gelenke darf nicht an die Schmerzgrenze gehen, und verharrende Übungen sollten nicht länger als angegeben gehalten werden. Geschieht das nicht, können Zerrungen, zusätzliche Verhärtungen und Verspannungen der Muskeln, überdehnte Bänder, eingeklemmte Nerven, herausgesprungene Wirbel, Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen die Folge sein (vgl. Lysebeth 1970).
Individuelle körperliche Einschränkungen, seien es Ungelenkigkeit, Behinderungen oder diverse körperliche (auch chronische) Krankheiten können jedoch Gegenindikationen bei manchen Asanas hervorrufen. An diese sollte dann nur sehr vorsichtig mit Hilfe von Vorübungen oder einer einfacheren Variante (falls vorhanden) herangegangen werden. Manchmal sollte auf bestimmte Stellungen ganz verzichtet werden. Das gilt vor allem für die schwierigen Fortgeschrittenen-Übungen, die man teilweise erst nach jahrelanger Praxis beherrscht. Ein übereifriger Anfänger, der sich für sportlich und gelenkig hält, sollte dies beachten (vgl. Lindemann 19795). Für Ungeübte ist beispielsweise der Lotossitz problematisch. Der Anfänger ist diese extreme Variante des Schneidersitzes nicht gewohnt und sollte deshalb eine bequemere Sitzhaltung vorziehen. Wer sich mit Gewalt in diese Position „zwängt“, riskiert schmerzhafte Knie- oder Fußverletzungen (vgl. Trökes 2000, S. 7).
Beim Kopfstand (Shirshasana), eine klassische Yoga-Stellung, sind die Gegenindikationen weniger einschneidend als man vermuten könnte. Dazu Lysebeth (1970): „Persönlich haben wir nie ungünstige Resultate festgestellt, obwohl wir Hunderte von Menschen Yoga gelehrt haben, selbst Personen über 60 Jahre. Hier ist alles eine Frage des Maßes und des gesunden Menschenverstandes. [...] Es ist klar, daß, wenn die Arterien und die kleinen Blutgefäße des Gehirns verkalkt sind, man auf die Übung verzichten muß. Dasselbe gilt bei krankhaften Veränderungen der Halsschlagader oder bei sehr hohem Blutdruck. Selbst dann ist aber die Gefahr gering, denn eindeutige Warnzeichen informieren jeden Betroffenen, wenn er mit Yoga beginnt“ (Lysebeth 1970, S. 246; Auslassung: E. K.). Mit Warnzeichen sind Ohrensausen, starke Kopfschmerzen und Schwindelanfälle gemeint. Bei der Kerzenstellung, einer Variante des Kopfstandes, verhält es sich genauso. In diesem Zusammenhang weist Lysebeth auf Leiden hin, bei denen die beiden Stellungen nicht ausgeübt werden sollen, wie z.B. Mittelohrentzündungen, Zahnabszesse, Angina, Schilddrüsenleiden, Stirnhöhlenentzündungen, Sklerose der Hirngefäße oder schwache Halswirbel (vgl. ebd.). Generell sollen alle Übungen nicht mit vollem Magen und bei Übelkeit praktiziert werden. Es gibt außerdem gewisse Einschränkungen z.B. für Schwangere, behinderte Personen und Personen mit Bandscheibenproblemen.
Entspannungsverfahren in der Erwachsenenbildung
In diesem Kapitel werden Entspannungsverfahren pädagogisch diskutiert. Die Frage, in welcher Form und mit welchen Zielen Entspannungsverfahren in der Erwachsenenbildung angewendet werden können, soll im Folgenden beantwortet werden.
Der heutige Erwachsene ist ein Produkt der Industriegesellschaft. Die Entstehung des Industriebetriebs, die Ausdehnung des Bildungssystems, der Sozialversicherung, der Parlamentarisierung und des [[Wahlrechts, die Verschiedenheit von Berufsrollen und Karrieren und nicht zuletzt auch die Verlängerung der Lebensspanne selbst ziehen eine Reihe von Übergängen und Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf nach sich. Nach der Jahrhundertwende wird in der Pädagogik Bildung erstmals als öffentliche Aufgabe entworfen. Bildung bedeutet in den klassischen Bildungstheorien „den Prozess und das Ziel der Kräfte-Bildung, Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung jedes Menschen in Auseinandersetzung mit der Welt“ (Arnold; Nolda; Nuissl 2001, S. 48).
Die Natur bzw. die Reife des Erwachsenen, gilt als Rahmen, innerhalb dessen dann der Raum für die weitere Gestaltbarkeit bzw. Überhöhung von Entwicklungsprozessen entsteht. An die Stelle des umfassend reifen Erwachsenen hat sich in der Nachkriegszeit das Bild von der Dauerhaftigkeit des Lernens, der ständigen Wiederholung von Entwicklungsprozessen auf unterschiedlichen Niveaus wie auch von ihrer Ungleichzeitigkeit und Mehrdimensionalität durchgesetzt. Die Teleologie des lebenslangen Lernens hat sich seit der Zeit der Bildungsreform und des Ausbaus der Erwachsenenbildung Ende der 1960er Jahre durchgesetzt. An Stelle des finalen ist die Vorstellung vom gestaltbaren und auch nur perspektivisch bestimmbaren Erwachsenen getreten (vgl. Arnold; Nolda; Nuissl 2001, S. 98).
Lernen ist ein Schlüsselbegriff der Pädagogik. Lernen wird definiert als „Erweiterung des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung von Lebenssituationen“ (Arnold; Nolda; Nuissl 2001, S. 194). Lernen gilt als Voraussetzung für Überlebensfähigkeit, denn der Mensch ist auf Grund seiner defizitären Instinktausstattung zur permanenten Anpassung an Umweltveränderungen genötigt, aber auch in der Lage, seine Umwelt zu gestalten. Seit einigen Jahren wird die lerntheoretische Diskussion durch die Erkenntnistheorie des Konstruktivismus belebt. Der Konstruktivismus betont die Autopoiese, die operationale Geschlossenheit, die Rekursivität und Selbstreferenz des Lernens. Es kann nicht von außen gesteuert oder determiniert, sondern allenfalls angeregt und perturbiert (gestört) werden. Neurophysiologisch lassen sich keine strukturellen Unterschiede der Kognition in verschiedenen Altersstufen feststellen. Allerdings wächst die Bedeutung der Erfahrungen, der „psychosozialen Vorstrukturen“ (ebd.), der kognitiven Schemata im Lebenslauf an. Die mentalen Netzwerke verfestigen sich und bilden stabile Deutungsmuster. Diese Netze erleichtern ein sogenanntes „Anschlusslernen“, da Neues mit Bekanntem verknüpft wird. Sie erschweren ein Lernen, wenn sie als zu enger Filter wirken. Generell nimmt die Individualisierung des Lernens mit dem Alter zu.
Dabei ist die Speicherkapazität des Gedächtnisses weniger wichtig als die biographisch geprägte Entscheidung, was relevant und bedeutungsvoll ist und wofür sich Lernanstrengungen lohnen. Erkenntnistheoretisch ist jedes Lernen ein „selfdirected-learning“ (Selbstorganisation). Jede Person lernt permanent im Alltag. Dennoch benötigen Erwachsene angesichts komplexer und unübersichtlicher Umwelten mehr denn je institutionalisierte Lernhilfen, Lernberatungen und soziale Lerngelegenheiten.
Grundsätzlich wird das vom Staat gelenkte Bildungssystem in folgende Bereiche eingeteilt: den Elementarbereich (Kindergarten), den Primärbereich (Grundschule), den Sekundärbereich (z.B. Gymnasium) und den Tertiärbereich (z.B. Hochschule). Staatliche Initiativen, die Erwachsenenbildung zum vierten Bildungsbereich zu machen, unterliegen den Prinzipien der Pluralität und der Subsidiarität. Pluralität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die bestehenden Institutionen und Strukturen in den seit 1970 konstituierten vierten Bildungsbereich übernommen und Erwachsenenbildung weitestgehend von gesellschaftlichen Organisationen verantwortet wird. Subsidiarität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Staat nur dort eingreift, wo Erwachsenenbildung hinsichtlich öffentlich definierter Ziele (wie Flächendeckung oder benachteiligte Zielgruppen) unterstützt werden muss (vgl. Arnold; Nolda; Nuissl 2001, S. 86). Das Erwachsenenbildungssystem ist als „quantitativ und qualitativ [...] eigenständiger Bildungsbereich“ (ebd. S. 85; Auslassung: E. K.) erkennbar. Der deutsche Bildungsrat definiert 1970 die Erwachsenenbildung (EB) bzw. die Weiterbildung (WB) als „Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluß einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Ausbildungsphase“ (zitiert nach Lenz 1979, S. 44).
Die Erwachsenenbildung wird in zwei Bereiche unterteilt: erstens in die berufliche WB, und zweitens in die allgemeine EB, die den Bereich der Grundbildung umfasst (vgl. Arnold; Nolda; Nuissl 2001, S. 14). In diesem Kapitel konzentriere ich mich auf den Bereich der Grundbildung. Zu diesem Unterbereich der Erwachsenenbildung wird die Gesundheitsbildung gezählt. Des Weiteren konzentriere ich mich in diesem Kapitel auf die Volkshochschule (VHS), stellvertretend für eine Institution der Erwachsenenbildung, in welche die von mir ausgewählten Entspannungsverfahren Eingang gefunden haben. Die Bedeutung von Entspannungsverfahren an Volkshochschulen ist im Kontext des Verständnisses, der Aufgabenstellung, Programmplanung, Zielsetzung und Problematik des Fachbereichs Gesundheitsbildung zu verstehen. Aus diesem Grund gehe ich zuerst auf die Thematik Gesundheitsbildung an Volkshochschulen ein, bevor ich in diesem Zusammenhang eine spezielle Betrachtung der Entspannungsverfahren vornehme Aspekte von Gesundheit und Krankheit sind als traditioneller Inhalt der Erwachsenenbildung zu betrachten. Die Geschichte der Gesundheitsbildung setzt in der Bundesrepublik 1960 ein. Bis Mitte der 1980er Jahre wird die Thematik „aufklärerisch und erzieherisch“ (Arnold; Nolda; Nuissl 2001, S. 141) vermittelt. Die Folge sind direktive Lernarrangements. Methodische und didaktische Einseitigkeiten leiten sich aus der Orientierung an Erkrankungsrisiken ab. Die Gesundheitserziehung folgt einer mechanistischen Auffassung und dementsprechend reduzieren sich pädagogische Ziele auf die Erhaltung und Wiederherstellung der Körperfunktionstüchtigkeit (vgl. ebd., S. 141).
Mit der Gesundheitsbewegung und ihren politischen Implikationen rücken Möglichkeiten aktiver Gesundheitsförderung in den Vordergrund (s.2.4). Im Bildungsbereich findet die Entwicklung des biopsychosozialen Modells der Gesundheit (s.2.2) 1985 ihren Niederschlag im „Rahmenplan Gesundheitsbildung“ (ebd., S. 141). Dabei handelt es sich um eine Grundkonzeption, die eine Fülle neuer, fächerübergreifender Lernmöglichkeiten erschließt, sich damit auf Lebenskontexte bezieht und bis in die Gegenwart modellhaft wirkt. Aus einer randständigen Position entwickelt sich die Gesundheitsbildung zu einem der größten Angebotsbereiche organisierter Erwachsenenbildung und ist seit Beginn der 1980er Jahre vergleichsweise stark gestiegen. Dies zeigt ein wachsendes „Lerninteresse der Bevölkerung für Fragen von Gesundheit und Krankheit“ (Venth 1994, S. 3). Dabei wird der Bereich mit einer Beteiligung von über 80% durch das Lerninteresse von Frauen getragen. Gesundheitsbildung reicht über ein eng kognitiv ausgelegtes Lernverständnis hinaus. Sie bezieht sich auf körperlich-seelisch und soziale Zusammenhänge und will einen selbstbestimmten Einfluss auf gesundheitsrelevante Phänomene unterstützen. Diese Intentionen entsprechen bislang eindeutig frauenspezifischen Bildungsmotiven. Die Gesundheitsbildung vermittelt das Bildungswissen zur Vervollständigung von Alltagskompetenzen hinsichtlich der Gesundheit (vgl. ebd.). Wie schon gezeigt, hängt Entspannung sehr eng mit dem Wohlbefinden und der Gesundheit einer Person zusammen, woraus sich die Zuordnung von Entspannungsverfahren zu dem Bereich der Gesundheitsbildung ergibt. Dies ist auch im „Rahmenplan Gesundheitsbildung“ entsprechend verankert.
Der Bereich Entspannung ist demnach ein eigenständiger Fachbereich an Volkshochschulen. Entspannung ist weiter unterteilt in sechs Abteilungen: „verschiedene Entspannungsverfahren“, „Autogenes Training“, „Yoga“, „Stressbewältigung“, „Atemschulung“ und „Massagen“ (vgl. Venth 1994, S. 6). Die Progressive Muskelentspannung fällt in die Abteilung „verschiedene Entspannungsverfahren“. Entscheidend für diese Grundkonzeption sind bestimmte Prinzipien, von Venth (1994) als „positive Prinzipien einer teilnehmerInnenorientierten Erwachsenenbildung“ bezeichnet (S. 6). Diese leiten sich erstens von der Subjektivität der Gesundheitsdefinition und zweitens von Lernwiderständen ab. Der dazugehörige Schlüsselbegriff ist nach Venth (1994) „Autonomie“ und bedeutet sinngemäß für die einzelne Person: „nur ich kann letztendlich darüber befinden, was Gesundheit für mich bedeutet, was sie fördert und was sie beeinträchtigt. Und: je mehr Möglichkeiten ich erhalte zu prüfen, was mir gut tut oder schadet (als Ausdruck eines Selbst-Bewusstseins), desto aussichtsreicher kann ich meine Gesundheit stärken“ (S. 6). Nur das Individuum kann selbst entscheiden, was zum eigenen Wohlbefinden beiträgt. Die Subjektivität des Einzelnen steht vor allem bei Gesundheits- und Krankheitsfragen einer Person im Vordergrund. Auf diese Weise steht der Mensch als Person im Mittelpunkt der Betrachtung.
Damit ist der Gedanke der Hilfe zur Selbsthilfe in und durch die Erwachsenenbildung angesprochen, ein grundlegender Bestandteil und Ziel der Gesundheitsbildung. Die Unterstützung von Selbsthilfe als Ziel realisiert sich nach Venth (1994) innerhalb der Volkshochschulen in mehreren Dimensionen:
- durch die Vielfalt der Angebote haben TeilnehmerInnen die Chance, den Ihnen persönlich passenden Weg zu Gesundheitsangelegenheiten zu finden;
- durch fächerübergreifende/integrative Kurskonzepte werden körperliche, seelische und soziale Momente von Gesundheit einbezogen, d.h. es liegt ein Menschenbild zugrunde, das der ganzen Person gerecht wird;
- Gesundheitsbildung setzt sich von Erziehung ab, d.h. sie erneuert nicht Definitionen zur Bestimmung von Gesundheit und Ziele für gesundheitsgerechtes Verhalten über die Köpfe/das Bewusstsein der Teilnehmenden hinweg (die selbstkritische Arbeit an diesem Anspruch hält bis heute an) [...];
- Selbsterfahrung, Eigenaktivierung und soziale Erfahrung im Gruppenkontext spielen eine zentrale Rolle (S. 8; Auslassung und Anpassung: E. K.).
In Anbetracht der pädagogischen Anthropologie ergeben sich die Legitimation und der Wert der Pädagogik in der Gesundheitsbildung. Diese geht von dem prozessualen Entwicklungscharakter des Menschen aus, der eine lebenslange Erziehungs- und Bildungsbedürftigkeit erfordert (vgl. Weber 19968, 248ff.). Eine Pädagogik, die auf Erziehung und Bildung ausgerichtet ist, „leitet an, führt hin oder begleitet, unterstützt, gibt Hilfestellung [...] bis der Betroffene seiner Anleitung, Unterweisung und Hilfe nicht mehr bedarf, weil er – nun emanzipiert und mündig geworden – seine gesundheitlichen Belange selbst in eigener Verantwortung übernimmt. Erst die Sicht des ‚homo educandus’, also von der grundsätzlichen Lern- und Erziehungsbedürftigkeit des Menschen, auch und gerade in gesundheitlichen Belangen, macht erzieherische Maßnahmen zur Vermittlung und Förderung von gesundheitsrelevanten Kenntnissen und Fertigkeiten, von Einstellungen und Wertorientierungen sowie von entsprechendem Verhalten zumindest in komplexen und komplizierten soziokulturellen Lebensverhältnissen überhaupt erforderlich und sinnvoll“ (Haug 1991, S. 51). Gesundheit muss weiterhin „eine durch Lernen, Erziehung und Bildung beeinflussbare Qualität haben, die erst durch ‚richtiges’ Hinführen und Unterweisen (Lern- und Bildungshilfen) ausreichend erworben wird, bzw. durch ‚falsche’ Verhaltensweisen und mangelnde pädagogische Intervention auch beeinträchtigt wird“ (ebd.).
Bildungsarbeit findet grundsätzlich in Form von (Klein-) Gruppen statt (vgl. Langmaak; Braune-Krickau 19955). Das gleiche gilt für Entspannungsverfahren: sie werden in der Regel als Gruppenverfahren angeboten. Ausnahmen in Form von Einzelunterricht bilden Entspannungsverfahren im therapeutischen Bereich (vgl. Petermann; Vaitl 1994). Die Sozialpsychologie spricht dann von einer Gruppe, wenn mehrere Personen zusammenkommen (in der Regel drei oder mehr), die ein gemeinsames Ziel anstreben und sich in ihrem Verhalten und ihrer Arbeitsleistung gegenseitig beeinflussen (vgl. Klebert; Schrader; Straub 1987, S. 64). Die Kleingruppenforschung hat ergeben, dass die ideale Gruppengröße bei sieben bis neun Mitgliedern liegt (vgl. Langmaak; Braune-Krickau 19955). Die Interaktion innerhalb einer Gruppe bewirkt eine soziale Unterstützung des einzelnen und baut bei den meisten Personen Ängste ab. Sie dient als Vehikel zur Erfüllung der individuellen Bedürfnisse nach Kontakt, nach unmittelbarem Austausch, nach Anerkennung und einer Bestätigung durch andere, nach Feedback und der dadurch möglichen Orientierung in fachlicher und menschlicher Hinsicht. Mit der Gruppengröße (über 12) wächst die Zurückhaltung vieler TeilnehmerInnen (vgl. Klebert; Schrader; Straub 1987, S. 67). Demnach kann in einer Kleingruppe vergleichsweise mehr gegenseitiges Vertrauen entstehen (vgl. Langmaak; Braune-Krickau 19955). Bei der Teilnahme an Gruppenkursen werden Personen durch Gespräche mit Anderen zudem angeregt und motiviert. Folgende Aussage einer Frau, die an einem Entspannungskurs teilgenommen hat, zeigt wie bedeutend die Gruppe für sie war: „Mit das Wertvollste an diesem Jahr für mich war es, Mitglied einer Yoga-und Meditationsgruppe zu werden. Ich bin seelisch und körperlich ruhiger und stärker geworden. Das Sprechen über die bei den Entspannungsübungen gemachten Erfahrungen ist hilfreich. – Wenn ich es einrichten kann, nehme ich gern an Seminaren oder im Urlaub an Entspannungskursen teil. Die Gruppe stimuliert mich, ich kann Neues hinzulernen (zitiert nach Tausch 1993, S. 146). Ein weiterer Vorteil Entspannungsverfahren in Form einer Kleingruppe anzubieten, ist, dass der Übungsleiter individuelle Befürchtungen und Störfaktoren besprechen und abbauen kann. Darüber hinaus kann er nach den einzelnen Übungen die persönlichen Erlebnisse der KursteilnehmerInnen diskutieren (vgl. Petermann; Vaitl 1994, S. 213).
Generell sind Lernziele definiert als die angestrebten „Lernergebnisse bzw. beobachtbaren Verhaltensänderungen beim Lernenden als Resultat von Lerntätigkeiten bzw. Lehr-/Lernveranstaltungen“ (Arnold; Nolda; Nuissl 2001, S. 279). Allgemein orientiert sich die Gesundheitsbildung an Volkshochschulen an den grundlegenden pädagogischen Erziehungszielen Mündigkeit, Emanzipation, Partizipation, Selbstbestimmung und Selbstreflexivität. Diese können übergeordnete Leitziele bilden (vgl. Arnold; Nolda; Nuissl 2001, S. 209). Selbsterfahrung ist ein Ziel von Entspannungsverfahren. Selbsterfahrung meint die vertiefte Wahrnehmung der eigenen Person. Sie wird methodisch angeregt (z.B. durch Praxisreflexion). Ziel ist es, sich selbst besser zu verstehen und sich aus diesem ausgeweiteten Verständnis heraus zu verhalten. Die Suche nach Orientierung und Sinn schlägt sich in der Verknüpfung von Selbsterfahrung mit personüberschreitenden Konzepten des Selbst- und Weltverstehens nieder; sie kann bis in einen Bereich führen, der sich mit Esoterik berührt. Die Möglichkeit dazu bieten Entspannungsverfahren als körperorientierte Zugänge (vgl. Arnold, Nolda, Nuissl 2001, S. 279).
Ziel von Entspannungskursen ist, das körperliche Bewusstsein wieder herzustellen. Im Rahmen der VHS soll den Teilnehmern die Erfahrung vermittelt werden, dass sich die körperliche und physische Stabilität durch richtig angewandte Entspannung oder durch eigene Aktivität steigern lässt und Freude an Bewegung und Entspannung vermitteln. Hierbei müsste den Teilnehmern die Anregung gegeben werden, diese Aktivitäten und Übungen zu erweitern und sie zuhause eigenständig fortzusetzen.
Abschließende Gedanken
„Die schwarzen Felder auf einem Schachbrett wechseln ab mit den weißen. Ebenso wechselt jede Dunkelheit im Leben mit Helle ab, jeder Kummer mit einer Freude, jeder Fehlschlag mit einem Erfolg. Wandel und Gegensatz sind unvermeidlich; sie sind es ja, die das große Spiel ermöglichen. Nimm sie leidenschaftslos in Augenschein, und laß niemals zu, daß sie bestimmen, wer du im Innern bist“ (Riemann 1996, S. 51; Hervorhebung: E. K.). Diese Weisheit stammt von Yogananda Paramahansa, im Rahmen einer Interpretation der Rubaijat des Omar Chajjam (1048-1131). Sie beschreibt zum einen die Gegensätze im Leben, sie sind natürliche Prinzipien und gehören insofern zum Leben dazu. Auch das Gegensatzpaar Anspannung und Entspannung stellt wie schon erwähnt ein natürliches Lebensprinzip dar. Der ausgewogene Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung ist sogar lebenswichtig, er trägt zur Gesunderhaltung einer Person bei. Zum anderen spricht diese Spruchweisheit meiner Meinung nach die Fähigkeit der Selbstbeobachtung und Selbstreflexion einer Person an. Das Leben besteht nun mal aus Höhen und Tiefen, viele unterschiedliche Anforderungen gilt es im Lebenslauf zu bewältigen. Dabei scheint es von großer Bedeutung zu sein, diesen Herausforderungen mit der nötigen Gelassenheit zu begegnen, sie eben leidenschaftslos, als der stille Beobachter (Sakshin) zu betrachten.
Selbstwahrnehmung, sei es bezogen auf körperliche, seelische oder geistige Vorgänge, spielt eine zentrale Rolle in den vorgestellten Entspannungsverfahren. Verbunden mit einer Reflexion dessen, was wahrgenommen wurde, kann es meiner Meinung nach früher oder später zu einer Änderung im Verhalten einer Person kommen. Sie wird also in die Lage versetzt, aus ihren Beobachtungen zu lernen, sich damit weiter zu entwickeln und folglich auch Stress besser zu bewältigen.
Entspannung auf den drei Ebenen (körperlich, seelisch, geistig) führt dazu, keine Wünsche mehr zu haben, nichts mehr zu begehren und damit weniger zu leiden, eine Person ist sozusagen „wunschlos glücklich“ und damit natürlich weniger gestresst. Demnach findet die Person das Glück in sich. „Außerhalb unserer selbst nach Glück zu trachten, das ist so, als wollte man eine Wolke mit dem Lasso fangen. Glück ist keine Sache: Es ist ein Gemütszustand. Man muß es leben“ (Riemann 1996, S. 19). Eine Person soll niemals zulassen, dass die Wirbel des Lebens sie aus ihrer Mitte herausreißen, dass sie bestimmen, wer sie im Innersten ist. Denn „indem ein Mensch duldet, daß er sich zu seiner leiblichen, seelischen und geistigen Erhaltung immer von Umständen außerhalb seiner selbst abhängig macht, und dabei niemals den Blick nach innen wendet, hin zu seinem eigenen Kraftquell, erschöpft er nach und nach seine Vorräte an Energie“ (ebd., S. 81).
Aus diesem Grund plädiere ich mit den Worten von Vaitl; Peterman (20022) für eine „Kultur der Entspannung“, die alle Lebensbereiche umfasst, also ihren „Sitz im Leben“ hat (S. 21). An dieser Stelle sei erwähnt, dass der gegenwärtige Wellnesstrend (s.2.3), diesem Anliegen entgegenkommt. Die Idee dabei das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, lässt sich meiner Meinung nach auch auf den Bereich der Entspannungsverfahren übertragen. Entspannung betrachte ich als Mittel zum Zweck, als Methode, um Stress besser bewältigen zu können und sich damit gesund zu erhalten, aber auch um gleichzeitig dauerhaftes Glück und Wohlbefinden zu erlangen.
Auf einen weiteren, meiner Meinung nach aufschlussreichen Aspekt, in Zusammenhang mit dem Thema Entspannung, auf den ich bei der Anfertigung der vorliegenden Arbeit gestoßen bin, gehe ich im folgenden ein. Im Zuge der Literaturrecherche, habe ich zu meinem großen Interesse festgestellt, dass die Mehrzahl der Literatur, die ich unter dem Stichwort Entspannung gefunden habe, das Thema Entspannungspolitik behandelt. Selbst die Herausgeber des „Brockhaus in einem Band“ (20029) haben sich dafür entschieden, Entspannung ausschließlich als „internat. Bemühungen, durch Maßnahmen der Abrüstung sowie Vereinbarungen Konflikte zu entschärfen oder zu vermeiden“ (Brockhaus, S. 242) zu definieren. Im Bereich der Politik, speziell der Konfliktlösung, das gleiche Wort zu wählen wie im Bereich der dargestellten Aspekte der Entspannung, scheint mir naheliegend. Das was sich auf der Mikroebene, (das Individuum als System betreffend) abspielt, gilt genauso für die Makroebene (die Gesellschaft und deren politische Regelungen betreffend).
Dass diese Verbindung zwischen Individuum und Gesellschaft hinsichtlich der beiden Wortbedeutungen der Entspannung im idealen Fall zusammentrifft und dann von großem Nutzen für die Menschheit ist, verdeutlicht folgendes Beispiel. Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), der Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, setzte sich für die Gleichberechtigung seiner Landsleute in Südafrika, für die Unabhängigkeit Indiens und für die Beseitigung der Gegensätze zwischen Muslimen und Hindus ein. Sein hohes Ansehen und seine Erfolge gründeten sich auf die Methode der Gewaltlosigkeit. Gleichzeitig ist Gandhi für seine „yogische Lebensweise“ bekannt. Er ging den Weg des Karma- und des Bhakti-Yoga (s.5.3.2) „mit dem Ziel an der eigenen Vollkommenheit zu arbeiten“ (Berufsverband Deutscher Yogalehrer 20003, S. 57). Auf diesem Weg integrierte er verschiedene Yogarichtungen. Er lebte beispielsweise ein sittlich orientiertes Leben, in dem die Yamas und Nyamas (s.5.3.1) eine bedeutende Stellung innehatten. Ferner übte er das tantrisch beeinflusste Hatha-Yoga aus, da ihm die Gesundheit seines Körpers viel bedeutete (vgl. ebd., S. 57). Insofern gelang es Gandhi meiner Meinung nach, die aus dieser Lebensweise folgende eigene Entspanntheit auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene in ein gesellschaftlich-politisch wirkendes Leben einzubinden.
Im Rahmen eines umfassenden Stressmanagements sehe ich Entspannungsverfahren als eine bedeutende Bewältigungsmaßnahme von Stress an. Ich komme zu dem Schluss, dass Entspannungsverfahren, wie beispielsweise die in dieser Arbeit Vorgestellten (Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training und Yoga), notwendige Elemente im Prozess des lebenslangen Lernens darstellen. Sie tragen wesentlich dazu bei, eine umfassende Bildung der Person anzuregen. Entspannungsverfahren zeigen ihre Wirkungen durch das Wechselspiel zwischen Körper, Geist, Seele auf den Menschen als System, selbst wenn sie zunächst auf der Ebene des Körpers ansetzen. Dies gleicht der Forderung von Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) im Jahre 1802 nach einer „Elementarbildung [seines] Geschlechts“ (Rutt 1961, S. 211; Anpassung: E. K.). Er unterteilt sie in intellektuelle, sittliche und physische Elementarbildung und meint damit die harmonische Ausbildung von „Kopf, Herz und Hand“, (Keller; Novak 19932, S. 281), also eine ganzheitliche Menschenbildung. Insofern haben Entspannungsverfahren einen berechtigten Platz in der Pädagogik. Sowohl in erziehungswissenschaftlichen Theorien als auch in der pädagogischen Praxis ist es daher in meinen Augen erstrebenswert, den Einzug von Entspannungsmethoden zu fördern. Es ist wünschenswert, dass auf diesem Gebiet gerade in einem pädagogischen Zusammenhang geforscht, gelehrt, aber auch praktisch gearbeitet wird. Etablierten sich Entspannungsverfahren in der Pädagogik, wäre es gewiss möglich, in einem Erziehungs- und Bildungsprozess Personen ein Werkzeug in die Hand zu geben, mit dem sie auf ihrem Lebensweg ausgerüstet sind. Damit sie sich selbst helfen können, den Anforderungen einer Risikogesellschaft, in einem Zeitalter der Globalisierung, Technisierung, Individualisierung, des schnellen Wandels entspannt und gelassen zu begegnen und somit glücklich zu sein.
Denn nach Wilhelm von Humboldt (1767-1835) ist „Glücklich sein, das innerliche Sich-glücklich-Fühlen [...] eine Gabe des Schicksals. Sie kommt nicht von außen. Man muß sie sich, wenn sie dauernd sein soll, immer selbst erkämpfen. Zum Glück kann man es. Es kommt nur auf die Kraft des Entschlusses und einige Gewöhnung zur Selbstüberwindung an’“ (zitiert nach Schmidt 19906, S. 9; Auslassung: E. K.). In diesem Sinne hoffe ich, dass sich immer mehr Personen dazu entschließen, ein Entspannungsverfahren zu erlernen, um so zu dem natürlichen Lebensprinzip des Wechsels von An- und Entspannungsphasen zurückzukommen und in der Ruhe die Kraft zu finden.
Siehe auch
- Wissenschaftliche Studien Yoga
- Wissenschaftliche Studien Yoga für Kinder und Jugendliche
- Wissenschaftliche Studien Ayurveda
- Wissenschaftliche Studien Kirtan- und Mantrasingen
- Wissenschaftliche Studien Tiefenentspannung
- Wissenschaftliche Studien Literaturliste
- Stress
- Entspannung
Literatur
- Abele, Andrea; Becker, Peter (Hg.) 1991: Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik. Juventa Verlag: Weinheim, München.
- Antonovsky, Aaron 1997: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Dgvt-Verlag: Tübingen.
- Arnold, Rolf; Nolda, Sigrid; Nuissl, Ekkehard (Hg.) 2001: Wörterbuch Erwachsenenpädagogik. Julius Klinkhardt.
- Bengel, Jürgen; Strittmatter, Regine; Willmann, Hildegard 20027: Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese. Diskussionsstand und Stellenwert. Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung. Bd.6. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Köln.
- Bernstein, Douglas A.; Borkovec, Thomas D. 19782: Entspannungs-Training. Handbuch der progressiven Muskelentspannung. J. Pfeiffer Verlag: München.
- Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hg.) 20003: Der Weg des Yoga. Handbuch für Übende und Lehrende. Via Nova Verlag: Petersberg.
- Bögle, Reinhard 1996: Yoga. Ein Weg für Dich. Einblick in die Yoga-Lehre. Bechtermünz Verlag: Augsburg.
- Bollnow, Otto Friedrich 19653: Existenzphilosophie und Pädagogik. Versuch über unstetige Formen der Erziehung. Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz.
- Bösel, Rainer et al. 1978: Streß. Einführung in die psychosomatische Belastungsforschung. Hoffmann und Campe Verlag: Hamburg.
- Boeser, Christian; Schörner, Thomas; Wolters, Dirk (Hg.) 20022: Kinder des Wohlstands. Auf der Suche nach neuer Lebensqualität. Verlag für Akademische Schriften: Frankfurt/Main
- Brockhaus, F. A. (Hg.) 20029: Der Brockhaus in einem Band. F.A. Brockhaus: Leipzig.
- Brockhaus, F. A. (Hg.) 19847: Der neue Brockhaus. F. A. Brockhaus: Wiesbaden.
- Brüderl, Leokadia (Hg.) 1988: Theorien und Methoden der Bewältigungsforschung. Juventa Verlag: Weinheim, München.
- Bund der Yoga Vidya Lehrer (Hg.) 20006: Handbuch zur Yoga-Schulung und Yogalehrer-Ausbildung. Yoga Vidya Verlag Volker Bretz: Oberlahr.
- Corazza, Verena et al. 2001: Kursbuch Gesundheit. Kiepenheuer und Witsch: Köln.
- Ebert, Dietrich 1986: Physiologische Aspekte des Yoga und der Meditation. Hippokrates: Stuttgart.
- Eliade, Mircea 1977: Yoga. Unsterblichkeit und Freiheit. Insel Verlag: Frankfurt am Main.
- Eiff, August Wilhelm von 1976: Seelische und körperliche Störungen durch Streß. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart.
- Faltermaier, Toni 1994: Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitshandeln. Über den Umgang mit Gesundheit im Alltag. Verlags Union: Weinheim.
- Fischer-Schreiber, Ingrid et al. (Hg.) 19942: Lexikon der östlichen Weisheitslehren. Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Zen. Otto Wilhelm Barth Verlag: Bern, München, Wien.
- Forschungsverbund Laienpotential (Hg.) 1987: Gesundheitsselbsthilfe und professionelle Dienstleistungen. Springer: Berlin.
- Frauwallner, Erich 1953: Geschichte der indischen Philosophie. Die Philosophie des Veda und des Epos der Buddha und der Jina. Das Samkhya und das klassische Yoga-System. Otto Müller Verlag: Salzburg.
- Fthenakis, Wassilios E. et al. 1999: Engagierte Vaterschaft. Die sanfte Revolution in der Familie. Leske+Budrich: Opladen.
- Fuchs, Christian 1990: Yoga in Deutschland. Rezeption, Organisation, Typologie. Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln.
- Fuchs, Christian 1992: Geschichte und Gegenwart des Yoga in Deutschland. In: Deutscher Volkshochschulverband e.V., Fachstelle für internationale Zusammenarbeit (Hg.). Volkshochschulen und der Themenbereich Afrika, Asien und Lateinamerika. Materialien 33. Yoga und Indien. Bonn.
- Graham, Ian; Takala Jukka; Machida, Seiji 2003: Safety Culture at work. International Labour Office: Genf.
- Groetschel, Rose 1984: Belastungen, Bewältigungsressourcen und Herz-Kreislauf-Risiken. Bremen.
- Hamm, Alfons 20002: Progressive Muskelentspannung. In: Vaitl, Dieter; Petermann, Franz (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. Verlags Union: Weinheim.
- Haug, Christoph V. 1991: Gesundheitsbildung im Wandel. Klinkhardt: Bad Heilbrunn/Obb.
- Haring, Claus 1979: Lehrbuch des autogenen Trainings. Ferdinand Enke Verlag: Stuttgart.
- Heckhausen, Heinz 1989: Motivation und Handeln. Springer: Heidelberg.
- Herriger, Norbert 1997: Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln.
- Hoffmann, Bernt 200014: Handbuch Autogenes Training. Grundlagen, Technik, Anwendung. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co KG: München.
- Hurrelmann, Klaus 1990: Familienstress, Schulstress, Freizeitstress. Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche. Beltz: Weinheim, Basel
- Jacobson, Edmund 19994: Entspannung als Therapie. Progressive Relaxation in Theorie und Praxis. Klett-Cotta: Stuttgart.
- Jacquemart, Pierre; Elkefi, Saida 1996: Yoga als Therapie. Lehrbuch für die Arzt- und Naturheilpraxis. Weltbildverlag: Augsburg.
- Jentschura, Peter; Lohkämper, Josef 200310: Gesundheit durch Entschlackung. Verlag Peter Jentschura: Münster.
- Keller, Josef A.; Novak Felix 19932: Kleines Pädagogisches Wörterbuch. Herder: Freiburg, Basel, Wien.
- Keupp, Heiner 1997: Ermutigung zum aufrechten Gang. Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie: Tübingen.
- Kirschner, Wolf et al. 1995: §20 SGB V. Gesundheitsförderung; Krankheitsverhütung. Untersuchung zur Umsetzung durch die Krankenkassen. Bd.6. Asgard: Sankt Augustin.
- Knörzer, Wolfgang 1994: Zur Selbstkompetenz von Lehrenden unter besonderer Berücksichtigung der Körperwahrnehmung und Körpererfahrung im Rahmen eines Modells ganzheitlicher Gesundheitsbildung. Heidelberg.
- Kossak, Hans-Christian 20002: Hypnose. In: Dieter, Vaitl; Franz, Petermann (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Klebert, Karin, Schrader, Einhard, Straub Walter G. 1987: KurzModeration. Windmühle: Hamburg.
- Kraft, Hartmut 19892: Autogenes Training. Methodik, Didaktik und Psychodynamik. Hippokrates: Stuttgart.
- Krampen, Günther; Ohm, Dietmar 1994: Prävention und Rehabilitation: In: Franz Petermann; Dieter, Vaitl, (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.2. Anwendungen. Beltz Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Kriegisch, Norbert; Zittlau, Jörg 19972: Das große Buch der gesunden Ernährung. B&S Reihenwerke Verlags GmbH: Stuttgart.
- Langen, Dietrich (Hg.) 1968: Der Weg des Autogenen Trainings. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt.
- Langmaack, Barbara; Braune-Krickau, Michael 19955: Wie die Gruppe laufen lernt. Anregungen zum Planen und Leiten von Gruppen. Ein praktisches Lehrbuch. Psychologie Verlags Union: München.
- Lidell, Lucy 1985: Yoga für alle Lebensstufen. Gräfe und Unzer: München.
- Lindemann, Hannes 19795: Überleben im Stress. Autogenes Training. Der Weg zu Entspannung, Gesundheit, Leistungssteigerung. Heyne: München.
- Lysebeth, André v. 1970: Yoga für Menschen von heute. Bertelsmann: Gütersloh.
- Macha, Hildegard; Mauermann, Lutz (Hg.) 1997: Brennpunkte der Familienerziehung. Deutscher Studien Verlag: Weinheim.
- Massoth, Peter; Massoth, Eva 1984: So gesund wie möglich. Selbsthilfe in kranken Zeiten. Beltz: Weinheim, Basel.
- Mensen, Herbert 1997: Das autogene Training. Entspannung, Gesundheit, Stressbewältigung. Wilhelm Goldmann: München.
- Mumford, John 1982: Psychosomatischer Yoga. Der östliche Pfad zu geistigem und körperlichem Wohlbefinden. Sphinx: Basel.
- Oda, Hiroshi 2001: Spontanremissionen bei Krebserkrankungen aus der Sicht des Erlebenden. Psychologie Verlags Union, Verlagsgruppe Beltz: Weinheim.
- Olschewski, Adalbert 1995: Streß bewältigen. Ein ganzheitliches Kursprogramm. Karl F. Haug Verlag: Heidelberg.
- Patanjali 19824: Die Wurzeln des Yoga. Die klassischen Lehrsprüche des Patanjali. Die Grundlage aller Yoga-Systeme. Otto Wilhelm Barth Verlag: Bern, München, Wien.
- Payne, Rosemary A. 1998: Entspannungstechniken. Ein praktischer Leitfaden für Therapeuten. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm.
- Petermann, Franz; Vaitl, Dieter (Hg.) 1994: Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.2. Anwendungen. Beltz Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Riemann, Gerhard (Hg.) 1996: Paramahansa Yogananda interpretiert die Rubaijat des Omar Chajjam. Knaur: München.
- Schaufler, Birgit 2000: Frauen in Führung. Von Kompetenzen, die erkannt und genutzt werden wollen. Huber: Bern, Göttingen, Toronto, Seattle.
- Schenk, Christoph 1993: Streß bewältigen durch Entspannung. Mit Anleitungen zum Autogenen Training. Falken Verlag GmbH: Niederhausen.
- Scheuch, Klaus 19893: Streß. Gedanken, Theorien, Probleme. Verlag Volk und Gesundheit: Berlin.
- Schiffer, Eckhard 2001: Wie Gesundheit entsteht. Salutogenese. Schatzsuche statt Fehlerfahndung. Beltz: Weinheim, Basel.
- Schmidt, Karl O. 19906: Seneca. Der Lebensmeister. Drei Eichen Verlag: Ergolding.
- Schneewind, Klaus 19992: Familienpsychologie. Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln.
- Schott, Heinz; Wolf-Braun, Barbara 20002: Zur Geschichte der Hypnose und der Entspannungsverfahren. In: Vaitl, Dieter; Petermann, Franz (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Schultz, Johannes Heinrich 198217: Das autogene Training. Konzentrative Selbstentspannung. Versuch einer klinisch-praktischen Darstellung. Georg Thieme Verlag: Stuttgart.
- Schwarzer, Ralf 19962: Psychologie des Gesundheitsverhaltens. Hogrefe: Göttingen.
- Selye, Hans 1957: Stress beherrscht unser Leben. Rombach&Co: Freiburg i. Br.
- Sivananda, Radha Swami 1991: Geheimnis Hatha Yoga. Symbolik, Deutung. Praxis. Bauer Verlag: Freiburg im Breisgau.
- Tausch, Reinhard 1993: Hilfen bei Streß und Belastung. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH: Reinbek bei Hamburg.
- Trökes, Anna 2000: Das große Yoga Buch. Das moderne Standardwerk zum Hatha-Yoga. Gräfe und Unzer: München.
- Vaitl, Dieter 20002: Autogenes Training. In: Vaitl, Dieter; Petermann, Franz (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Vaitl, Dieter; Petermann, Franz (Hg.) 20002: Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Venth, Angelika (Hg.) 1987: Gesundheit und Krankheit als Bildungsproblem. Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung. Klinkhardt: Bad Heilbrunn/Obb.
- Vishnudevananda, Svami 1984: Das große illustrierte Yoga-Buch. Gräfe und Unzer: Freiburg im Breisgau.
- Vester, Frederic 1976: Phänomen Stress. Wo liegt sein Ursprung, warum ist er lebenswichtig, wodurch ist er entartet. Deutsche Verlags-Anstalt GmbH: Stuttgart.
- Wagner-Link, Angelika 1989: Aktive Entspannung und Stressbewältigung. Wirksame Methoden für Vielbeschäftigte. Expert Verlag: Ehningen; Taylorix Verlag: Stuttgart.
- Watzlawick, Paul 200122: Anleitung zum Unglücklichsein. Piper Verlag GmbH: München.
- Watzlawick, Paul 200113: Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben. Piper: München, Zürich.
- Weber, Erich (Hg.) 19958: Pädagogik. Eine Einführung. Bd.1. Grundfragen und Grundbegriffe. Teil 1. Pädagogische Anthropologie. Phylogenetische (bio- und kulturrevolutionäre) Voraussetzungen der Erziehung. Ludwig Auer GmbH: Donauwörth.
- Weber, Erich (Hg.) 19968: Pädagogik. Eine Einführung. Bd.1. Grundfragen und Grundbegriffe. Teil 2. Ontogenetische (entwicklungspsychologische und lebensgeschichtliche) Voraussetzung der Erziehung. Notwenigkeit und Möglichkeit der Erziehung. Ludwig Auer GmbH: Donauwörth.
- Wermke, Matthias et al. (Hg.) 20017: Duden. Das Fremdwörterbuch. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG: Mannheim.
- Wolpe, Joseph 1972: Praxis der Verhaltenstherapie. Hans Huber Verlag: Bern, Stuttgart, Wien.
- Yesudian, Selvarajan; Haich, Elisabeth 197220: Sport und Yoga. Drei Eichen Verlag: München.
- Zimbardo, Philip G. 19956: Psychologie. Springer Verlag: Berlin, Heidelberg, New York.
Zeitschriften:
- Bartsch, Norbert et al. (Hg.) 2000: Prävention. Zeitschrift für Gesundheitsförderung. Das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000, der GKV-Leitfaden und die GKV-Selbsthilfe-Grundsätze. 23, Heft 3.
- Huber, Andreas 1995: Streß-Management. Auf der Suche nach einer neuen Entspannungskultur. In: Psychologie Heute. 22, Heft 10.
- Possemeyer, Ines 2002: Zivilisationsplage Stress. Die Ursachen, die Folgen, die Auswege. In: Geo. Heft 3.
- Roth-Hunkeler, Theres 1997: Wellness Trainer/innen haben nicht nur Fitness im Sinn. In: Education permanente. 31, Heft 4.
- Schwab, Dieter 1997: Megatrend Gesundheit. In: Psychologie Heute. 22, Heft 10, S. 29-31.
- Schwarzer, Ralf 1994: Volitionstheorie der Gesundheitserziehung. In: Zeitschrift für Pädagogik. Gesundheitserziehung. 40, Heft 6.
- Tenzer, Eva 2003: Wellness. Das Widerstandsprogramm gegen den Alltagsstress. In: Psychologie Heute. 30, Heft 8.
- Unverzagt, Gerlinde 1997: Den Menschen aus dem Tiefschlaf wecken. Yoga ist eine wirksame Methode gegen Zeitkrankheiten. In: Psychologie Heute. 24, Heft 3.
- Venth, Angelika 1994: Gesundheitsförderung durch Erwachsenenbildung als Unterstützung von Selbsthilfe. Das Konzept von Gesundheitsbildung an Volkshochschulen. In: Nakos Extra. 23, Heft 1.
Weblinks
- Angst-Skala 2003
- Fthenakis, Wassilios E. 2000: Hat Familie Zukunft? Neue Herausforderungen für Familienberatung, Familienbildung und Familienpolitik
- Yoga Psychologie
Seminare
Entspannung und Stressmanagement Der RSS-Feed von https://www.yoga-vidya.de/seminare/interessengebiet/entspannung-stress-management/?type=2365 konnte nicht geladen werden: Fehler beim Parsen von XML für RSS Entspannungstherapeuten-Ausbildung Der RSS-Feed von https://www.yoga-vidya.de/seminare/interessengebiet/entspannungstherapeuten-ausbildung-baustein/?type=2365 konnte nicht geladen werden: Fehler beim Parsen von XML für RSS
<mp3player>http://yoga-psychologie.podspot.de/files/10_lampenfiebertransformations-atmung.MP3</mp3player> <mp3player>http://burnout.podspot.de/files/20_innerer-schweinehund_burnout-vorbeugung.MP3</mp3player> <mp3player>http://yoga-vedanta-tantra.org/wp-content/uploads/2013/08/014_7014_TALK_ON_VEDANTA.mp3</mp3player> <mp3player>http://daricha.podspot.de/files/68_1_uebung_podcast_folge_68_klassische_yoga-tiefenentspannung.mp3</mp3player> <mp3player>http://daricha.podspot.de/files/entspannung-bodyscan-energiefeldaktivierung.mp3</mp3player>