Maya: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „html5media>http://“ durch „hhtml5media>https://“ |
K Textersetzung - „hhtml5media“ durch „html5media“ |
||
| Zeile 1.028: | Zeile 1.028: | ||
==Multimedia== | ==Multimedia== | ||
===Jnana Yoga und Vedanta - Einführung=== | ===Jnana Yoga und Vedanta - Einführung=== | ||
< | <html5media>https://sukadev.podspot.de/files/01-jnana-yoga-vedanta-einfuehrung.mp3</html5media> | ||
===Vedanta - Grundbegriffe=== | ===Vedanta - Grundbegriffe=== | ||
< | <html5media>https://sukadev.podspot.de/files/02-vedanta-grundbegriffe-konzepte.mp3</html5media> | ||
===Shankaracharya – Leben und Werk des großen Vedanta Meisters=== | ===Shankaracharya – Leben und Werk des großen Vedanta Meisters=== | ||
< | <html5media>https://sukadev.podspot.de/files/11-shankaracharya-leben-und-werk.mp3</html5media> | ||
===Vedanta Tiefenentspannung: Wer bin ich?=== | ===Vedanta Tiefenentspannung: Wer bin ich?=== | ||
< | <html5media>https://daricha.podspot.de/files/85_Jnana_Yoga_Tiefenentspannung.mp3</html5media> | ||
===Satchidananda – deine Wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit=== | ===Satchidananda – deine Wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit=== | ||
< | <html5media>https://sukadev.podspot.de/files/20-satchidananda-sein-wissen-glueckseligkeit.mp3</html5media> | ||
==Zusammenfassung Deutsch Sanskrit - Sanskrit Deutsch== | ==Zusammenfassung Deutsch Sanskrit - Sanskrit Deutsch== | ||
Version vom 26. Mai 2018, 12:18 Uhr

1. Maya (Sanskrit: माया māyā f.) Zauberkunst (positiv und negativ), Kunst, außerordentliches Vermögen, Wunderkraft, Kunstgriff; List, Hinterlist, Anschlag, Trug, Betrug, Täuschung, Gaukelei; ein künstliches Gebilde, Trugbild, Blendwerk; Name der Mutter Buddhas; (in der Vedanta-Philosophie): Unwirklichkeit bzw. Illusion, durch die man die sinnlich erfahrbare "objektive" Welt für real (im höchsten Sinne) hält und als getrennt von Brahman betrachtet; die verhüllende Kraft Brahmans. Maya als philosophischer Begriff wird auch im Sinne der (unmanifesten) Urnatur (Mulaprakriti) gebraucht.
2. Maya (Sanskrit: मय maya Affix u. m.) (am Ende von Komposita:) bestehend aus, voll von; Bezeichnung des Werkmeisters der Dämonen (Asura), der ein und Kenner aller Zauberkünste und Lehrer der Astronomie (Jyotisha) und Kriegskunst ist (Mayasura). Er ist das Gegenstück zu Vishvakarman, dem Baumeister der Götter.

3. Maya (Sanskrit: मय maya m.) Pferd, Ross; Kamel; Maultier.
4. Maya (Sanskrit: मया mayā pron.) Personalpronomen mayā ist der Instrumental des Pronominalstammes Mad, von dem die Kasusformen der 1. Person Singular gebildet werden, es bedeutet "mit mir", "durch mich" bzw. "von mir", z.B.: mayā kṛtam "von mir gemacht", mayā bhuktam "von mir gegessen".
Sukadev über Maya
Niederschriften eines Vortragsvideos (2014) von Sukadev über Maya
Maya (mit zwei kurzen A) ist ein Affix, also etwas, was hinter ein anderes Wort angehängt wird und heißt „gemacht aus“, „bestehend aus“, „zusammengesetzt aus“. Du kennst es vielleicht vom Vedanta oder Annamaya Kosha. Das heißt, die Schicht, die Hülle, die gemacht ist aus Nahrung. "Anna" – Nahrung, "Maya" heißt „gemacht aus“, Kosha – Schicht oder Hülle. Oder es gibt Pranamaya Kosha. Das heißt, die Hülle, gemacht aus Prana. Oder Manomaya Kosha. Also nicht Maya (mit langem a), also nicht eine illusionäre Hülle, sondern „gemacht aus“, Maya. Maya (mit zwei kurzen A) ist auch der Name eines Asuras, eines Dämonen, derjenige, der alle möglichen komischen Dinge gemacht hat. Im Unterschied zu Maya (mit zwei langen A), da ist es Illusion, Zauberkraft oder auch die göttliche Mutter.
Maya hat so viele verschiedene Bedeutungen. Im Vedanta ist Maya die Täuschung. Dort gibt es das Universum, und das Universum gibt es nicht wirklich, es ist eine Täuschung. Es gibt Brahman, das Absolute. Aus Brahman heraus entsteht eine Kraft der Täuschung, Maya. Und durch die Kraft von Maya erscheint einem Jagat in dieser Welt. Aber in Wahrheit gibt es keine Welt, die Welt ist wie eine Fata Morgana. Eine Fata Morgana in der Wüste mag dir vorgaukeln, dass da eine Oase ist mit vielen Häusern und mit Palmen und Wasser usw. Ich habe das selbst mal in der Wüste in Ägypten erlebt, da erscheint es tatsächlich so, als ob am Horizont eine wunderschöne Oase ist, und man will dort hingehen. Natürlich, wenn man dort hingeht, dann kommt man vom Weg ab und kann dann verdursten.
So ähnlich gaukelt einem Maya alles Mögliche vor. Du kannst dir bewusst sein, so vieles in diesem Universum ist auch Täuschung in einem relativeren Sinn. Im höchsten Sinn ist die Tatsache, dass es überhaupt ein Universum gibt, Maya. Aber innerhalb dieses Universums gibt es auch noch andere Mayas. Du kannst denken, du brauchst unbedingt das und das, um glücklich zu sein. Eine weitere Maya. Du hast irgendetwas auf eine bestimmte Weise aufgefasst und du stellst fest, „das stimmt gar nicht.“ Eine weitere Form von Maya. Und so viele kleinere und größere Mayas.
Der spirituelle Aspirant ist voller Ehrerbietung vor dieser Kraft der Maya. Und hier sind wir schon in einer zweiten Bedeutung von Maya. Maya wird auch verehrt als Maya Devi. Es gibt sogar eine Stadt, die nennt sich Mayapur, die Stadt der Maya, und das ist durchaus ehrerbietig gemeint. Und das heißt eben Zauberkraft, eine besondere Kraft. Und so heißt es, diese Welt ist zwar Maya, aber es ist nicht eine reine Illusion, sondern es ist eine Illusion Gottes, sie ist göttliche Kraft. Auch Krishna sagt, dass er durch seine Yoga Maya die Welt schafft, erhält und zerstört. Und das ist dann nicht nur als Illusion gemeint, sondern es ist eine besondere Kraft.
In den tantrischen Schriften heißt es, es gibt Vidya Maya und Avidya Maya, es gibt die Kraft der Täuschung und die Kraft des Wissens. Maya hat also so viele verschiedene Aspekte. Maya bedeutet aber auch die göttliche Mutter. Ma heißt ja auch „die Mutter“. Maria und Maya klingt nicht umsonst ähnlich. Maya ist eines der Worte, das es kulturübergreifend gibt. In Mittelamerika gibt es beispielsweise das Volk der Mayas, auch ein hochspirituelles Volk, mindestens der Legende nach. Und du kennst die Biene Maya, die auch ganz freundlich ist.
Es gibt noch so viel mehr Bedeutungen von Maya. Auch bei den germanischen Göttern spielt Maya auch eine Rolle, ebenso bei den Kelten. Maya, also zum einen die Kraft der Illusion. Maya, aber auch etwas, was du verehren kannst als göttliche Manifestation. Maya, die besonderen Kräfte Gottes, die zwar illusionär sind, wie die ganze Welt, aber dich dennoch zum Höchsten führen können. Maya - wenn es um die Kraft der Illusion und die Kraft der göttlichen Mutter geht, ist es Maya (langes A).
Die Lehre von der Maya

Auszug aus dem Buch "Jnana Yoga" von Swami Sivananda (Hrsg.: Divine Life Society, 2007), S. 70-72
Du musst versuchen, die wahre Bedeutung der Maya, die das grundlegende Merkmal der Advaita Vedanta-Schule von Sri Shankara ist, zu verstehen. Der Begriff ‚Maya‘ erscheint in der Bhagavad Gita im Kapitel VII.14 ‚Mama Maya – Mein Blendwerk‘. Die Svetasvatara Upanishade erklärt im Kapitel IV.10: ‚Blendwerk ist die Welt, entstanden aus dem Höchsten Gott‘. Maya ist der Teil der Mulaprakriti (Urnatur, aus der alles entstanden ist), in dem reines Sattva nicht den anderen Gunas Rajas und Tamas untergeordnet ist. In anderen Worten: Der Teil, in dem reines Sattva überwiegt, wird Maya genannt. Die Welt ist Maya, da sie nicht als Wirklichkeit anerkannt werden kann.

Existiert Maya oder nicht? Der Advaitin gibt die Antwort: ‚Diese unergründliche, unbeschreibliche Maya kann nicht als wirklich und nicht als unwirklich angesehen werden. Sie ist ein seltsames Phänomen, das durch kein Naturgesetz erklärt werden kann. Maya ist Anirvachaniya, unmöglich zu beschreiben. Sie ist weder Sat (wirklich) wie Brahman noch Asat (unwirklich) wie das Kind einer unfruchtbaren Frau, das Horn eines Hasen oder der Lotus im Himmel. Die Objekte, die ein Magier erschafft, bestehen nicht wirklich, denn sie sind vergänglich. Der Magier selbst weiß, dass sie lediglich Illusion sind. Doch wir können nicht sagen, dass sie nicht existieren, denn wir sehen die Objekte, wenn auch nur für kurze Zeit. Wir werden nicht auf Objekte aufmerksam, die es nicht gibt, wie den Lotus im Himmel. Ebenso ist es mit dem Phänomen Universum, das als verschieden von Brahman gesehen wird. Es ist wie das Perlmutt, das für Silber gehalten wird. Es ist schwer zu erfassen, wie das Unendliche aus dem Unendlichen entstehen kann und zum Endlichen wird. Der Magier lässt vor unseren Augen einen Mangobaum aus dem Nichts entstehen. Der Baum ist da, doch wir können ihn nicht erklären. Deshalb nennen wir ihn Maya, Illusion.
Wenn wir Brahman erkannt haben, verschwinden alle Namen, Formen und Begrenzungen. Die Welt ist Maya, weil sie nicht die grundlegende Wahrheit der Unendlichkeit Brahmans ist. Irgendwie existiert die Welt und ihre Beziehung zu Brahman ist unbeschreiblich (Anirvachaniya). Die Illusion verschwindet, wenn man Brahman erkennt. Weise, Rishis und Shrutis erklären ausdrücklich, dass Maya vollkommen verschwindet, sobald das Wissen über das Höchste Selbst erwacht. In diesem Sinne - dem Sinne, dass Maya verschwindet, wenn Atma Jnana erwacht - wird gesagt, dass die Welt der Erscheinungen unwirlich ist (Mithya) im Gegensatz zu dem aus sich selbst heraus existierenden und strahlenden unendlichen Brahman. Das Ewige weilt im eigenen Wesen, in seiner eigenen ursprünglichen, reinen Herrlichkeit.
Die Shrutis erklären: ‚Alles, wahrlich, ist Brahman. Es gibt keine Verschiedenheit.‘ Das ist die Erfahrung befreiter Weiser. Sankhya und Tarka (Tarkika) lehren, dass Befreiung durch das Wissen der wahren Natur des Geistes sowie durch Unterscheidung von Geist und Materie erlangt wird. In der Sicht eines Weisen sind Namen und Formen dieser Welt vollkommen verschwunden. Sie sind nur Illusion und können durch Wissen beseitigt werden. Es ist wie die Illusion der Schlange, die verschwindet, sobald das Seil erkannt ist. Deshalb muss klar sein, dass das Universum, das durch Wissen über das Selbst beseitigt wird, auch Illusion ist.
Wenn du endgültig aufgibst, Zeitung zu lesen, und dich für einen Monat in tiefe Meditation begibst, wirst du einen kleinen Eindruck der Welt in deinem Geist bekommen. Allmählich wird sich auch dieser Eindruck auflösen. Die Welt ist nur ein Spiel der beiden Tendenzen Raga und Dvesha (Raga-Dvesha. Wenn diese beiden Tendenzen vernichtet sind, verschwindet die Welt. Da der Geist der weltlichen Menschen mit Leidenschaft, Anhaftung und Verblendung gefüllt ist, erscheint ihnen diese Welt als wirklich.
Einige Philosophen erklären, dass diese Welt wirklich sei, da die Aspiranten ihrer Meinung nach verwirrt sein würden, wenn sie von Anfang an zu ihnen sagten, die Welt sei unwirklich. Allein aus dem Grund, diese Verwirrung zu verhindern, wird gesagt, dass das Universum wirklich sei.
Indische Mythen und Symbole - Kapitel 2: Die Mythologie Vishnus

Die nachfolgenden Texte sind dem Buch "Indische Mythen und Symbole - Schlüssel zur Formenwelt des Göttlichen" des Indologen Heinrich Zimmer entnommen (Originaltitel "Myths and Symbols in Indian Art and Civilization", Bollingen Foundation Inc., New York). Übersetzung aus dem Englischen von Ernst Wilhelm Eschmann, Eugen Diederichs Verlag, München 1981, 5. Aufl. 1993)
Teil 1: Vishnus Maya
Erschauen endloser Wiederholung und ziellosen Wiedererschaffens verkleinerte und vernichtete schließlich die naive Auffassung des siegreichen Indras von sich selbst und der Fortdauer seiner Macht. Seine sich ständig erweiternden Projekte sollten die passende Umgebung für einen natürlichen, selbstgewissen und würdevollen Ichbegriff bilden. Aber als die Zyklen der Vision aufstiegen, öffneten sich Bewußtseinsebenen, in denen Millennien zu Augenblicken, Äonen zu Tagen zusammenschrumpften. Der beschränkte Zustand des Menschen und solch niederer Götter wie er selbst verlor an Realität. Die Lasten und Entzückungen, Erwerbungen und Kümmernisse des Ichs, der ganze Inhalt und das Ergebnis menschlicher Lebenszeit, lösten sich in Unwirklichkeit auf. Was ihm eben noch so wichtig vorgekommen war, erschien ihm nun nicht mehr denn eine vorüberfliegende Phantasie, kaum entstanden und schon wieder vergangen, ungreifbar wie ein Wetterleuchten.
Die Umwandlung wurde durch eine Verschiebung in Indras Sehweise erreicht. Das Weiterwerden der Perspektive veränderte die Bewertung jedes Lebensaspektes der Welt. Es war als ob die Berge, so dauerhaft, wenn vom Standpunkt unserer kurzen menschlichen Lebensspanne von einigen sieben Jahrzehnten betrachtet, plötzlich alle auf einmal aus der Perspektive von ebenso vielen Weltaltern betrachtet würden. Sie würden sich wie Wogen heben und senken, das Feste würde als fließend erscheinen, und große Landmarken würden vor unseren Augen schmelzen. Jede Erfahrung von Maß und Wert würde plötzlich verwandelt werden; der Verstand würde es schwer haben, sich wieder zu orientieren, und ebenso die Gefühle, festen Grund zu finden.
Der Geist des Hinduismus verbindet solche Vorstellungen wie »vorübergehend, immer wechselnd, entfliehend, immer wiederkehrend« mit dem Begriff des »Unrealen« und umgekehrt »unvergänglich, wechsellos, standhaft und ewig« mit dem des »Realen«. So lange die Erfahrungen und Empfindungseindrücke, welche durch das Bewusstsein eines Individuums strömen, noch nicht von einer erweiternden, die Werte richtig stellenden Vision berührt sind, betrachtet es die vergänglichen Kreaturen, die im unendlichen Zyklus des Lebens (Samsara, der Kreis der Wiedergeburten) auftauchen und verschwinden, als völlig real. Aber im Augenblick, wo ihr vor-überflutender Charakter erkannt ist, erscheinen sie fast unreal, als eine Illusion oder Fata morgana, eine Täuschung der Sinne, die zweifelhafte Klitterung eines allzu beschränkten, ichgerichteten Bewußtseins. Auf diese Weise erfahren und begriffen ist die Welt Maya-maya, »aus dem Stoff der Maya«. Maya ist »Kunst«: dasjenige, durch was ein Künstliches, eine Erscheinung, hervorgebracht wird.
Das Substantiv Maya ist etymologisch mit »messen« verwandt. Es ist aus der Wurzel ma gebildet mit der Bedeutung "messen" oder "auslegen" (wie z. B. den Grundriß eines Gebäudes oder die Umrisse einer Figur); hervorbringen, Kontur geben oder schaffen, zur Erscheinung bringen bzw. in Szene setzen.« Maya ist das Ausmessen oder die Schöpfung oder das zur Erscheinungbringen der Formen; Maya ist jede Illusion, jeder Trick, jedes Kunststück, jeder Betrug, jede Taschenspielerei, Zauberei oder Hexerei; ein illusorisches Bild oder eine Erscheinung, ein Phantasma, eine Gesichtstäuschung; Maya ist auch jeder diplomatische Trick oder Einfall politischer Geschicklichkeit mit Betrugsabsicht. Die Maya der Götter ist ihre Macht, verschiedene Erscheinungsformen anzunehmen, indem sie nach Belieben die einzelnen Aspekte ihres subtilen Wesens ausspielen. Aber die Götter sind selbst die Hervorbringung einer größeren Maya: der spontanen Selbstumformung einer im Innern ungeschiedenen, allerzeugenden göttlichen Substanz. Und diese größere Maya bringt nicht die Götter allein, sondern auch das All hervor, in dem sie sind und handeln. Die Gesamtheit der Weltalle, die gleichzeitig im Raum existieren und derer, die in der Zeit aufeinanderfolgen, all die Ebenen des Seins und die natürlichen oder übernatürlichen Geschöpfe dieser Ebenen sind Manifestierungen eines unerschöpflichen, ursprünglichen und ewigen Seinsbrunnens. Ihre Offenbarung geschieht durch das Spiel der Maya. In der Epoche der Nichtmanifestation, dem Zwischenspiel der kosmischen Nacht, hört die Maya zu wirken auf und die Ausformungen ihres Spiels verschwinden.
Maya ist Dasein: Sowohl die Welt, derer wir gewahr werden, als wir selbst, die wir in dieser entstehenden und sich wieder auflösenden Umgebung enthalten sind, unsererseits selbst entstehend und wieder verschwindend. Maya ist gleichzeitig aber auch die höchste Kraft, welche das Spiel der Gestalten schafft und belebt: der dynamische Aspekt der universellen Substanz. So ist sie im Selben Wirkung (der Strom des kosmischen Daseins) und Ursache (die schaffende Gewalt); in diesem Zusammenhang ist sie als Shakti, »kosmische Energie« bekannt. Das Hauptwort Sakti stammt von der Wurzel sak mit der Bedeutung »fähig sein, möglich sein«. Sakti ist »Macht, Geschicklichkeit, Fähigkeit, Möglichkeit, Kraft, Energie, Tapferkeit; königliche Gewalt; künstlerische Bildekraft, dichterische Kraft, Genie; die Kraft oder Bedeutung eines Wortes oder Begriffes; die Kraft in der Kraft, die notwendig ihre notwendige Wirkung hervorruft; ein eiserner Speer oder Lanze, Pike, Pfeil; ein Schwert«; Sakti ist das weibliche Geschlechtsorgan; Sakti ist die aktive Kraft einer göttlichen Persönlichkeit, mythologisch als deren Göttin-Gemahlin und Königin aufgefaßt.
Maya-Shakti wird als die weltbeschützende weibliche, mütterliche Seite des Höchsten Seins angesehen und steht als solche für die spontane, liebende Annahme der greifbaren Realität des Lebens. Das Leiden, die Opfer, der Tod und die Kümmernisse erduldend, die zu jeder Erfahrung des Wandelbaren gehören, bestätigt sie, ist, vertritt und genießt den Wahn der manifestierten Formen. Sie ist des Lebens schöpferische Freude: sie ist die Schönheit, das Wunder, die Verlockung und die Verführung der lebendigen Welt. Sie flößt uns die Hingabe an die ewig wandelnden Erscheinungen des Daseins ein und ist diese Hingabe selbst.
Maya-Shakti ist Eva, »das Ewig-Weibliche«; sie, die aß, ihren Gesellen zum Essen verführte und selbst der Apfel war. Vom Blickpunkt des männlich-geistigen Prinzips (das auf der Suche nach dem Dauernden, Ewiggültigen und Göttlich-Absoluten ist) stellt sie das Rätsel aller Rätsel dar.
Nun ist der Charakter der Maya-Shakti-Devi (devi ist »Göttin«) auf mannigfache Weise zweideutig. Nachdem sie das All und das Individuum (Makro- und Mikrokosmos) als untereinander verbundene Manifestationen des Göttlichen geboren hat, bläst Maya sogleich Bewusstsein in die Hüllen ihrer vergänglichen Hervorbringung. Das Ich ist wie in einem Spinnennetz, einem sonderbaren Kokon eingeschlossen. »Dies um mich herum« und »mein eigenes Dasein« — äußere und innere Erfahrung — sind Kette und Einschlag des subtilen Gewebes. Eingewiegt durch uns selbst und den Einfluß unserer Umgebung und die Verblüffungskunststücke der Maya als völlig real ansehend, erdulden wir ein endloses schmerzliches Spiel von schmeichelndem Blendwerk, Begierden und Tod. Von einem Standpunkt aber eben oberhalb unserer menschlichen Art (wie er in der überzeitlichen, esoterischen Weisheit vertreten wird und dem unbegrenzten, überindividuellen Bewußtsein asketischer Yoga-Erfahrung bekannt ist) erscheint Maya — die Welt, das Leben, das Ich, an das wir uns klammern — so flüchtig und verfließend wie Wolken und Nebel.
Das Bestreben indischen Denkens war immer, das Geheimnis jener Täuschung zu erkennen und wenn möglich durch sie hindurch in eine Wirklichkeit außerhalb und jenseits der gefühls- und verstandesmäßigen Zusammenballungen zu gelangen, die unser bewußtes Sein zudecken. Dies war die Bemühung, zu der Indra aufgerufen wurde, als seine Augen durch die Erscheinung und Lehre des göttlichen Kindes und des alterslosen Weisen geöffnet wurden.
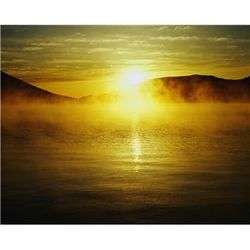
Teil 2: Die Wasser des Daseins
Die Hindu-Mythologie handelt erzählend vom Rätsel der Maya in einer Bildersprache, die auch dem gewöhnlichen Verstand die philosophischen Hintergründe des verborgenen Spieles zugänglich macht. Diese Erzählungen wurden in einer großen Überlieferung von Mund zu Mund weitergegeben; heute erscheinen sie in verschiedenen Versionen. Eine bedeutende Zahl dieser Variationen haben in literarischen Zeugnissen ihren Niederschlag gefunden; andere dauern in der flüssigen Form ungeschriebenen Volkswissens fort.
Von einem halbgöttlichen Asketen Narada wird erzählt, der einst das Höchste Wesen selbst bat, ihn das Geheimnis seiner Maya zu lehren. In der Mythologie des Hinduismus ist dieser Narada ein Lieblingsvorbild des Gläubigen auf dem »Weg liebender Hingabe« (Bhakti Marga). Als Lohn für seine ausgedehnte, glühende Askese war ihm Vishnu in seiner Einsiedelei erschienen und hatte ihm die Erfüllung einer Bitte gewährt. Als er demütig seinen höchsten Wunsch äußerte, belehrte ihn der Gott nicht mit Worten, sondern indem er ihn einem beklemmenden Abenteuer unterwarf. Die literarische Form der Erzählung ist uns in der Matsya Purana, einer Sanskrit-Kompilation, überliefert, die ihre gegenwärtige Form in der klassischen Periode des mittelalterlichen Hinduismus erhielt, ungefähr im vierten Jahrhundert n. Chr. Sie erscheinen dort als Erzählung eines Heiligen namens Vyasa.
Eine Gruppe heiliger Männer hatte sich um den verehrungswürdigen Vyasa in seiner Waldeinsamkeit versammelt. »Du weißt die göttliche ewige Ordnung«, hatten sie zu ihm gesagt, »darum enthülle uns das Geheimnis von Vishnus Maya.«
»Wer kann die Maya des Höchsten Gottes verstehen — ausgenommen er selbst? Vishnus Maya legt ihren Bann über uns alle. Vishnus Maya ist unser gemeinsamer Traum. Ich kann Euch nur eine Erzählung aus uralten Zeiten vortragen, wie diese Maya in einem einzelnen, besonders lehrreichen Beispiel ihre Wirkung wob.«
Die Besucher waren begierig zu hören. Vyasa begann:
»Es war einmal ein junger Prinz, Kamadamana, ,der Zähmer der Begierden', der, sein Verhalten in Übereinstimmung mit dem Geist seines Namens einrichtend, sein Leben in den Übungen der härtesten Selbstzucht verbrachte. Aber sein Vater, der immer wünschte, daß er heiraten möge, sprach einst bei einer gewissen Gelegenheit zu ihm: ,Kamadamana, mein Sohn, was ist mit Dir? Warum führst Du kein Weib heim? Die Ehe bringt die Erfüllung aller Wünsche des Mannes und die Gewißheit vollkommenen Glücks. Die Frau ist die eigentliche Wurzel allen Glücks und alles Wohlseins. Darum geh, lieber Sohn, und heirate.'

Aus Ehrfurcht vor seinem Vater antwortete der Jüngling nichts. Aber als der König weiter in ihn drang und ihn immer wieder bat, erwiderte Kamadamana: ,Teuerster Vater, ich habe mich der Richtung des Verhaltens gelobt, welche durch meinen Namen bezeichnet wird. Die göttliche Macht Vishnus wurde mir enthüllt, die sowohl uns selbst wie alles in der Welt erhält und versteckt hält.'
Sein königlicher Vater hielt nur einen Augenblick inne, um den Fall zu überlegen und verschob dann geschickt seine Beweisgründe von der Ebene persönlichen Vergnügens auf diejenige der Pflicht. Ein Mann muß heiraten, erklärte er, um Nachkommenschaft zu zeugen, damit seine Ahnengeister im ,Jenseits der Vorfahren' nicht die Speise- und Trankopfer ihrer Nachkommenschaft vermissen und in unbeschreibliche Not und Verzweiflung stürzen.
,Lieber Vater', erwiderte der Jüngling, ,ich bin durch Tausende von Leben gegangen. Ich habe viele hundert Male das Altern und den Tod erlitten. Ich habe Frauen erkannt und das Leid, das sie bringen. Ich war Gras und Strauch, Ranke und Baum; ich lebte zwischen Vieh und wilden Tieren. Viele hundert Male bin ich ein Brahmane, eine Frau, ein Mann gewesen. Ich kostete von der Seligkeit in Shivas himmlischen Wohnungen; ich weilte zwischen Unsterblichen. Selbst unter den übermenschlichen Wesen gibt es keines, dessen Form ich nicht mehr als einmal angenommen hätte: ich bin ein Dämon, ein Kobold, ein Wächter der Schätze der Erde gewesen; ich war ein Flußgeist; ich war eine Schöne des Himmels; ich war aber auch ein König der Schlangendämonen. Jedesmal, wenn sich der Kosmos auflöste, um wieder in die formenlose Wesenheit des Göttlichen zurückverschlungen zu werden, verschwand auch ich; und wenn das All dann wieder hervortrat, kehrte auch ich zum Dasein zurück, um andere Reihen von Wiedergeburten zu durchleben. Wieder und wieder bin ich den Täuschungen des Daseins zum Opfer gefallen — und immer, weil ich ein Weib nahm.'
,Laß mich Dir', fuhr der Jüngling fort, ,etwas erzählen, was mir während meiner vorletzten Inkarnation geschah. Während dieser Existenz war mein Name Sutapas, der, dessen strenge Übungen gut sind; ich war ein Asket. Und meine glühende Hingabe an Vishnu, den Herrn des Alls, gewann mir seine Gnade. Erfreut, weil ich so viele Gelübde erfüllt hatte, erschien er vor meinen leiblichen Augen, auf Garuda, dem Himmelsvogel, schwebend. ,Ich will Dir eine Gabe gewähren', sagte er. ,Was Du auch wünschest soll Dein sein.'
,Wenn ich Dir wohlgefällig bin', erwiderte ich dem Herrn des Alls, ,so laß mich Deine Maya erkennen.' ,Was sollte es Dir frommen, meine Maya zu erkennen?' antwortete der Gott. ,Ich will Dir lieber Überfluß des Lebens, Erfüllung Deiner menschlichen Pflichten und Aufgaben schenken, großen Reichtum, Gesundheit, Freude und heldenhafte Söhne.'
,Das, genau das', sagte ich, ,ist es ja, wovon ich befreit werden und was ich überwinden möchte.' ,Niemand kann meine Maya verstehen', fuhr der Gott fort. ,Niemand hat sie je verstanden, und niemals wird jemand sein, der in ihr Geheimnis eindringt. Vor langer, langer Zeit lebte ein gottgleicher heiliger Seher, Narada genannt. Er war ein Sohn des Gottes Brahma selbst und voll leidenschaftlicher Hingabe für mich. Wie Du erwarb er sich meine Gnade, und ich erschien ihm, wie ich Dir jetzt erscheine. Ich verhieß ihm eine Gabe, und er äußerte denselben Wunsch, den Du geäußert hast. Auch er bestand darauf wie Du, obgleich ich ihn warnte, nicht weiter nach dem Geheimnis meiner Maya zu forschen. So sprach ich zu ihm: ,Tauche in das Wasser dort drüben, und Du sollst das Geheimnis meiner Maya erfahren.' Narada tauchte in den Teich und wieder empor — in Gestalt eines Mädchens.
Narada entschritt dem Wasser als Sushila, ,die Tugendhafte', Tochter des Königs von Benares. Und da sie in der Blüte ihrer Jugend stand, versprach sie ihr Vater dem benachbarten König von Vidarbha zur Ehe. Im Leib eines Mädchens genoß der heilige Seher und Büßer die ganzen Wonnen der Liebe. Als seine Zeit erfüllt war, starb der alte König von Vidarbha, und Sushilas Gatte folgte ihm auf den Thron. Die wunderschöne Königin hatte viele Söhne und Enkel und war unvergleichlich glücklich.
Doch im Laufe der Zeit brach schließlich eine Fehde zwischen Sushilas Gatten und ihrem Vater aus, die sich zu einem wütenden Krieg entwickelte. In einer einzigen Riesenschlacht wurden viele von ihren Söhnen und Enkeln, ihr Vater und ihr Gatte erschlagen. Als sie von dem Gemetzel hörte, begab sie sich trauernd aus der Hauptstadt zum Schlachtfeld, wo sie ihre Klagen zum Himmel steigen ließ. Sie befahl, einen mächtigen Scheiterhaufen zu errichten und ließ die toten Leiber ihrer Verwandten, ihrer Brüder, Neffen und Enkel und schließlich Seite bei Seite den Leib ihres Gatten und den ihres Vaters darauf legen. Mit eigener Hand hielt sie die Fackel an den Scheiterhaufen, und als die Flammen stiegen, schrie sie laut: ,Mein Sohn, mein Sohn!' Und als sie zischten und prasselten, warf sie sich selbst in den großen Brand. Sofort wurde die Glut kühl und durchsichtig, der Scheiterhaufen wurde zum Teich. Und inmitten der Wasser fand sich Sushila selbst, aber wieder als den Heiligen Narada. Der Gott Vishnu nahm ihn bei der Hand und führte ihn aus der kristallenen Flut heraus.
Als der Gott und der Heilige wieder am Ufer waren, fragte Vishnu mit rätselhaftem Lächeln: ,Wer ist dieser Sohn, dessen Tod Du bejammerst?' Narada stand verwirrt und beschämt. Der Gott fuhr fort: ,Dies ist der Schein meiner Maya, jammervoll, dunkel, fluchbeladen. Weder der lotosgeborene Brahma noch ein anderer der Götter, Indra, nicht einmal Shiva, können ihre tiefenlose Tiefe ausloten. Warum und wie solltest gerade Du diese Unermeßlichkeit erkennen?'
Narada betete, daß ihm vollendeter Glaube und Hingabe gewährt werden möge und außerdem die Gnade, dies Geschehnis in allen kommenden Lebensläufen zu erinnern. Ferner erbat er noch, daß der Teich, der für ihn zur Quelle der Einweihung geworden war, ein heiliger, von Pilgern aufgesuchter Platz werden möge. Sein Wasser solle — dank der immer bleibenden verborgenen Gegenwart des Gottes darin, nachdem er einmal hineingeschritten war, den Heiligen aus der magischen Tiefe emporzuleiten — mit der Macht begabt sein, alle Sünden abzuwaschen. Vishnu gewährte diese frommen Wünsche und verschwand sogleich, um zu seinem fernen Wohnsitz im Milchmeer zurückzukehren.
,Ich habe Dir diese Geschichte erzählt', schloß Vishnu, bevor er gleicherweise den Büßer Sutapas verließ, ,um Dich zu belehren, wie das Geheimnis meiner Maya unerforschbar und nicht zu erkennen ist. Wenn Du willst, magst auch Du in das Wasser tauchen, und Du wirst erfahren, warum dies so ist.'
Daraufhin tauchte Sutapas (oder Prinz Kamadamana in seiner vorletzten Inkarnation) in das Wasser des Teiches. Gleich Narada entstieg er ihm als ein Mädchen und wurde so in den Stoff eines anderen Lebens eingehüllt.«
Es handelt sich hier um eine mittelalterliche, literarische Version des Mythos. Aber die Geschichte wird noch als eine Art Kinderstubenmärchen in Indien erzählt und ist vielen von Kindheit an vertraut. Im neunzehnten Jahrhundert gebrauchte der bengalische Heilige Ramakrishna die volkstümliche Form der Sage als Gleichnis in seinen Unterweisungen. Auch in diesem Fall war Narada, der Mustergläubige, der Held. Durch lange Askese und fromme Selbstentäußerungen hatte er Vishnus Gnade gewonnen. Der Gott war dem Heiligen in seiner Einsiedelei erschienen und hatte ihm die Erfüllung eines Wunsches gewährt. »Zeige mir die magische Macht Deiner Maya«, hatte Narada gebeten, und der Gott hatte erwidert: »Ich will es gewähren. Komm mit mir«; doch wieder mit dem rätselhaften Lächeln auf seinen schön geschwungenen Lippen.
Aus dem freundlichen Schatten der Einsiedlerhütte führte Vishnu Narada über einen öden Streifen Landes, der wie Metall unter der erbarmungslosen Glut einer versengenden Sonne brannte. Die beiden hatten bald großen Durst. In dem gleißenden Licht gewahrten sie in einiger Entfernung die Strohdächer eines winzigen Weilers. Vishnu fragte: »Willst Du gehen und mir etwas Wasser holen?«
»Gewiß, Herr«, erwiderte der Heilige und begab sich zu den Hütten in der Ferne, während der Gott sich im Schatten eines Felsens niederließ um seine Rückkehr zu erwarten.
Als Narada den Weiler erreichte, klopfte er an der ersten Tür. Ein wunderschönes Mädchen öffnete ihm, und der heilige Mann erfuhr etwas, wovon er bisher nicht einmal geträumt hatte: ihre Augen bezauberten ihn. Sie glichen denen seines göttlichen Herrn und Freundes. Er stand staunend und vergaß schlechthin weswegen er gekommen war. Das freundliche Mädchen bot ihm sanft den Willkommen, und ihre Stimme war wie eine goldene Schlange um seinen Hals. Wie im Traum trat er ein.
Die Bewohner des Hauses waren voller Höflichkeit gegen ihn, aber nicht im geringsten verlegen. Er wurde ehrenvoll empfangen als ein heiliger Mann, aber irgendwie nicht wie ein Fremder, sondern eher wie ein alter verehrter Bekannter, der lange fort war. Narada blieb bei ihnen, beeindruckt von ihrer Fröhlichkeit und ihrem Anstand und fühlte sich ganz zu Hause. Niemand fragte ihn, warum er gekommen sei; es war, als ob er seit unvordenklichen Zeiten zur Familie gehört hätte. Und als er nach einer gewissen Zeit den Vater um die Hand des Mädchens bat, war dies nicht mehr als was jedermann erwartet zu haben schien. Er wurde ein Mitglied der Familie und teilte mit ihr die altehrwürdigen Mühen und einfachen Freuden des Bauernlebens.
Zwölf Jahre vergingen; er hatte drei Kinder bekommen. Als sein Schwiegervater starb, wurde er das Haupt der Familie, erbte das Land und verwaltete es. Er züchtete Vieh und bebaute den Boden. Im zwölften Jahr war die Regenzeit außerordentlich heftig: die Ströme schwollen an, Sturzbäche ergossen sich von den Himmeln, und das kleine Dorf wurde von einer plötzlichen Flut überschwemmt. In der Nacht wurden die Strohhütten und das Vieh fortgerissen und jedermann floh.
Mit der einen Hand sein Weib stützend, mit der anderen zwei seiner Kinder führend, das kleinste auf der Schulter, schritt Narada eilends fort. Durch die pechschwarze Dunkelheit vorwärtshastend, vom Regen gepeitscht, watete er durch schlüpfrigen Schlamm, wankte er durch wirbelnde Wasser. Die Last war mehr als er in den schwer an seinen Beinen ziehenden Strudeln bewältigen konnte. Er stolperte, das Kind glitt von seiner Schulter und verschwand in der tosenden Dunkelheit. Mit einem verzweifelten Schrei ließ Narada die anderen Kinder los, um nach dem Kleinsten zu greifen, aber es war schon zu spät. Inzwischen hatte die Flut die beiden anderen fortgenommen, und noch bevor er das Unglück fassen konnte, sein Weib von seiner Seite gerissen, ihm selbst die Füße unter dem Leib fortgezogen und ihn kopfüber wie einen Klotz in den Sturzbach geschleudert. Bewußtlos wurde Narada schließlich an einen kleinen Felsen angetrieben. Als er aus seiner Ohnmacht erwachte, sahen seine Augen auf eine weite Fläche schmutzigen Wassers, und er konnte nichts mehr tun als weinen.
»Kind!« Er hörte eine vertraute Stimme, die sein Herz fast zum Stillstehen brachte. »Wo ist das Wasser, das Du für mich holen wolltest? Ich warte schon länger als eine halbe Stunde.«
Narada wandte sich um. Anstelle des Wassers sah er die strahlende Wüste in der Mittagssonne. Neben ihm stand der Gott. Die grausamen Linien des schönen Mundes, auf dem noch das Lächeln schwebte, teilten sich zu der sanften Frage: »Begreifst Du jetzt das Geheimnis meiner Maya?«
Von der Zeit der frühen Veden an bis zum heutigen Hinduismus ist das Wasser als eine äußerlich faßbare Manifestation der göttlichen Essenz angesehen worden. »Am Anfang war alles gleich einem Meer ohne Licht«, erklärt eine alte Hymne; und bis zu unseren Tagen ist einer der einfachsten und gewöhnlichsten Gegenstände der Verehrung im täglichen Ritual ein mit Wasser gefüllter Krug oder Becher, welcher die Gegenwart der Gottheit versinnbildlicht und die Stelle eines geweihten Bildes vertritt. Für die Dauer des Gottesdienstes wird das Wasser als Wohnort oder Sitz (Pitha) des Gottes angesehen.
In unseren beiden Narada-Erzählungen war der bezeichnende Zug die vom Wasser herbeigeführte Verwandlung. Dies war als eine Wirkung der Maya zu verstehen; denn das Wasser gilt als eine erste Materialisation der Maya-Energie Vishnus. Das Wasser ist das lebenserhaltende Element, das in Gestalt von Regen, Lebenssaft, Milch und Blut durch die Natur kreist. Es ist Substanz, die mit der Macht fließenden Wandels begabt ist. Darum heißt, im Symbolismus des Mythos, in das Wasser tauchen, in das Geheimnis der Maya eingehen; heißt, nach dem letzten Geheimnis des Lebens suchen. Als Narada, der menschliche Jünger, über dies Geheimnis belehrt zu werden erbat, antwortete der Gott ihm nicht durch eine Lehre in Wort oder Spruch. Statt dessen wies er nur auf Wasser als das Element der Einweihung.
Grenzenlos und unvergänglich sind die kosmischen Wasser gleicherzeit die unbefleckte Quelle aller Dinge und ihr schreckliches Grab. Mittels der Macht der Selbstverwandlung entläßt die Energie der Tiefe individualisierte Formen oder nimmt sie selbst an, die mit vorübergehendem Leben und mit beschränktem Ich-Bewußtsein ausgestattet sind. Für eine Weile nährt und erhält sie diese mit ihrer lebenspendenden Essenz. Dann löst sie sie wieder auf ohne Mitleid oder Unterscheidung, zurück in die unbekannte Energie, aus der sie einst entstiegen. Das ist Werk und Wesen der Maya, des allverzehrenden, universellen Weltschoßes.
Solche Doppeldeutigkeit eines Schrecklichen und doch Gütigen ist ein vorherrschender Zug in allem Symbolismus und aller Mythologie der Hindus. Sie gehört wesentlich zu der Hinduanschauung vom Göttlichen. Nicht nur die Höchste Gottheit und ihre Maya, sondern auch jeder Untergott in den wimmelnden Pantheons dieser überwältigenden Tradition ist ein Paradox: machtvoll sowohl zu helfen wie zu zerstören; durch Wohltaten zu verstricken wie mit einem Schlag, der tötet, zu erlösen.

Teil 3: Die Wasser des Nichtseins
Der Symbolismus der Maya wird weiter in einem großartigen Mythos entwickelt, der die jede Vernunft sprengenden Abenteuer eines mächtigen Weisen, Markandeya, während der Pause der Nichtmanifestation zwischen der Auflösung und der Wiedererschaffung des Alls beschreibt. Durch einen wunderbaren und seltsamen Zufall erblickt Markandeya Vishnu in einer Reihe archetypischer Umwandlungen: zuerst in der elementaren Verkleidung des kosmischen Meeres; dann als Riesen, der auf dem Wasser ruht; dann wiederum als göttliches Kind, das einsam unter dem Baum des Kosmos spielt; und endlich als eine majestätische Wildgans, deren Atem die magische Melodie der Schöpfung und Auflösung der Welt darstellt.
Der Mythos beginnt mit einer Überschau des Absinkens der kosmischen Ordnung während des langen, aber unumkehrbaren Vorbeizugs der vier Yuga. Das heilige Dharma verschwindet Viertel nach Viertel aus dem Leben der Welt, bis das Chaos eintritt und die Menschen am Ende nur voller Gier und Bosheit sind. Da ist auch nicht einer, nicht ein einziger mehr, in dem erleuchtende Güte (Sattva) wohnt, kein wirklicher Weiser, kein Heiliger, keiner, der Wahrheit redet und zu seinem geheiligten Wort steht. Der nach außen heilig scheinende Brahmane ist nicht besser als der Narr. Alte Leute, der wahren Weisheit, des tiefen Alters verlustig, möchten sich wie die Jugend benehmen, und dieser mangelt die Offenheit. Die gesellschaftlichen Klassen haben ihre unterscheidenden und würdegebenden Eigenschaften aufgegeben; Lehrer, Fürsten, Handelsvolk und Dienerschaft räkeln sich in ausnahmsloser Gemeinheit. Der Wille, sich zu etwas Höherem zu erheben, ist erloschen. Alle Bande der Sympathie und Liebe haben sich aufgelöst; die engste Ichsucht herrscht. Von einander ununterscheidbare Dummköpfe konglomerieren zu einer Art von zähem, unschmackhaftem Teig. Wenn dieses Elend die einst harmonisch geordnete Menschheit befallen hat, hat die Substanz des Weltorganismus sich über jede Rettungsmöglichkeit hinaus verschlechtert, und das All ist reif für die Auflösung.
Der Zyklus hat sich vollendet. Ein Tag Brahmas ist vorüber. Vishnu, das Höchste Wesen, von dem einst die Welt in Reinheit und Ordnung ausging, fühlt nun in sich den Drang, den heruntergekommenen Kosmos in seine göttliche Substanz zurückzunehmen. So gelangt der Schöpfer und Erhalter des Universums dazu, seinen zerstörerischen Aspekt zu offenbaren: er wird das unfruchtbare Chaos verschlingen und alle beseelten Wesen zerschmelzen, von Brahma hoch oben, dém inneren Herrscher und kosmischen Lebensgeist des All-Leibes, herunter bis zu dem letzten Grashalm. Hügel und Flüsse, Berge und Meere, Götter und Titanen, Kobolde und Geister, Tiere, himmlische Wesen und Menschen, alle müssen im Höchsten Wesen wieder aufgenommen werden.
In dieser indischen Schau des Zerstörungsvorganges wird der regelmäßige Ablauf des indischen Jahres — starke Hitze und Trockenheit, die mit sturzbachartigen Regen abwechselt — so vergrößert, daß er, anstatt das Leben zu erhalten, es vernichtet. Die Wärme, die sonst reift, und die Feuchtigkeit, die nährt, wenn sie in wohltuender Zusammenarbeit abwechseln, werden nun tötend. Vishnu beginnt seine furchtbare letzte Arbeit, indem er seine unendliche Energie in die Sonne ergießt. Er selbst wird die Sonne. Mittels ihrer grimmigen, verzehrenden Strahlen zieht er das Augenlicht aller lebenden Wesen in sich hinein. Die Welt vertrocknet und welkt, die Erde birst, und durch tiefe Risse wirft sich tödliche Hitze auf die göttlichen Wasser der unterirdischen Tiefe, die aufgesaugt und verschluckt werden. Wenn nun der Lebenssaft sowohl aus dem eiförmigen kosmischen Leib wie all den Leibern seiner Geschöpfe endgültig verschwunden ist, wird Vishnu zum Wind, zum kosmischen Lebenshauch, und entreißt allen Kreaturen die belebende Luft. Gleich dürren Blättern wirbelt die versengte Substanz des Alls unter dem Zyklon. Die Reibung entzündet den tumultuösen Tanz der hochentflammbaren Materie; der Gott ist zu Feuer geworden. Alles geht in einem Riesenweltbrand auf, um dann zu schwelender Asche zusammenzusinken.

Schließlich gießt Vishnu in Gestalt einer großen Wolke einen Sturzregen aus, süß und rein wie Milch, um den Brand der Welten zu löschen. Der versengte und gequälte Leib der Erde weiß jetzt endlich seine letzte Erlösung: das endgültige Erlöschen, das Nirvana. Unter der Flut des zu Regen gewordenen Gottes wird er in das Meer des Ursprungs zurückgenommen, dem er einst in der Frühe des All-Morgens entstieg. Der fruchtbare Wasserschoß schlingt die Asche aller Schöpfung wieder in sich; die letzten Elemente schmelzen in das ungeschiedene Flüssige ein, aus dem sie einst kamen. Der Mond und die Sterne lösen sich auf, und die steigende Flut wird zu einer grenzenlosen Wasserfläche. Dies ist die Pause einer Brahma-Nacht.
Vishnu schläft. Wie eine Spinne, die den Faden, der einst aus ihrem eigenen Organismus hervorging, hinaufgeklettert ist, indem sie ihn wieder in sich einschlang, hat der Gott das Gespinst des Universums in sich hineingenommen. Allein, eine riesige Gestalt auf der unsterblichen Substanz des Ozeans, halb untergetaucht, halb auf den Wogen flutend, genießt er seinen Schlummer. Da ist keiner, der ihn erblicken, keiner, der ihn begreifen könnte; da ist kein Wissen von ihm außer in ihm selbst.
Dieser Riese, »Herr der Maya, und der kosmische Ozean, auf dem er ruht, stellen die Doppelmanifestation eines und desselben Wesens dar. Denn der Ozean sowohl als die menschliche Gestalt sind beide Vishnu. Weiter: da in der Hindu-Mythologie die Schlange (Naga) das Sinnbild des Wassers ist, wird Vishnu gewöhnlich auf den Windungen einer Riesenschlange ruhend dargestellt, seinem symbolischen Lieblingstier, der Schlange Ananta, "Endlos". Vishnu ist so auch das Reptil, nicht nur die riesenhafte, anthropomorphe Gestalt und das grenzenlose Element.
Auf dem Schlangenozean seiner eigenen unsterblichen Substanz verbringt der Herr des Kosmos die Nacht des Alls. Innerhalb des Gottes ist der Kosmos wie ein ungeborenes Kind inmitten der Mutter; und hier ist alles zu seiner ursprünglichen Vollkommenheit wiederhergestellt. Obgleich da draußen nur Dunkelheit herrscht, gedeiht in dem göttlichen Träumer eine ideale Vision, wie das All sein sollte. Sich von Niedergang, Verwirrung und Unglück erholend, läuft die Welt wieder in harmonischen Bahnen.
Während dieses verzauberten Zwischenspieles nun geschah nach unserer Legende ein phantastisches Vorkommnis: Ein heiliger Mann, Markandeya mit Namen, wandert innerhalb des Gottes über die friedevolle Erde, ein zielloser Pilger, der mit Freude die erhebende Schau der idealen Weltvision betrachtet. Dieser Markandeya ist eine wohlbekannte mythische Figur, ein Heiliger mit unendlichem Leben. Viele tausend Jahre ist er alt, aber von nie ablassender Kraft und Klugheit. Bei seiner Wanderung durch das Innere von Vishnus Leib besucht er die heiligen Einsiedeleien und erbaut sich an dem gottgefälligen Streben der Weisen und ihrer Schüler. An Schreinen und geweihten Orten hält er inne, um seine Verehrung darzubringen, und sein Herz jubelt über die Frömmigkeit der Völker in den Ländern, die er durchstreift.
Aber jetzt geschieht ein Unfall. Im Lauf seiner ziel- und endlosen Spaziergänge entgleitet der handfeste alte Mann versehentlich dem Mund des allenthaltenden Gottes. Im ungeheuren Schweigen der Nacht schläft Vishnu, mit ein wenig geöffneten Lippen; sein Atem geht mit einem tiefen, klangvollen, rhythmischen Laut. Und der erstaunte Heilige, von des Schläfers Riesenlippe fallend, stürzt kopfüber in das kosmische Meer.

Infolge Vishnus Maya erblickt Markandeya zuerst den schlafenden Riesen gar nicht, sondern nur das dunkle, sich nach allen Richtungen hin in die sternenlose Nacht ausdehnende, allumfassende Meer. Verzweiflung packt ihn, und er fürchtet für sein Leben. Im nächtlichen Wasser platschend wird er plötzlich nachdenklich, grübelt und beginnt zu zweifeln. »Ist es ein Traum? Oder bin ich im Banne einer Illusion? Wahrlich, all dies Befremdliche muß ein Erzeugnis meiner Einbildung sein, denn die Welt, wie ich sie in ihrem harmonischen Lauf beobachtet habe, verdient nicht diese Vernichtung wie sie nun plötzlich über sie hereinzubrechen scheint. Ich sehe keine Sonne, keinen Mond, ich fühle keinen Wind; alle Berge sind verschwunden und die Erde hat sich aufgelöst. Was ist das für eine Art von Universum, in dem ich mich hier wiederfinde?«
Diese suchenden Überlegungen des Heiligen sind eine Art Kommentar zur Idee der Maya, zum Problem »Was ist real?«, wie es der Hindu faßt. »Realität« ist eine Funktion des Individuums. Sie ist das Ergebnis der besonderen Fähigkeiten und Begrenzungen individuellen Bewusstseins. Während der Heilige durch das Innere des kosmischen Riesen gewandert war, hatte er eine Realität bemerkt, die ihm seiner eigenen Natur kongenial erschien und hatte sie als fest und substantiell betrachtet. Dennoch war sie nur ein Traum oder eine Vision im Gemüt des schlafenden Gottes gewesen. Umgekehrt erscheint während der Nacht die Realität der ursprünglichen Substanz des Gottes dem menschlichen Bewußtsein des Heiligen als ein bestürzendes Wunder. »Es ist unmöglich«, überlegte er, »es kann nicht wirklich sein.«
Das Ziel der Lehren der Hindu-Philosophie und das der Übung in der Yoga-Praxis ist das Überschreiten der Grenzen des individualisierten Bewußtseins. Die mythischen Erzählungen sollen die Weisheit der Philosophen vermitteln und in einer volkstümlichen, bildhaften Form die Erfahrungen oder Ergebnisse des Yoga darlegen. Da sie sich unmittelbar an Einbildungskraft und Intuition wenden, sind sie als Deutung des Daseins für alle zugänglich. Sie werden nicht besonders kommentiert und durchleuchtet. Die Unterhaltungen und Reden der Hauptfiguren enthalten Elemente philosophischer Auslegung und Deutung, aber die Geschichte selbst wird niemals erklärt. Es gibt keinen ausgesprochenen Kommentar über den Sinn des mythologischen Geschehens. Die Erzählung wendet sich stracks an den Hörer, indem sie seine Intuition, seine schöpferische Einbildungskraft wachruft. Sie stachelt und nährt das Unbewußte. Durch eine Beredsamkeit der Umstände eher als der Worte dient die Mythologie Indiens ihrer Aufgabe als das volkstümliche Fahrzeug für die esoterische Weisheit der Yogaerfahrung und der orthodoxen Religion.
Die unmittelbare Wirkung ist immer gesichert; sind doch diese Geschichten nicht die Erzeugnisse individueller Erfahrungen und der Reaktionen darauf. Ihre Entstehung, Hortung und Kontrolle erfolgt vielmehr aus dem kollektiven Wirken und Denken der religiösen Gemeinschaft. Ihr Gedeihen ruht auf der immer erneuten Zustimmung sich folgender Geschlechter. Ein anonymer, schöpferischer Vorgang, ein kollektives, ahnendes Empfangen formen sie um und erfüllen sie mit neuem Sinn. Ihre Wirkung geht zunächst auf eine unterbewußte Ebene, die Intuition, das Gefühl und die Einbildungskraft anrührend. Ihre Einzelheiten prägen sich selbst dem Gedächtnis ein, um dann nieder zu sinken und die tieferen Schichtungen der Psyche zu formen. Bei näherem Nachdenken und immer wieder Nachdenken zeigt sich dann, daß die bedeutsamen Episoden dieser Erzählungen verschiedene Sinnschattierungen enthüllen können, je nach den Erfahrungen und Lebensnotwendigkeiten des betreffenden Individuums.

Die Mythen und Sinnbilder Indiens widerstreben jeder Intellektualisierung und Zurückführung auf feststehende Bedeutungen. Solches Vorgehen würde sie nur ihrer Magie berauben. Sind sie doch von einem viel archaischeren Typus als die uns aus der griechischen Literatur bekannten: die Götter und Mythen Homers und die Helden der attischen Tragödie bei Äschylos, Sophokles und Euripides. Letztere, vom Genie der Dichter neugeformt, sind weitgehend individuelle Schöpfungen und ähneln in dieser Beziehung unseren modernen Versuchen, sich überlieferter Formgehalte zu bemächtigen. Wie in den Werken Shelleys und Swinburnes, oder — und vor allem — Wagners, finden wir in den nachhomerischen Schöpfungen der Griechen ein Bestreben, die alte Münze des Mythos mit einem neuen Sinn, einer neuen Deutung des Daseins auf der Grundlage individueller Erfahrung zu beprägen. Im Gegensatz dazu wird uns in den Mythen Indiens die intuitive, kollektive Weisheit einer alterslosen, überpersönlichen und vielschichtigen Kultur nahegebracht.
Man sollte sich daher recht befangen fühlen, wenn man sich anheischig macht, einen indischen Mythos zu kommentieren. Besteht doch immer die Gefahr, daß die Eröffnung einer Blickrichtung eine andere dafür schließt. Dem Hinduhörer aus Erfahrung und Tradition vertraute, dem westlichen Leser aber fremde Einzelheiten sind gewiß zu erklären; die Formulierung endgültiger Deutungen aber sollte mit möglichster Scheu vermieden werden. So möchten wir ehrerbietigerweise auch Markandeyas Mißgeschick für sich selbst reden lassen. Nahe am Verzweifeln, verloren in der unendlichen Ausdehnung der Gewässer, wurde der Heilige endlich den Leib des schlafenden Gottes gewahr. Sein Herz erfüllte sich mit Verwunderung und seliger Freude. Zum Teil von den Fluten verborgen ähnelte die riesige Masse einer aus dem Wasser steigenden Bergkette, die von einem wundervollen, von innen her kommenden Licht erglühte. Der Heilige schwamm näher, die Erscheinung zu erforschen und hatte eben seine Lippen zu einer Frage geöffnet, als der Riese ihn ergriff und kurzwegs hinunterschluckte. Und wieder stand er in der vertrauten Landschaft des Innern.
So unversehens in die Harmonie-Welt von Vishnus Traum zurückversetzt, wurde Markandeya von äußerster Verwirrung befallen. Er konnte an seine ebenso kurze wie unvergeßliche Erfahrung nur wie an eine Vision zurückdenken. Und doch, wie paradox! Er selbst, ein menschliches Wesen, unfähig irgendeine Wirklichkeit aufzunehmen, die über die Verständniskraft seines beschränkten Bewußtseins hinausging, war nun innerhalb jenes göttlichen Wesens enthalten, eine Gestalt in seinem allumfassenden Traum. Auf der anderen Seite erschien Markandeya die Offenbarung, mit der er begnadet worden war, die Schau des Höchsten Seins bei sich und in sich selbst, in seiner allenthaltenden Einsamkeit und Stille, selbst wieder nur wie ein Traum.
Der zurückgekehrte Markandeya nahm sein früheres Leben wieder auf. Wie zuvor wanderte er, ein heiliger Pilger, über die weite Erde, sah die Yogis, die in den Wäldern ihre Bußübungen trieben, und nickte den königlichen Gebern Beifall, die kostspielige Opfer mit üppigen Geschenken an die Brahmanen vollzogen. Er sah, wie die Brahmanen die heiligen Riten zelebrierten und großzügigen Entgelt für ihre wirksame Magie erhielten. Er sah alle Kasten fromm den ihnen eigenen Aufgaben zugewandt und die heilige Folge der vier Lebensstände in voller, ordnender Macht unter den Menschen waltend. Voller Wohlgefallen an diesem idealen Zustand der Dinge wanderte er ungestört weitere hundert Jahre lang.
Aber dann glitt er versehentlich zum anderen Male aus des Schläfers Mund und fiel in die pechschwarze See. In dem schauerlichen Dunkel der schweigenden Wasserwüste erblickte er diesmal ein strahlendes Kind. Gottgleich lag der Knabe unter einem Feigenbaum, in friedlichem Schlummer begriffen. Dann wieder, durch einen Schachzug der Maya, sah Markandeya den einsamen kleinen Jungen bei selbstvergessenem Spiel, ganz unbestürzt inmitten des weiten Meeres ringsum. Der Heilige, ganz Neugier, konnte doch den überwältigenden Glanz, der von dem Kinde ausging, nicht aushalten und blieb deshalb in zuträglicher Entfernung. Während er sich gegen das Versinken in die schwarze Tiefe wehrte, grübelte Markandeya: »Etwas Ähnliches scheine ich schon einmal erlebt zu haben — vor langer, langer Zeit ...« Aber dann wurde er sich der unergründlichen Tiefe dieses Meeres ohne Küsten bewußt und kalter Schrecken befiel ihn.
»Willkommen, Markandeya!« begrüßte ihn freundlich der Gott, der die Gestalt des erhabenen Kindes angenommen hatte. Die Stimme hatte den sanften tiefen Ton des melodischen Donners segenverheißender Regenwolken. »Willkommen, Markandeya!« beruhigte ihn der Gott. »Sei nicht erschrocken, mein Kind. Fürchte Dich nicht. Komm näher.«
Der eisgraue, alterslose Heilige konnte sich nicht erinnern, daß jemand ihn »Kind« zu nennen oder ohne Erwähnung seiner Heiligkeit und Abstammung einfach mit seinem Vornamen anzureden gewagt hätte, und war tief beleidigt. Obgleich müde, erschöpft und in der denkbar ungünstigsten Lage ließ er doch seinem Temperament die Zügel schießen: »Wer wagt es, sich über meine Würde und meinen heiligen Beruf hinwegzusetzen und den Schatz magischer Kräfte zu verspotten, den ich mir durch strenge Bußübungen aufgehäuft habe? Wer ist das, der so mein ehrwürdiges Alter gering schätzt, das tausend Jahre umfaßt, aber Jahre wie sie die Götter zählen? Ich bin diese Art beleidigender Behandlung nicht gewöhnt. Selbst die obersten Götter behandeln mich mit besonderem Respekt. Nicht einmal Brahma würde es wagen, mich in dieser unehrerbietigen Manier anzureden. Brahma spricht höflich zu mir. ,O Langlebiger' nennt er mich. Wer spielt da mit dem Tod, stürzt sich blindlings in den Abgrund der Zerstörung und wirft sein Leben weg, indem er mich schechtweg Markandeya nennt? Wer möchte denn unbedingt sterben?«
Als der Heilige so seinen Zorn ausgelassen hatte, nahm der göttliche Knabe unverwirrt seine Rede wieder auf: »Kind, ich bin Dein Ahn, Dein Vater und Vorvater, das uranfängliche Wesen, das alles Leben leiht. Warum kommst Du nicht zu mir? Ich kannte Deinen Vater gut. In längst vergangenen Zeiten unterzog er sich schweren Übungen der Entsagung, um einen Sohn zu erhalten. Er gewann meine Gnade. In Wohlgefallen an seiner vollendeten Heiligkeit gewährte ich ihm eine Gabe, und er wünschte sich, daß Du, sein Sohn, mit unerschöpflicher Lebenskraft begabt sein und niemals alt werden möchtest. Dein Vater kannte den geheimen Kern seines Daseins, und aus diesem Kern stammst Du. Darum ist Dir erlaubt, mich nun zu erblicken wie ich auf den uranfänglichen, allenthaltenden Wassern ruhe, spielend als Kind unter diesem Baum.«
Entzücken goß sich über Markandeyas Züge. Seine Augen öffneten sich weit, gleich aufblühenden Blumen. In demütiger Ergebenheit machte er eine Bewegung, als ob er sich verneigen wolle und betete: »Laß mich das Geheimnis Deiner Maya wissen, das Geheimnis Deiner Erscheinung nun als Kind, ruhend und spielend auf dem unermeßlichen Meer. Herr des Alls, mit welchem Namen nennt man Dich? Du mußt das Wesen aller Wesen sein; denn wer sonst vermöchte zu sein wie Du?«
Vishnu erwiderte: »Ich bin der uranfängliche kosmische Erzeuger, Narayana; er, der das Wasser ist, das erste Wesen, die Quelle des Alls. Tausend Häupter besitze ich; ich hin das heiligste der heiligen Opfer; ich bin das heilige Feuer, das die Opfer der Menschen auf Erden zu den Göttern im Himmel emporträgt. Gleicherweise bin ich der Herr des Wassers und im Gewande Indras, des Königs der Götter, der erste der Unsterblichen. Ich bin der Kreislauf des Jahrs, der alles hervorbringt und wieder auflöst, bin der göttliche Yogi, der Weltjongleur, der Zauberer, der wundervolle Listen der Täuschung wirkt. Die magischen Blendwerke meiner kosmischen Yoga sind die Yugas, die Weltalter. Diese Entfaltung der Trugbilder im Erscheinungsvorgang des Alls ist das Werk meines Schöpferischen. Zur selben Zeit aber bin ich der Strudel, der zerstörerische Wirbel, der alles wieder einsaugt, was jemals entfaltet wurde und der Folgereihe der Yugas ein Ende setzt. Ich setze allem, was entsteht ein Ende. Mein Name ist Tod des Alls.«
Aus dieser Selbstenthüllung Vishnus scheint hervorzugehen, daß Markandeya im Vergleich zu Narada der weitaus Bevorzugtere war. Beide Heilige tauchten ins Wasser, den substanzgewordenen Aspekt von Vishnus Maya, Narada mit Willen, Markandeya aus Versehen. Jedem erschloß das Wasser »die völlig andere Seite«, »den ganz verschiedenen Aspekt«, das »totaliter-aliter«. Aber Narada, der in seiner glühenden Verehrung und liebenden Hingabe (Bhakti) scheinbar in so vertrautem Bezug zur geheimen Essenz der Gottheit stand, geriet in ein anderes Dasein, eine andere Verwicklung von irdischen Leiden und Freuden. Die Verwandlung band ihn mit denselben Fesseln, die er in leidenschaftlicher Askese zu entwerten und zu überwinden strebte. Die Wasser weihten ihn in die unbewußte Seite seines eigenen Wesens ein. Sie machten ihn mit Wünschen und Einstellungen bekannt, die in ihm noch lebendig waren, aber vor seinem Bewußtsein durch die Zielstrebigkeit seiner Bemühung abgeschirmt wurden. »Du bist nicht, was zu sein Du Dir einbildest« — so hieß die Lehre der erregenden Erfahrung, die ihn während des nur einen Augenblick währenden Untertauchens überwältigte (die Bilderwelt des Hindumythos gestattet ein vorsichtiges, intuitives Erfassen in psychologischen Begriffen — Begriffen der Psychologie des Bewußten und Unbewußten. Neben anderen Interpretationen ist dieser Annäherungsweg in der Tat angebracht, denn Maya ist ebenso ein psychologischer wie ein kosmischer Begriff. Die individualisierten, differenzierten Gestaltungen des Alls — die Erde sowohl wie die höheren und niederen Ebenen der Himmel und Unterwelten — werden von dem formlosen, flüssigen Element der Tiefe getragen. Alle sind sie aus der uranfänglichen Flut entfaltet und gewachsen und werden durch ihren Kreislauf erhalten. Gleicherweise wird unsere individuelle, bewußte Persönlichkeit, die »Seele«, deren wir gewahr sind, die Charakterrolle, die wir nicht nur in Gesellschaft, sondern auch in einsamer Zurückgezogenheit spielen, wie ein intellektueller und emotioneller Mikrokosmos von dem flüssigen Element des Unbewußten getragen. Dieses stellt eine zum größten Teil unbekannte Potenz dar, verschieden von unserem bewußten Wesen. Viel weiter und fremdartiger als die von der Kultur geformte Persönlichkeit trägt sie diese doch als ihr tiefes Fundament und kommuniziert mit ihr, sie als belebendes, inspirierendes und häufig verwirrendes Fluidum durchkreisend. Das Wasser stellt das Element des tiefsten Unbewussten dar. Es birgt alles an Strebungen und Einstellungen in sich, was die bewußte Persönlichkeit, die im Fall Naradas auf völlige Heiligkeit zielt, vernachlässigt und beiseite geschoben hat. Es vertritt die ungeschiedene, umfassende Potentialität des Lebens und der Natur, die im Individuum gegenwärtig ist, aber abgesplittert vom empfundenen, vorgestellten, bewußt gespielten Charakter).
Markandeya war ein Heiliger anderer Art. In der Traumwelt im Innern des schlafenden Gottes enthalten, war er nur eine von vielen Gestalten, aber dennoch entzückt, die Rolle des ewig-ausdauernden Pilger-Heiligen zu spielen, befriedigt vom idealen Zustand der menschlichen Dinge. Er war nicht von dem Verlangen besessen, dem Mayazauber zu entrinnen, indem er das Wunder des Blendwerks durchstieß.
Als Markandeya aus dem Mund des Gottes glitt, fiel er aus dem Dasein heraus, soweit »Dasein« zu erfassen und zu bewältigen ist. Er fand sich der großen Nichtheit gegenüber, der weiten Wüste des uferlosen Meeres; die ihm vertraute Welt war verschwunden. In jäher Folge hatte er zwei sich widersprechende, unvereinbare Aspekte desselben Wesens erlebt, und sein menschlicher Verstand versagte vor ihrer Zusammenordnung. Vishnu lehrte ihn die Wesensgleichheit der Gegensätze, die grundangelegte Einheit von allem und jedem in Gott. Aus seiner einzigen, einheitlichen Substanz hervortreibend, in Gott gedeihend und in Gott vergehend, schmilzt alles wieder in die alleinige Quelle zurück.
Vishnu lehrt die Einheit der Gegensätze, erst, indem er sich als das unerschrockene, namenlos einsame Kind in der unendlichen Ausdehnung der Wasser und der sternenlosen Nacht offenbart; dann, indem er den uralten Heiligen mit »Kind« und seinem Vornamen anredet, wie ein alter Freund oder Bekannter, obgleich die zwei sich allem Anschein nach noch niemals begegnet sind.
Das Geheimnis der Maya ist diese Wesensgleichheit des Entgegengesetzten. Maya ist eine gleichzeitige und in der Gleichzeitigkeit aufeinanderfolgende Offenbarung von Energien, die miteinander uneinig sind, Vorgängen, die sich widersprechen und gegenseitig aufheben: Schöpfung und Zerstörung, Entwicklung und Auflösung, das Traumidyll der inwendigen Schau des Gottes und die öde Null, der Schrecken der Leere, das furchtbare Unendliche. Maya ist der ganze Kreislauf des Jahres, der alles hervorbringt und alles wieder fortnimmt. Dieses »und«, welches das Unvereinbare vereinigt, drückt den Grundcharakter des »Höchsten Wesens« aus, des Herrn und Handhabers der Maya, dessen Energie sie ist. Alle Gegensätze stammen im Grunde aus demselben Sein, sind zwei Aspekte des einen Vishnu. So lautet die Weisheit, welche diese Sage dem gläubigen Hindu aufschließen will.
Die tiefdröhnende Stimme des Kindes fuhr fort und Belehrung floß von seinen Lippen in wundervollem seelenerquickenden Strom: »Ich bin die heilige Ordnung (Dharma), ich bin der glühende Eifer entsagenden Strebens (Tapas), bin all die Erscheinungen und Vorzüglichkeiten, in denen die wahre Essenz des Daseins sich manifestiert. Ich bin der Herrscher, der alle Wesen schafft und erzeugt (Prajapati), bin das Gesetz des Opferritus und werde der 'Herr der heiligen Weisheit' genannt. Als Licht des Himmels offenbare ich mich, als Wind und Erde, als die Wasser des Meers und der Raum, der sich nach den vier Weltgegenden ausdehnt, zwischen den Himmelsrichtungen liegt und sich nach oben und unten erstreckt. Ich bin das Uranfängliche Wesen und die Höchste Zuflucht. Aus mir entsteht, was jemals gewesen war, sein wird oder ist. Und was immer Du im Umkreis des Alls siehst, hörst und erkennst: wisse mich als Den, der darin wohnt. Zeitlauf um Zeitlauf erzeuge ich aus meinem Sein die Sphären und Geschöpfe des Kosmos. Bewege das in Deinem Herzen, befolge die Gesetze meiner ewigen Ordnung und wandere beglückt durch das All in meinem Leib. Brahma lebt dort und alle Götter und heiligen Seher. Wisse mich als Den, der sich offenbart, dessen offenbarende Macht aber unoffenbart und unbegreiflich bleibt. Ich weise jenseits der Ziele menschlichen Lebens: Befriedigung der Sinne, Bemühung um Wohlstand und fromme Erfüllung heiliger Pflichten. Aber ich weise diese drei als die angemessenen Zwecke irdischen Daseins.«
Mit schneller Bewegung brachte darauf das Uranfängliche Wesen den Heiligen Markandeya an die Lippen und verschluckte ihn, daß er wieder in dem gigantischen Leibe verschwand. Diesmal war das Herz des Heiligen von solcher Seligkeit überflutet, daß er nicht weiterwanderte, sondern die Ruhe eines verborgenen Platzes aufsuchte. Hier blieb er in einsamer Stille, freudenvoll dem »Sang der unsterblichen Wildgans« lauschend, der zuerst kaum hörbaren, verborgenen, doch alldurchdringenden Melodie von Gottes ein- und ausgehendem Lebensatem. Und das ist der Sang, den Markandeya hörte: »Viele Gestalten nehme ich an. Und wenn Sonne und Mond verschwunden sein werden, flute ich und schwimme mit langsamer Bewegung auf der grenzenlosen Ausdehnung der Wasser. Ich bin der Herr. Ich bringe das All aus mir hervor und hause im Kreislauf der Zeiten, der es auflöst.«
Dieser Gesang, diese Melodie mit ihrem Bild der kosmischen Wildgans stellt die letzte einer Reihe von archetypischen Offenbarungen dar, die dem frommen Heiligen Markandeya geschehen. In der Hindu-Mythologie ist die Wildgans im allgemeinen Brahma zugesellt. Wie Indra auf einem Elefanten reitet, Shiva auf dem Stier Nandi, Shivas Sohn, der Kriegsgott Skanda-Karttikeya, auf dem Pfau und »die Göttin« (Devi) auf dem Löwen, so schwingt sich Brahma auf einem herrlich wilden Ganter durch die Atmosphäre. Diese tragenden Wesen oder Reittiere (Vahanas) sind auf der Ebene der Tierheit Manifestationen der betreffenden göttlichen Individualitäten selbst. Der Ganter ist die tierische Maske des schöpferischen Prinzips, das in menschenförmiger Gestalt in Brahma verkörpert ist. Als solche ist er das Sinnbild souveräner Freiheit aus fleckenloser Geistigkeit.
Darum heißt es von dem Hindu-Asketen, dem Bettelmönch oder Heiligen, dessen Freigewordensein von den Fesseln der Wiedergeburten man annimmt, sie hätten den Rang des »Ganters« (Hamsa) oder des »höchsten Ganters« (Paramahamsa) erlangt. Es sind Beiwörter, die gewöhnlich auf die orthodoxen Lehrer-Heiligen des gegenwärtigen Hinduismus angewandt werden. Warum ist nun der wilde Ganter solch ein wichtiges Symbol?
Der wilde Ganter (Hamsa) legt in seiner Lebensweise auffallend die zweifache Natur aller Wesen an den Tag. Er schwimmt auf der Oberfläche des Wassers, ist aber nicht an dieses gefesselt. Dem wässerigen Bereich entfliehend schwingt er sich in die reine, unbefleckte Luft, wo er ebenso zu Hause ist wie in der Welt unterwärts. Den Raum durchfliegend schweift er nach Norden oder Süden, dem Lauf der Jahreszeiten folgend. So ist er der heimatlose, freie Wanderer zwischen den oberen, den Himmelssphären, und den niederen irdischen. Nach Wunsch und Gefallen läßt er sich auf den irdischen Gewässern nieder oder zieht sich in die leere Höhe zurück. Darum versinnbildlicht er den göttlichen Wesenskern, der trotz seiner Einkörperung und seines Wohnsitzes im Individuum doch für immer von den Geschehnissen individuellen Lebens freibleibt und von ihnen nicht bekümmert wird.
Einerseits erdgebunden, beschränkt in Lebenskraft, Fähigkeiten und Bewußtsein, andererseits aber eine Manifestierung des göttlichen Wesens, das unbegrenzt, unsterblich, im Grunde allwissend und allmächtig ist, sind wir wie die Wildgans Bürger von zwei Sphären. Wir sind sterbliche Individuen, die in sich einen unsterblichen, überindividuellen Kern tragen. Eingehüllt von den beschränkenden, individualisierenden Schichtungen des groben, faßbaren Gefüges unserer physischen Natur und den feinen Häuten unseres Psychischen, ruht das Selbst (Atman) wesentlich unberührt durch die Vorgänge und Aktivitäten in den sein jeweiliges äußeres Dasein bedingenden Ablagerungen, einsam und in Seligkeit versunken. Ohne es zu wissen sind wir unstofflich, göttlich, erhaben, obgleich auch wandelbar, Erfahrungen unterworfen, Freuden und Kümmernissen, und dem Verfall wie der Wiedergeburt ausgesetzt.
Der makrokosmische Ganter, das göttliche Selbst im Leibe des Alls, manifestiert sich selbst durch einen Gesang. Die Melodie des Ein- und Aushauchens, welche der indische Yogi vernimmt, wenn er durch Übungen den Rhythmus seines Atems kontrolliert (Pranayama), wird als Manifestierung des »inneren Ganters« betrachtet. Der Einhauch soll den Laut »ham«, der Aushauch »sa« hervorrufen. So, durch beständiges Summen des eigenen Namens: Ham-sa, Ham-sa, enthüllt sich die innere Gegenwart dem Yoga-Eingeweihten.
Markandeya lauscht diesem Sang; er hört dem Atem des Höchsten Wesens zu. Darum sitzt er allein an einsamem Ort und legt keinen Wert mehr darauf, dem Lauf der Welt zu folgen. Es freut ihn nicht länger, umherzustreifen und den idealen Zustand der menschlichen Dinge zu beobachten. Er ist von dem Bann endlosen, wenn auch begeisternden Reisens erlöst, befreit von dem Zwang, durch noch so erhabene Landschaften zu wandern. Die göttlichste Melodie aller Melodien nimmt seine Aufmerksamkeit ausschließlich in Anspruch.
Der Sang des inneren Ganters hat noch ein letztes Geheimnis preiszugeben. »Hamsa, Hamsa«, klingt er, doch gleichzeitig auch »Sa-'ham, Sa-'ham«. »Sa« heißt »dies« und »'ham« »ich«; »Dies bin ich« meint die Lehre. Ich, das menschliche Individuum, beschränkten Bewußtseins, in Täuschung versunken, von Maya-Zauber gebunden, bin wirklich und eigentlich »Dies« oder »Er«, nämlich der Atman, das Selbst, das Höchste Wesen mit unbegrenztem Sein und uneingeschränkter Erkenntnis. Ich bin nicht mit dem vergänglichen Individuum gleichzusetzen, das die Vorgänge und Geschehnisse der Psyche und des Körpers als völlig real und entscheidend ansieht. »Ich bin Er, der frei und göttlich ist.« Das ist die Lehre, die jeder Augenblick der Ein- und Ausatmung dem Menschen singt, die göttliche Natur Dessen, in dem der Atem wohnt, bekräftigend.
Markandeyas Zweifel, was denn »wirklich sei« werden durch diesen Sang zur Ruhe gebracht. »Viele Gestalten nehme ich an«, singt der Gott. Das heißt, das Göttliche Wesen verwandelt durch die schöpferische Energie seiner Maya sich selbst und blättert in die Scharen vergänglicher Iche und Weltalle aus — in das Weltall etwa, von dem Markandeya einen Teil bildet. »Und«, singt der göttliche Vogel, »wenn Sonne und Mond verschwunden sein werden, flute ich und schwimme mit langsamer Bewegung auf der grenzenlosen Ausdehnung der Wasser.«
Die beiden entgegengesetzten Ansichten der Wirklichkeit, die den Heiligen so hemmten und verwirrten, als er aus der vertrauten Welt in die sternenlose Nacht des bodenlosen Ozeans fiel, sind so für ihn versöhnt und als ein und dieselbe erkannt. »Ich bin der Herr und ich bin die Wildgans.« Ich bin das höchste Allwesen, dessen spielende Verwandlung den Makrokosmos darstellt, und bin das innerste Prinzip im Menschen, der Mikrokosmos; ich bin das göttliche Lebensprinzip, das sich in der Melodie des Atems enthüllt. Ich bin der Herr, der allenthaltende kosmische Riese und das Selbst, die unvergängliche, göttliche Lebensmitte im Menschen. »Ich bringe das All aus meinem Wesen hervor und hause im Kreislauf der Zeiten, der es auflöst.« Das Wirken der Maya wurde Markandeya durch wechselnde kosmische Visionen enthüllt. Während Narada das Geheimnis in einer persönlichen Traumverwandlung erlebte, erschaute Markandeya das Wunder des großen Spiels auf kosmischer Ebene.
Der Mythos begann damit, den Untergang des Äons zu beschreiben. Er schließt nun mit einem Bericht über den Wiederanfang.
Das Höchste Wesen, in Gestalt des Wassers weilend, zog langsam in sich selbst glühende Energie zusammen. Dann, in seiner grenzenlosen Stärke, beschloß er das All wieder hervorzubringen. Er, der selbst das All ist, stellte sich die Beschaffenheit des Universums mit seinen fünf Elementen Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde vor. Unergründliche, zarte Stille lag über dem Ozean. Nachdem Vishnu in das Wasser eingegangen war, bewegte er es leise. Wellen kräuselten sich, und als sie einander folgten, bildete sich zwischen ihnen eine schmale Spalte. Diese Spalte war der Raum oder Äther, unsichtbar, urgreifbar, das zarteste der fünf Elemente, der Träger der unsichtbaren, ungreifbaren Sinnesqualität des Tons. Der Raum ertönte und aus dem Klang erhob sich das zweite Element, die Luft, in Gestalt eines Windes.
Der Wind, die spontane Bewegerkraft, hatte nun den Raum zur Verfügung, um darin zu wachsen. Ihn durchdringend dehnte er sich rücksichtslos in die Weite und Ferne aus. Gewaltig rauschend und wild blasend erregte er die Gewässer. Aus der sich ergebenden Reibung und dem allgemeinen Aufruhr entstand das dritte Element, das Feuer — eine machtvolle Gottheit, deren Weg von Rauch und Asche schwarz ist. Das wachsende Feuer verschlang große Mengen kosmischen Wassers. Wo aber das Wasser verschwand, blieb eine mächtige Leere zurück, innerhalb derer die oberste Sphäre des Himmels in Erscheinung trat. Das Allwesen, das den Elementen erlaubt hatte, aus seiner Essenz hervorzutreten, freute sich nun, die Formung der himmlischen Räume zu erblicken. In Vorbereitung für die Erschaffung Brahmas sammelte es seinen Geist.
Es liegt in der Natur des Höchsten Wesens, sich im kosmischen Ozean an sich selbst zu erfreuen. Nun treibt es aus seinem kosmischen Leib einen einzelnen Lotos hervor mit tausend Blütenblättern aus reinem Gold, fleckenlos und strahlend wie die Sonne.
Und zusammen mit diesem Lotos läßt er den Gott-Schöpfer des Universums, Brahma, hervorgehen, der im Mittelpunkt des goldenen, sich ausdehnenden und von der glühenden Energie der Schöpfung strahlenden Lotos thront. Rang und Rolle Brahmas sind einem vollkommenen Yogi anvertraut, der volle Herrschaft über sich selbst und die Kräfte des Alls besitzt. Immer wenn ein menschliches Wesen durch leidenschaftliche Entsagungen gereinigt und durch die Initiation in heilige Weisheit wiedergeboren die letzte Erleuchtung erlangt und der erste aller Yogis wird, erkennt ihn das Höchste Wesen in seiner ganzen Würde an. Und wenn das All sich wiederentfaltet, werden die späteren Schöpfungsvorgänge seiner Sorge anvertraut.
Brahma ist viergesichtig, und mit diesen vier Gesichtern regiert er die Himmelsrichtungen und die ganze Ausdehnung des Alls.
Von den Weisen, die in den heiligen Überlieferungen bewandert sind, wird Brahmas Lotos als »höchste Form oder Aspekt der Erde« bezeichnet. Er ist mit den Sinnbildern des Elementes Erde ausgestattet und stellt die Göttin Erde oder die der »fruchtbaren Feuchtigkeit« dar. Aus dieser Erde erheben sich die heiligen, zum Himmel getürmten Berge, die mit dem Lebenssaft des Lotos gesättigt sind: der Himalaya, der Berg Sumeru, der Berg Kailasa, der Berg Vindhya. Sumeru oder Meru ist der Mittelgipfel der Welt, der Nagel des Alls, die vertikale Achse. Kailasa ist die Residenz des Gottes Kubera, des Königs der Genien (Yaksas) und auch ein Lieblingsaufenthalt Shivas. Der Vindhya-Berg, der die nordindische Ebene vom Hochland des Dekkan trennt, ist der Gipfel, über den sich die Sonne erhebt, um ihre tägliche Reise am Himmelsgewölbe zu beginnen. Alle diese Gipfel sind die Behausungen von Scharen von Göttern, himmlischer und übermenschlicher Wesen, und vollendet Heilige, welche dem Frommen Erfüllung seiner Wünsche schenken. Mehr noch: das Wasser, das von diesen Bergen herabfließt, ist so heilspendend wie das Elixier des unsterblichen Lebens. Es rinnt in Flüsse, die heilige Ziele der Pilgerschaft sind. Die Staubfäden des Lotos sind die unzähligen, mit kostbaren Metallen gefüllten Berge der Welt, während die äußeren Blütenblätter die unzugänglichen Kontinente ferner Völker enthalten. Auf der Unterseite der Blütenblätter wohnen die Dämonen und Schlangen. Aber im Innern des Blütenherzens, inmitten der vier Ozeane, die sich zu den vier Weltrichtungen ausdehnen, liegt der Kontinent, von dem Indien ein Teil ist.
So kam aus der Mayakraft des träumenden Gottes der ganze große Traum des Alls wieder zum Sein, um den majestätischen Rundlauf der vier Yuga wieder aufzunehmen. Ein anderer Zyklus, dazu bestimmt, allem vorhergegangenen und allem, was jemals geschehen würde, zu gleichen, noch glitzernd nass und strahlend von der lebenden Substanz seines Ursprungs, erhob sich wundervoll in der holden Morgendämmerung.

Teil 4: Maya in der indischen Kunst
In den Hügeln an der Westküste Indiens in Bhaja bei Bombay befindet sich ein buddhistisches Höhlenkloster aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. Rechts vom Eingang ist ein großartiges Steinrelief, das Indra, den König der Götter, zeigt. Er sitzt auf seinem Riesenelefanten Airavata, dem himmlischen Vorfahren aller indischen Elefanten, dem tiergestaltigen Archetypus der regenschenkenden Monsunwolke. Verglichen mit der Erde darunter, die in dem Relief wie halb von oben erblickt wird, sind der Gott und sein Reittier von überwältigender Größe. Winzige, spielzeugähnliche Figuren bedecken die Landschaft unterhalb. In der Mitte ist ein heiliger Baum dargestellt, von einem Zaun umrandet; zur linken eine Hofszene: ein König unter einem Sonnenschirm auf einem Weidenthron sitzend, von Musikanten und Tänzern umgeben. Der göttliche Elefant trägt einen Baum, den er entwurzelt hat, die unwiderstehliche Wut des Sturmes versinnbildlichend.
Dieses Bhaja-Relief ist in einem entschieden »visionären« Stil ausgeführt und ähnelt eher einem plastischen Gemälde als der Arbeit eines Meißels im Stein. Innig, doch kühn, mit flüssigen, kraftvollen Zügen ist es Zeugnis einer langen vorhergehenden Überlieferung, deren frühere Dokumente noch nicht gefunden worden sind. Die Gestalten enttauchen dem Felsen und bedecken seine Oberfläche in dünnen wogenden Schichten, wie zarte Wellen wolkenähnlichen Stoffes, so daß sie — obgleich aus solidem Stein gehauen — den Eindruck einer Art von Luftspiegelung hervorrufen. Die Substanz des Steines scheint die Umrisse leicht dahin schwebender Ausstrahlungen angenommen zu haben. Der formlose, ungeschiedene, namenlose Fels scheint förmlich dabei überrascht, als er sich in individualisierte und belebte Formen verwandelt. So spiegelt sich in diesem Stil der Grundbegriff der Maya.
Er stellt das Hervortreten lebender Formen aus der formlosen ursprünglichen Substanz dar und veranschaulicht den rein erscheinungsmäßigen, blendwerkähnlichen Charakter alles Daseins, des irdischen wie des göttlichen. Aber die Auffassung des Alls als Maya ist nicht die einzige Weltdeutung, die Indien kennt. Tatsächlich bedeutet diese Auffassung, dieser Erfahrensweg einen beträchtlichen philosophischen Sieg, der während des ersten Jahrtausends v. Chr. über ein früheres, streng konkretistisches, dualistisches Glaubenssystem errungen wurde, wie es bis heute in den Lehren der Jaina-Sekte fortbesteht, und wie es in vorgeschichtlichen Zeiten ganz allgemein unter der vorarischen Bevölkerung des indischen Subkontinentes geblüht haben mag.
1931 zählten die Jaina nur 1 252 105 Mitglieder, zum größten Teil reiche Händler, Bank- und Kaufleute in den größeren Städten, wobei diese prosperierende Laiengemeinde einen inneren Kreis von außerordentlich strengen und fortgeschrittenen Asketen, sowohl Mönchen wie Nonnen, trägt, dem die eigentliche Bedeutung zukommt. Einmal aber waren der Jaina viele und ihre Lehren haben in der Geschichte des indischen Denkens eine wichtige Rolle gespielt. Ihr letzter großer Prophet Mahavira (ungefähr 500 v. Chr.) war ein Zeitgenosse des Buddha (563-483 v. Chr.) und war selbst ein Nachfolger des früheren Jaina-Propheten Parshvanatha (872?-772?), der als der dreiundzwanzigste der Jaina-Erlöser angesehen wird. Der zweiundzwanzigste, Neminatha, soll ihm im Abstand von 84 000 Jahren vorangegangen sein. Der erste, Rishabhanatha, lebte in einer früheren Epoche der Welt, als Gatten und Gattinnen als Zwillinge zusammengeboren wurden, jeder vierundsechzig Rippen hatte und zwei Meilen hoch war.
Viele Jahrhunderte lang blühte der Jainismus Seite an Seite mit dem orthodoxen Hinduismus und erreichte im fünften Jahrhundert n. Chr. einen Gipfel seines Ansehens und seiner Macht. Aber seit den mohammedanischen Einfällen und Blutbädern einige siebenhundert Jahre später (besonders seit der Eroberung der Gujarat-Region durch Ala-ud-den, »den Blutigen«, 1297-98) befindet sich die Sekte in beständigem Niedergang. Ihr heutiger, fast nur spurenhafter Zustand war von ihrem Propheten lange vorausgesagt: mit dem Niedergang der Tugend in der Welt während des langsamen unumkehrbaren Ablaufes der Zeitalter würde die wahre Religion ständig zusammenschrumpfen, um zuletzt zugleich mit dem Absturz der Welt in den äußersten Verfall ganz zu verschwinden. Der letzte Jaina-Mönch soll Dupasahasuri heißen, die letzte Nonne Phalgushri, der letzte Laie Nagila, die letzte Laienfrau Satyashri (es ist darauf zu achten, daß der Jainazyklus sich von dem der Mayawelt Vishnus unterscheidet. Das All löst sich niemals ganz auf, sondern nach einer langen Periode erbarmungslosen Schreckens beginnt es sich wieder zu bessern, bis die Jaina-Religion wieder erscheint, die Menschen an Körpergröße zunehmen, die Welt schön wird und alles zu dem vollendeten Zustand zurückkehrt, von dem dann wieder das Absinken beginnt. — Vgl. Mrs. Sinclair Stevenson, The Heart of Jainism, Oxford University Press, 1915).

Der Charakter des Jainismus ist tiefer, absoluter Pessimismus gegenüber der Beschaffenheit der Welt. Die Materie ist nicht im Grunde eine bloße Verwandlung des Geistes, sondern eine dauernd existierende Substanz, konkret und unzerstörbar. Sie besteht aus Atomen und ist (wie Lehm) fähig, mancherlei Gestalten anzunehmen. Verschieden von der Materie, in ihr gefangen und von innen heraus auf sie wirkend wie Hefe, um ihr die Formen zu geben, sind die Seelen (Jiva, »die Leben«), die praktisch unzerstörbar sind (die Welt ist buchstäblich mit ihnen gefüllt) und die gleich der Materie selbst sich niemals auflösen. Das Ziel der religiösen Übungen der Jaina ist, diese Jivas von ihrer Verwicklung in die Materie zu erlösen (die Materie ist "Nicht-Jiva", Ajiva).
Um dies zu erreichen, wird ein ausgearbeitetes und liebevoll abgestuftes System von Lebensregeln und Gelübden sorgfältig befolgt, das den Laien Schritt für Schritt zum höchsten Zustand des fortgeschrittenen Asketen führen soll. Der Mensch liegt in Banden, weil er unablässig handelt und tut, wobei doch jede Handlung eine Häufung neuer Verwicklungen bringt. Darum besteht der Weg zum Sieg in völligem Nichthandeln.
Wenn dieser Zustand ordnungsgemäß und sehr stufenweise erreicht ist, wird im Moment des Todes jederlei Spur von Ajiva beseitigt sein. Der Jiva erhebt sich dann in die absolute Befreiung (Kaivalya, »vollständige Ablösung«). Dieser Zustand wird von den Jainas nicht als Wiedereingehen in irgendeine höchste Allsubstanz angesehen; kennen sie doch keinen solchen allunterliegenden, nicht dualistischen Zustand des Seins. Im Gegenteil: der individuelle Jiva, die Monade, steigt einfach wie ein Freiballon zum Zenith des Weltorganismus, um dort für immer zu verbleiben, zusammen mit all den anderen Freiballons — jeder völlig selbst seiend und in sich selbst beschlossen, unbeweglich unter dem Weltdach. Diese Vollendeten nehmen alles wahr; der Raum, den jeder von ihnen einnimmt, ist unbegrenzt (das Weltall wird im mythologischen Symbolismus der Jaina als ein Riese in menschlicher Gestalt dargestellt. Dieser kosmische Gigant kann entweder männlich oder weiblich sein. Im unteren Teil seines Leibes vom Nabel bis zu den Sohlen der Füße sind die Unterwelten, die Purgatorien, der Wohnplatz der Dämonen. Die Menschenwelt liegt auf der Ebene des Nabels. In dem Riesenbrustkorb, Nacken und Kopf sind die Himmel. Moksha (»Freiheit, Erlösung«), der Platz der reinen Jivas, befindet sich am Scheitel).
Obgleich der Zustand der Vollendung, Kaivalya, weit jenseits und über den weltlichen Sphären liegt, die von den Göttern beherrscht werden, lassen die Jainas zu ihrem mehr populären Hauskult gewisse Gottheiten aus dem Hindu-Pantheon zu. Dies geschieht zu Hilfe und Trost des Laienvolkes in seinen täglichen Angelegenheiten bis die höheren Stufen geistiger Klärung erreicht sind. Aber von vornherein ist Einverständnis darüber, daß diese Götter nur einer entschieden untergeordneten Daseinsstufe angehören. Gleich der Welt, über die sie herrschen, sind sie mit dem Stoff zeitgebundenen Lebens beschwert. Und diese Schwerfälligkeit, diese dauerhafte Materialität, spiegelt sich in ihrer Wiedergabe in den Werken der Jaina-Kunst.
Ein bekanntes Bild zeigt ein Jainabild Indras, des himmlischen Vaja, König der Götter. Es entstand ungefähr um 850 n. Chr. und befindet sich im Jaina-Heiligtum zu Elura, einem monolithischen Tempel, der in den lebenden Stein eines Felsens gehauen ist. Die Jainakunst aller Perioden wird durch eine puppenhafte Steifheit, Unfruchtbarkeit und Starre charakterisiert. Manchmal zieht sie eine gewisse Kraft und Vitalität aus ihrer nahen Verwandtschaft zur volkstümlichen Kunst; ihre Bildwerke ähneln oft den Fetisch-Figuren primitiver Bevölkerungsschichten. Wie die Lehre und das Daseinserlebnis, die sie vermittelt und wiedergibt, ist sie archaisch, unbeweglich, im Glauben an ihre Grundlagen unerschütterlich, unbefleckt von irgendeiner lindernden Einsicht. Nichts löst sich jemals wieder in die ungeschiedene, transzendente, unstoffliche Essenz auf; nichts hört jemals endgültig auf zu sein. Die ewig dauernde Gegensätzlichkeit der Urmaterie und der lebenden, sich abmühenden Seelen wird niemals aufgehoben.
Indra, der König der Götter, sitzt mit würdiger, fast drohender Schwere auf seinem Tragtier, dem Elefanten. Er ist von zwei Hofleuten begleitet und von einem Baum, dem sog. »Baum der Wunscherfüllung« (Kalpa-Vriksha) überschattet. Die Bewohner von Indras Paradies erlangen von den Zweigen dieses symbolischen Lebensbaumes die Früchte ihrer Wünsche — Juwelen, kostbare Gewänder und andere reizvolle Gegenstände der Eitelkeit und des Vergnügens. Aber der Gott, der Baum und alles, was er geben kann, sind mit der Schwere der Körperlichkeit beladen. Die klaren Umrisse und Ornamente dieses Werks lassen die Kraft und den Widerstand des Felsens der beabsichtigten Wirkung dienen. Der Stein des Bildwerks behält seine Solidität. Mineralisches und tierisches Gewicht ist es, was wir hier erblicken; hier geschieht keine Verwandlung des Steins in etwas Zartes und Fließendes, keine Anspielung auf wolkenhafte Transzendenz. Die Lebenskraft wird in Begriffen der Masse und Dichtigkeit ausgedrückt mit einem durchaus soliden Realismus und völlig prosaischer Frömmigkeit. Stofflichkeit und auch die Schönheit der pflanzenhaft-tierhaften Natur sind freilich hier zu sehen, nur in der höheren Erscheinungsform eines unsterblichen Gottes. Dieser Indra ist der stämmige, handfeste Meister der innenhaft lebenden Welt, aus deren Bereich der Jaina-Heilige sich krampfhaft zu entkommen bemüht. Kein Wunder darum, wenn der Mönch sich zu den außerordentlichsten Übertreibungen physischer Selbstquälerei genötigt fühlt, um in die Freiheit durchzubrechen.
Ein umwälzender philosophischer und psychologischer Sieg über diese enggesinnte, am Anschein klebende Religiosität tritt in den zarten Luftbild-Effekten der Bhaja-Kunst zutage. Hier erscheint die ganze manifestierte Welt aufgelöst und darf doch noch bleiben — »gleich einer verbrannten Schnur, die beim Hauch eines leichten Windes verschwinden würde.«
Die Beschaffenheit von Maya

Aus: Swami Sivananda Divine Life Society: Vedanta für Anfänger
Maya ist Trigunatmika (Selbst mit drei Eigenschaften) und setzt sich aus drei Grundenergien (Gunas) zusammen:
- Tamoguna ist Dunkelheit und Passivität
- Rajoguna ist Leidenschaft und Aktivität
- Sattvaguna ist göttliches Licht und Reinheit
Die Macht der Unwissenheit (Avidya) verhindert, dass du deine eigenen Fehler erkennst. Die Illusion (Maya) in der individuellen Seele (Jiva) wird Avidya genannt. Durch sie denkst du, keine Fehler zu besitzen, voller Tugenden zu sein und das perfekteste Wesen zu sein. Das ist Maya.
Maya ist Wahrheit (Satya) für einen weltlichen Menschen. Für einen Menschen mit Unterscheidungskraft (Viveka) bedeutet sie dagegen etwas Unbeschreibliches (Anirvachaniya; weder wirklich noch unwirklich). Für einen befreiten Heiligen (Jivanmukta), der sich mit Brahman identifiziert, ist Maya dagegen nichts (Tuccha).
Begierden und Sehnsüchte (Vasanas und Trishnas) können nur durch die Zerstörung von Avidya bzw. Ajnana (Unwissenheit) ausgemerzt werden, denn sie sind die Quelle dieses Samsara. Genauso kann ein Baum nur durch Zerstörung der Wurzel beseitigt werden. Schneidest du nur die Äste ab, so wachsen sie nach. Folglich ist es erforderlich, die ganze Wurzel zu entfernen. Die Unwissenheit (Avidya) kann durch das Wissen um das unzerstörbare Wesen Brahman beseitigt werden, aber nicht durch wahllose Unterdrückung der Sinne.
Die Auflösung der Unwissenheit führt zur Zerstörung von Raga-Dvesha. Raga (Zuneigung, Vorlieben) und Dvesha (Abneigung) sind die Auswirkungen der Unwissenheit.
In Ajnana ist das Wissen von Brahman nicht anwesend. So wie die Bäume auf dem Berg den Berg verdecken oder die Wolken – aus Sonnenstrahlen entstanden – die Sonne selbst verdecken, so verdeckt das aus Brahmans Shakti (Kraft; schöpferische Energie) entstandene Ajnana Brahman, Chaitanya (das absolute Bewusstsein).
Ajnana existiert in zwei Formen: Tula und Mula. Tula-Ajnana ist Unwissenheit in Bezug auf die äußeren Objekte. Mula-Anjana ist Unwissenheit um das wahre Selbst in uns.
Maya
Indische Geschichte aus einer Nacherzählung von Heinrich Zimmer aus seinem Buch "Weisheit Indiens. Märchen und Sinnbilder" 1938 im L.C. Wittich Verlag in Darmstadt erschienen. S. 25.

Der Lehrer sagte: „Alles ist Gott, — diese Lehre ist das ,Ende der Veden`." — Der Schüler vernahm es und begriff: Gott ist das einzig Wirkliche. In allen Dingen webt das Göttliche leidlos und ungreifbar, alle Gestalten, alles Ich und Du der Welt sind nur der Schleier seiner Maya. Ein ungeheures Gefühl befiel ihn; er kam sich wie eine große lichte Wolke vor, die unaufhaltsam wachsend den ganzen Himmel erfüllt, und wie eine Wolke ging er umher, aller Schwere ledig. In erhabener All-einsamkeit hielt er die Mitte der Straße, — da kam ihm ein Elefant entgegen. Der Treiber, der oben dem Tier im Nacken saß, rief herunter: „Platz da! Platz da!", und die Schellen am Leibe des Riesen umspielten seinen lautlos wogenden Gang mit silbernem Gelächter.
Der Schüler hörte und sah ihn wohl trotz seiner Verzückung, aber er wich ihm nicht aus. Er sprach bei sich selbst: „Warum sollte ich Platz machen? Ich bin Gott, und der Elefant ist Gott. Soll Gott sich vor sich selber fürchten?" Furchtlos ging er dem Tier geradewegs entgegen — da packte ihn der Elefant im letzten Augenblick, umschlang ihn mit seinem Rüssel, schwang ihn beiseite und setzte ihn nicht ganz sanft am Straßenrande in den Staub. Zerschlagen und bestaubt kam der Schüler zu seinem Lehrer und erzählte ihm die Begegnung. Der Guru sagte: „Du hast ganz recht: du bist Gott, und der Elefant ist Gott — aber warum hast du nicht auf Gottes Stimme gehört, die oben vom Elefanten herunter zu dir sprach?"
Yoga und Maya
Aufsatz von Heinrich Zimmer aus seinem Buch "Gesammelte Werke", Band 5: Indische Sphären 1963 erschienen im Rascher Verlag Zürich
Yoga und Maya Teil 1
Über das Epos der Geschichte, seine Fanfaren des Siegs und den Sand um die Trümmer, über Größe und Leiden, in die sich die Völker werfen, heben sie einiges empor, das weniger vergänglich ist als «Frühling und Herbst» ihrer Aufgänge und Abbrüche, die ihnen schwer und einzig dünken, als hätten Menschen sie nicht von je erlebt, indes die Natur auf sie blickt, wie auf Wolken, die sich ballen und zerrinnen. Ein Dauernderes heben sie über sich hinaus, das sie überlebt und in sich verdunkelnd über die Zeiten leuchtet und Spätere bannt: Stille Masken und große Gebärden, Gestalten und Mythen, Formeln und Reihen von Bildern, bedeutende Bräuche und Zeichen voll Bannkraft. Das sind die Mäntel, in die der Mensch seine Blöße gegenüber dem Schicksal schlug, das sind seine Antworten auf das Rätsel der Sphinx, auf das zeitlos wechselnde Geheimnis, wie der Mensch es vermochte, sich selbst im Spiel des Ganzen zu begreifen und zu tragen.
Überlieferung, die sich selbst vergißt im Wandel der Geschlechter, Schrifttum, das ein leiser Finger der Zeit ausgelöscht hat, längst ehe seine Bücher zu Staub werden, Monumente, die zerbröckeln, — aus diesen vergehenden Schalen bricht als geläuterter Kern ein Erbgut der Völker, das Menschen immer wieder gefunden haben, indem sie sich selbst und ihr Schicksal in ihm gespiegelt sahen. In Indien sind die Mythen und der Yoga zwei große dauernde Formen, in denen das fließende Geheimnis des Menschen und seines Schicksals dunkel leuchtend Kristall geworden ist; aus beiden nahm die indische Kunst das Eigene ihrer Gebärden und Figuren, mit denen sie bannt wie Ägypten mit seinen Pyramiden und Sphinxen. Der Yoga hat im Gange indischer Geschichte viele Formen entwickelt und manchen Zielen gedient, er sitzt im Kern alles höheren Lebens in Indien; als Technik der Selbstentwicklung und Seinsverwandlung schimmert er wie eine Fundgrube, die ausgeschöpft sein will.

Yoga ist ein einsames Geschäft. Wer sich ihm ergibt, entzieht sich dem Geflecht der Welt. Alle Typen der Vereinsamung stehen in seinem Dienst: der Einsiedler der Wildnis, der ewige Pilger, der Mönch und Bettelasket. Alle angeborenen Ordnungen, die in Indien den ganzen Menschen fordern und einspinnen, streift er ab: Dorf-und Standesgemeinschaft, Lebensritual- und Kultgemeinschaft, ja auch die innigste, die Diesseits und Jenseits umfaßt: die Familie als unlösliche Einheit der Lebenden mit ihren Toten, — diese im Ahnenkult greifbare Schicksalsgemeinschaft des gleichen Blutes, dessen frühe Väter drüben mit dem letzten Enkel hier leben oder vergehen. Wer sich dem Yoga ergibt, muß sich vereinsamen wollen und alle Verzahnungen in angewordener Gemeinschaft von sich abschleifen. Der Mönchsorden, der ihn aufnehmen mag, die Bindung an den Lehrer ist eine Zweckgemeinschaft willentlich Vereinsamter.
Ein zeitlos alter Typ indischer Askese lebt noch heute, — herabgesunken zu Schau- und Schreckstück, zu Bettel und Erwerb an Straßen und Wallfahrtsorten: der Yogin, der ewig auf einem Beine steht oder die Arme gen Himmel reckt, bis sie ihm versteifen und verdorren; der sich kopf abwärts wie eine Fledermaus an den Füßen aufhängt oder sich zwischen vier Feuern röstet und die Sonne des Südens als fünftes auf sich stechen läßt, der im winterkalten Wasser der Flüsse verharrt oder auf einem Lager von Dornen und Nägeln ruht.
Die quere grausame Behandlung seines Leibes erpreßt Grauen und Bewunderung: da stellt einer vollkommenen Gleichmut gegen alles Liebe und Unliebe zur Schau. Fühllos wie die göttliche Natur des Alls, ist er sichtbar jenseits der Gegensätze getreten, die das Verhalten aller Kreatur in Verlangen und Vermeiden bestimmen, — sie berühren ihn nicht mehr. Die mythische Überlieferung Indiens ist voll von Göttern und Heiligen, besonders aber Dämonen, die solche Askese üben. Sie heißt noch nicht «yoga» aber «tapas» — «Glut» (zu lateinisch «tepor, tepidus» gehörig). Es ist Glut, wie sie die indische Sonne verzehrend, todbringend strahlt, ihre unwiderstehliche Kraft, die schnelles Reifen und Verdorren wirkt, gibt Indien das Bildwort, das unserem Begriffe «Kraft» entspricht.
Tapas zu üben, «Glut zu glühen», wie es heißt, ist der große Versuch, durch unerbittliche Züchtung des Willens zu freiwilligem und zweckfreiem Leiden unabhängig zu werden vom eigenen Leibe, dem Inbegriff der Endlichkeit und alles wechselnd hinfälligen Spieles. An Stelle seiner Gedächtnislosigkeit, die Genossenes wie Ausgestandenes gern vergißt, seines Flutens und Ebbens in Kräftedrang und Unkraft, an Stelle seiner Tyrannei des Bedürfens und Gelüstens soll sich ein Erinnern an den Vorsatz unverrückbar steter Haltung ausprägen, soll vollendeter Gleichmut gegen alle Forderungen von Außen und Innen treten. Passive Souveränität gegenüber dem Zwange der Natur, auf irgend etwas, Gefahr oder Lockung, Trieb oder Störung, reagieren zu müssen, ist das Ziel. Es geht um die Überwindung des Leibes als der Sphäre der Kreatürlichkeit und um die Anbildung einer unmenschlichen Haltung als Form der Weltüberlegenheit.
Diesem altertümlichen Glühen in selbstverhängtem Leiden ist mit späteren Formen des Yoga gemein die völlige Sammlung des Willens, den natürlichen Fluss zu vergewaltigen, in dem der Mensch sich geschehen läßt unter wechselnden Anstößen seiner Umwelt und Innenwelt, diese Sammlung des Willens, völlig abzudanken dem sich vergessenden und vertauschenden Rhythmus spontanen Lebens.
Hier kämpft ein Wille um völlige Freiheit von Ich und Umwelt. Zäh und unerbittlich gegen sich selbst wird der Mensch in maßloser Lust selbstverhängten, immer gesteigerten, zweckfreien Leidens sich schließlich ungeheurer Macht über sich selbst bewußt. Das Gesetz der Natur, das alle bindet mit Reiz und Not, liegt unter ihm; — da steht er: ein imaginärer Weltüberwinder, als Sieger über die kleine Welt, den Mikrokosmos seines Leibes, blickt er den Mächten des Makrokosmos, des Weltganzen ringsum, triumphierend ins Auge. Das ist die große Form der Dämonie des Willens zur Souveränität in Selbstabgeschiedenheit. Sie schwimmt in einem Gefühle in sich beschlossener Allmacht, in grenzenlosen Möglichkeiten, wirkend sich auszustrahlen, und dieses Fluidum wird von den anderen gespürt und weckt in ihnen Furcht und Ehrfurcht. Sein Ausbruch, wo es Widerstand wittert, ist der Blitz flammenden Zornes: Verwünschung und Tod.

Shiva, der allmächtige Asket unter den indischen Göttern, ist die sinnbildliche Gestalt dieser Kraft; «reglos wie ein Klotz» sitzt er auf Gipfeln des Himalaya glühend in seiner Glut, einen Strahl aus ihrer Fülle läßt sein Zorn sich entfahren, als der Liebesgott seinen Pfeil auf ihn zu richten wagt, um ihn ins mythische Weltgeschehen zu verstricken. Mit einem Blitze seines Auges brennt er den lockenden unwiderstehlichen Boten des Lebens zu Asche, der im Auftrag der Götter sein Herz zu bewegen versucht.

Wenn dieses Allmachtsgefühl in sich glühender Kraft sich in den narzißgleichen Selbstgenuß seiner maßlosen Möglichkeiten verliert, vergeudet es seine gestaute Kraft in der Entfaltung gigantischer Traumwelten göttlicher Allmacht, Pracht und Lust. Der Dämon «Goldgewand» glühte im ersten Weltalter zehntausend und zehnhundert Herbste in gewaltiger Glut, bis Brahma, der weltentfaltende, weltüberlegene Gott ihm gewährte, was immer er verlange. Da wählte sich der Dämon, unverwundbar zu sein von allen Wesen und Waffen und nicht bei Tage noch bei Nacht zu sterben. Er wünschte die Kräfte aller Götter, die innen die Welt durchwalten, auf sich zu vereinen. Brahma gewährte es ihm, und als Inbegriff der in ihm glühenden Gewalt entfaltete der Dämon seine Herrschaft über die Welt in prahlenden Maßen, indes die Götter in Ohnmacht zu schattenhafter Schwäche schmolzen. Seine maßlose Kraft ward Gestalt in fürstlich-kosmischen Prächten, lebte sich aus in Glanz und Freuden, Tyrannei und Machtlust ohne Grenzen. In diesem Farbenspiel verzehrte sie sich und ging zur Neige. Da nahte ihm der überweltliche weltordnende Gott Vishnu und machte ihm den Garaus, die götliche Ordnung der Welt wiederherzustellen. Er kam in einer grauenhaften Wundergestalt, die der Dämon nicht hatte vorausahnen können, als er sich gegen alle Gefahr von Göttern, Tieren und Menschen zu sichern wähnte. Nicht Mensch nicht Tier, aber halb ein Löwe halb ein Mann, nahte ihm der Gott und zerriß ihn, — nicht bei Tage und nicht bei Nacht, wo er gefeit war, aber in der Phantasmagorie eines Weltunterganges, den die Zauberkraft des Gottes heraufbeschwor, daß Mond und Sterne bahnenlos durcheinander wirbelten und die Sonne als schwarzer Leichnam ohne Kopf am Himmel schwamm. Da ging es dem starken Dämon wie den nordischen Göttern mit Baldur, als sie den Gott aufblühenden und sterbenden Lebens der Natur zu ewigem Blühen gegen den Tod feien wollten: sie hatten die Mistel vergessen, die immergrüne, die stärker ist und im Jahreswechsel nicht stirbt wie der holde Gott, dessen Tod immer wieder beweint werden muß, wie seine Wiederkunft ersehnt wird. Der Dämon lebte den scheinbar unendlichen Möglichkeiten der Allgewalt, die er in endlichem Ringen in sich gestaut hatte, da ward sie verschwendet, und sein Pakt gegen den Tod hatte ein Loch, wie alle Rechnung des Endlichen auf Ewigkeit.
Darum ist es Gebot dieser Askese, die Fülle glühender Kraft eifersüchtig geballt in sich zu bewahren: dann hängt sie als dauernde Drohung, als Blitz in der Wolke über der Welt ringsum bis zu den waltenden Kräften des Alls, den Göttern. Dann wird diesen Göttern auf ihren Sitzen heiß vor dieser gesammelten, alles drohenden Glut, die unberührbar ihres Waltens spottet, das ebbend und flutend alle Kreatur umspinnt und durchspült.
Diese zäh gesteigerte Glut des Yogin kann die Götter bezwingen: eines Menschen unbeugsame Askese bewog in mythischen Zeiten die Ganga, die am Himmel floß, zur Erde hernieder zu strömen, die, der Wasser beraubt, zu verdorren drohte, — bewog Shiva auf den Höhen des Himalaya den schmetternden Sturz des Götterflusses mit seinem Haupte aufzufangen. Bezeichnend für diese Form der Askese ist die Abspaltung einer abgerungenen Sphäre des Seins jenseits der spontanen Verflochtenheit ins Naturganze von Leib und Welt, ein auf Trotz gestellter Wille zum Eigensein, zum Ledigsein der Gezeiten, die den Menschen durchspülen.
Es gibt noch keine beschreibende Typenlehre, die geschichtlich die Formen der Loslösung vom archaischen Zwange kollektiver Kreaturverbundenheit darstellt, die Überwindung jener frühgeschichtlichen Lage, die ein eigenständiges, ablösbares Ich noch nicht kennt. Lévy-Bruhl hat für diese Atmosphäre den Begriff der «participation mystique» geprägt. Dieser «Bann unfreiwilligen Teilhabens» an der Umwelt erlaubt noch nicht, einen klaren trennenden Kontur um die eigene Person zu ziehen. Innen und Außen sind nicht als solche deutlich geschieden. So lebt das Kind in seinen ersten Jahren.
Dieser Zustand bedeutet gegenüber den Wellenstößen der Umwelt Preisgegebenheit und Geborgenheit in einem. Da gibt es noch kein strikt persönliches Erleben und Schicksal: Rausch und Panik, was immer Tag und Nacht verhängt und was das Ritual des Lebens vorschreibt, durchspült die archaischen Menschen als Gezeiten ihres Gruppendaseins. Wie Zellen eines Organismus Spannung und Mattigkeit teilen, alle Blätter am Baum unter einem Windstoß flüstern, alle Halme des Feldes sich beugen, reagieren die Menschen im «Banne unfreiwilligen Teilhabens». Hier ist Magie etwas sehr Reales. Das richtig gesprochene Zauberwort durchdringt die Person des Anderen widerstandslos, verwandelt, verhext sie. Denn im Banne unfreiwilligen Teilhabens ist der Andere durchlässig für das Fluidum des zaubernden Willens, er leitet elektrisch den Strom, der ihn trifft. Die Person ist gleichsam schalenlos und füllt sich wie ein Schwamm mit den wechselnden Strömen der Umwelt.
In uns Heutigen scheint dieser Bann, unfreiwillig teilzuhaben, weithin gebrochen durch eine lange Kultur des Rationalen und Individualen. Aber die Gewalt aller Massenbewegungen, die Aura der Führeridee, beweist im Großen sein ewiges Leben, wie auch alles unwillkürliche Wissen um das Unbewußte des Anderen in Sympathie und Feindschaft davon zeugt. Wo diese Sphäre noch unangetastet steht, ist auch das Fluidum der Allmacht im Asketen nicht Größenwahn und Irresein, nicht leere Inflation des Ich; wenn Innen und Außen noch unfreiwillig aneinander teilhaben, allgemein wunderbar verschmolzen sind, ist der Yogin wirklich die Macht über andere, die er über sich selbst errungen hat. Durch sein bloßes Dastehen bewährt er sich als wirkende Kraft und beherrscht seine Umwelt, wie ein schreckender Fetisch, ein Gnadenbild oder ein schützendes Amulett wirksam magische Kräfte strahlt. Es ist eine mühsame und lange Errungenschaft, daß wir gegen solche Dämonie des Willens unseren Willen zur Selbstbewahrung setzen können, — daß wir, statt einer Übermacht in Furcht und Ehrfurcht zu erliegen, eine Vergewaltigung abzuwehren vermögen, die das heilig Unangreifbare unserer Person antasten möchte.
In der frühgeschichtlichen Sphäre der einander kollektiv verschmolzenen Menschen steht übermenschlich, göttlich und heilig da, was in unserer Gesellschaft, die sich aus eigenständigen Personen aufbaut, keinen Platz mehr hat mit seinem Anspruch auf magische Bewirkung unfreiwilligen Teilhabens: diesem Yogin-Typus entspricht bei uns in asozialer Selbstversunkenheit ein Irrer mit seinem Größenwahn.
Aber noch Gandhi, eine höchst soziale und politische Erscheinung mit einem westlich orientierten Programm nationaler und wirtschaftlicher Unabhängigkeit, zieht in Indien seine Wirkung auf weite Massen zum großen Teil aus der Erneuerung dieses Asketentyps in seiner Person: unablässig drängt er sich zum Leiden, nicht bloß als politischer Märtyrer, — ebensosehr in ständig gezeigter, vorgelebter Selbstqual freiwillig verhängter Entsagungen, zweckfreier Mortifikationen seines Leibes.
Das unfreiwillige Teilhaben ist ein zweideutiger Zustand: sein Trost ist, in keiner Not einsam zu sein; seine ewige Qual, alle Schwingungen der Umwelt teilen zu müssen. Aus dieser Preisgegebenheit erhebt sich der Mensch an verschiedenen Stellen der Erdgeschichte zur Eigenständigkeit und Souveränität. Die seltene Erscheinung des wahren Helden tritt über den Horizont, der keiner Götterhilfe, keiner Zauberwaffen bedarf, der nicht erbebt, wo alle zittern. Am Eingange unseres europäischen Weges zur souveränen Person steht der Achill Homers. Er galt den Griechen als erzieherische Idealgestalt wie sein Sänger als nationaler Pädagoge. In Achills Gestalt erhebt sich der griechische Mensch in heroischer Entscheidung über die leidvolle und bergende Verbundenheit mit den fließenden Mächten des Lebens: er hat das kreatürliche Los — Leib und Vergänglichkeit — überwunden, als er den frühen Tod der Lust am langen Leben vorzog. Da schlug der Sohn der Thetis den Mantel seiner verwunschenen Gottheit um sich: — er, dem Zeus' Nachfolge als höchster Gott geweissagt ward, wäre Zeus sein Vater geworden. Aber Zeus fürchtete den Sohn, der ihn stürzen müßte, wie er den Vater Kronos, und vermählte Thetis, die ihn bringen würde, dem sterblichen König. Achill ist einsam unter allen Menschen, — darum bedarf er des Freundes so sehr. Er allein kann vom Kampfe abstehen, der alle Helden vor Ilion vereint, wann es seinem Zorne beliebt. Er bedarf nicht des Beistandes der Götter, der andere Helden, wie Diomedes, auf einen Kampftag ihrer Aristie zu wahren Helden macht und sie in der Not berät, — allenfalls darf ihr warnendes Wort sein Wüten hemmen, ihre Kunst ihm den Waffenschmuck schmieden, der seines Todesganges würdig ist. Aber was er Einziges, Unerhörtes ist, vermag er einzig aus sich selbst. Er hat den Tod, die absolute Bedrohung des leiblichen Lebens — gleichsam seine punkthaft und negativ gewordene Integration und Quintessenz — überwunden als die größte Versuchung, auf etwas zu reagieren, so wie der Yogin die Vielfalt der Versuchungen leiblichen Daseins, Macht über ihn zu gewinnen, überwunden hat.
In diesen beiden Typen ist der archaische Mensch auf zwei entgegengesetzten Wegen aufgebrochen, den Zwang seines Standes in unfreiwilliger Preisgegebenheit abzutun und souverän zu werden. Wie der Yogin auf keine Stimme der Umwelt und Innenwelt hört, die ihn bespricht, und auf Stimmen der Götter auch nur, wenn es ihm beliebt, gebeut Achill den Götterrossen vor seinem Wagen, die ihrem Herrn in unfreiwilligem Teilhaben verbunden sind, zu schweigen, als sie, sein nahes Ende fühlend, ihm vom Tode reden wollen. Beide Typen sind Helden, denn Heldentum ist innerlich: in uns wird überwunden oder nirgendwo. Indien hat keinen Helden wie Achill. Aber die Yoginsekte der Jaina's nennt sich nach ihrem großen Erneuerer zu Buddhas Zeiten, nach dem «Jina», dem «Sieger», und heißt ihn selbst «Mahdvira», den «großen Helden». Mit dem Ende der epischen Heldenzeit in Indien sind die Namen und Zeichen des Heldischen auf seine großen Asketen und Yogin übergegangen; -wie Homers Achill für die Griechen, werden sie zu erzieherischen Leitbildern der Kultur. Achill ist einsam in der Welt Homers, — in aller Welt; nur Herakles ist ihm verwandt, verwunschener Göttersohn wie er, um sein glänzendes Los durch Götterneid betrogen, front er dem schlechten Bruder, ringt mit Ungeheuern und reinigt den Stall des Augias statt die Krone zu tragen, durchläuft in großem Verzicht den Kreis seiner Taten, bis sie ihm endlich den Olymp entriegeln, der seine wahre Stätte, seine Heimat ist vom Vater her.
In der Folge vollzieht sich die Loslösung des griechischen Menschen vom Zwange unfreiwilligen Teilhabens als das Werk des Geistes. Das Denken in den Wissenschaften, das es nur bei den Griechen und als ihr Erbe gibt, und in der Philosophie, die sich aus ihnen nährt, trennt Welt und Ich, Innen und Außen, verschalt die Person, gibt ihr die Idee der Freiheit. Die besondere Erscheinung des Abendlandes tritt über den Horizont. Sein neues Denken befreit den Menschen von der Unmittelbarkeit der umgebenden Welt, ihr bannender Eindruck wird zur bloßen Erscheinung, er wirkt nicht mehr als schlechthin Wirkliches. Die Sinne, die naturhaft unfreiwillig teilhaben an allem Fließenden, das sie umdrängt und füllt, ergreifen nicht das Wirkliche, es west hinter dem sinn¬lich Gegebenen. Die Abstraktion des Denkens entzieht auf der einen Seite die Person dem Zwange des Unmittelbaren, andererseits zieht sie das Wirkliche als mittelbaren Gegenstand des Erkennens aus dem unmittelbar Gegebenen heraus. Es bildet sich der analytische Griff hinter das vieldeutig Gegebene, das die Sinne magisch befängt, daß sie es erleiden müssen, wie das Fluidum eines Zaubers. Die Welt der Sinne, und also das Leibliche, wird überwunden; von ihr erhebt sich Erkenntnis des Wirklichen zur Welt unsinnlicher Formeln und Begriffe: sie sind das Geheimnis der Wirklichkeit. Dagegen sagt die indische Medizin einmal, «aller Welten und Wesen Ursachen zu erkennen» — warum sie im einzelnen so sind, wie sie sind: ihr geheimes Gesetz — «ist nicht möglich, ist göttliches Geheimnis ... das Undenkbare soll man auf sich beruhen lassen». Mit dieser Haltung bleibt man im Nebeneinander von Beschreibung und Beobachtung, gesiebter Erfahrung und spekulativem Verknüpfen.
Hier gabeln sich die Wege, und der westliche führt ins Reich des Wirklichen als des vom Geist Begriffenen. Gültige Wirklichkeit ist uns — in Wandlungen — seit den Griechen nur mehr, was der Geist begreift, was er im Warum des Soseins zu erfassen und in begrifflicher Synthese zu konstruieren vermag. Diese Synthese schafft die Welt nach mit den Baustoffen des Geistes: in Begriff und Formel. Da steht der alte dämonische Wille, souverän zu sein, in neuem Gewande da, im Kleid des Geistes, der durch Verstehen souverän ist. Das ist das Pathos Hegels als begrifflichen Konstrukteurs der Welt, eine mächtige innere Angelegenheit mit wirkender Strahlung in die Umwelt, — wie das Machtgefühl des Yogin.
Novalis sagt in einem seiner Fragmente, «wir wissen nur, insoweit wir machen. Wir kennen die Schöpfung nur, insofern wir selbst Gott sind; wir kennen sie nicht, insofern wir selbst Welt sind.» — Das Werk des Geistes ist das Machen der Schöpfung. Der Mensch im Banne unfreiwilligen Teilhabens ergibt sich darein, im Wechsel von Lebensjubel und -jammer «Welt» zu sein, — aber der Yogin will, wie der Träger des westlichen Geistes, nicht länger «Welt» sein, aber «Gott», — freilich, entgegen Novalis, nicht im «Machen der Schöpfung» durch die Kraft des Geistes. Mit dem Yogin kommt aus einer frühgeschichtlichen Grundsituation der Menschheit eine andere Möglichkeit herauf, sich souverän zu wissen, sie bewegt sich in entgegengesetzter Richtung zum Gange des Abendlandes.
Dem westlichen Weg des Geistes wohnt eine besondere Richtung inne: er strebt nach außen. Sein Tun nennt sich nach einer Gebärde im Raume: «begreifen». Ihm wird noch das Innerste, wenn er es begreifen will, zu einem Äußeren, zu einem Gegenstande, der von ihm abgesetzt sich ihm gegenüber findet. Denn die unmit¬telbare innere Erfahrung ist ihm kein Erweis für gültige Wirklichkeit, so wenig wie der Sinnenschein. Sein Wirkliches ist das Abstrakte, das Allgemeine. Das Unmittelbare gilt ihm nicht, denn die Sphäre des Geistes ist das Mittelbare. In Indien aber gilt das Unmittelbare innen wie in den Sinnen außen als das Wirkliche, — Selbstgewißheit, wie sie bei uns der Irre, abgespalten von der Welt, dem Schein der Welt, der den anderen gilt, entgegenhält. Die Frucht des inneren Sieges im Yogin, Souveränität, beglaubigt sich allstündlich vor sich selbst in der errungenen Freiheit vom Wechselspiel des eigenen Leibes und der Umwelt. Sie ist punkthafte Vollendung in der Souveränität, indes der Geist über die Zeiten hin um die Bewältigung der unabsehbaren Weite seines Reiches ringt: Da ist Vollendung in der Souveränität ein barer Grenzbegriff.
Wir kennen nur eine Form der Freiheit: das Reich des Geistes — Indien kennt so viele Abarten seiner eigenen Form, frei zu werden, wie es Arten von Yoga besitzt. Die Jaina-Yogins des 6. Jahrhunderts v. Chr. vermitteln aus augenscheinlich viel höherem Altertum vorarischer Kultur eine ausgebildete Yogalehre. In ihr entfaltet die Erfahrung, leidvoll-unfreiwillig teilzuhaben am Flusse des Vergänglichen, die Weite indischer Ausmaße. Da ist Samsära: ewig kreisendes Leben, «die Welten sinken und die Welten steigen» in langen Schleifenbahnen, «ewig im Wandel», aber ohne Ende. Und Lebensmonaden ohne Zahl und unvergänglich, durch Tod und Neugeburt Gestalten tauschend, schweben in ihm wie Flimmerstäubchen im Sonnenstrahl. Sie haben in jedem Leibe Raum und erfüllen wechselnd seinen Umfang, an Ameise wie an Elefant. Ihre kleinsten Körper sind die Atome der [[Element]e im allbelebten Weltleibe, ihre schönsten sind die Gestalten der Götter. Sie kreisen auf und ab zwischen Welten oben und unten und wechseln sterbend die Behausung, bald sind sie Mensch, bald Gott, bald Tier oder Höllensträfling. Ihr Leben, zeitlos über alle Tode, schenkt Indien die Riesenzahlen seiner Zeitzyklen in mythischer Eintönigkeit und gibt ihm die Gewißheit der ewigen Wiederkehr des Gleichen, etwa die legendare Erinnerung an dreiundzwanzig Vorgänger des Mahävira, — ein Zug von Dubletten, der sich im Dämmer der Äonen nach rückwärts verliert.
Dieses östliche Wissen um die Todlosigkeit des Lebens bei allem Sterben und dem Verlust der Individuation im Gestaltentausch hat mit seinem Flügelschlage auch Hellas gestreift, — Empedokles singt, «Ehmals schon war ich als Knabe geboren, war ehmals ein Mädchen, Vogel war ich und Busch und ein stummer Fisch aus der Salzflut», — von Orpheus' mythischen Zeiten an fließt dieses Wissen, halb unter¬irdisch, durch die antike Tradition, bei Platon und seiner Nachfolge aus der Tiefe aufrauschend, von der Kirche dann verschüttet. In Indien aber wächst alles höhere Ringen aus diesem Schatten, — Yoga ist die Überwindung des Grams der Ewigkeit. Von Indien her ist es unvorstellbar, daß der Mensch an die Unvergänglichkeit seiner Individuation zu glauben vermag, denn Individuation ist zuerst und zuletzt der Leib. Darum haben bei uns noch die Toten des Hades und die Seligen des Himmels schattenhafte oder verklärte Leiber mit Physiognomien, die ihre Identität unmittelbar beglaubigen. Achill, der Grieche, bleibt immer doch Achill, auch bei den Schatten der Unterwelt, und möchte seine unzerlösliche Person tauschen mit einem Tagelöhner oben im Licht: Dantes christliches Auge fällt in Himmel und Hölle und findet lauter bekannte Gestalten von grauer Heroenzeit und Schöpfungsanfang her bis auf die Straßen seines Florenz. Die Maske, die «persona» unserer Individuation, ist uns im Westen so angewachsen, daß keine Ewigkeit sie auslöscht, und Seligkeit sie verklären, aber nie abschmelzen kann. Im Indien des Samsara aber ist sie wechselndes Kostüm für immer neue fliehende Szenen einer Revue, die ohne Ende spielt. Ihre stumme Regie jagt dieselben Spielerscharen pausenlos mit immer neuen Masken in immer verwandelte Szenerien und Stegreifspiele, und die Bühne ist das große vielstöckige Welttheater: der schichtenreiche Weltleib.
Da hat jeder alle Rollen schon oft gespielt. Die indische Archäologie gibt neuerdings mit ausgegrabenen Städten des Induslandes, Zeugen einer versunkenen hohen Kultur des 3. Jahrtausends, die uns ein Ende aber keinen Anfang zeigen, ein Stückchen greifbaren Untergrundes für dieses Zeit- und Lebensgefühl, das im geschichtlichen Auf und Ab von Größe und Vergang nur zyklisches Naturgeschehen zu sehen vermag.
Wie oft haben wir alle Rollen schon gespielt und waren in jede Art Schicksal verstrickt! — daher die Dringlichkeit der Frage: was geht mich meine Person, diese Maske an? dieses schier unlösliche Beieinander immer anderer individualer Arten, mich zu gebaren und zu reagieren? dieser Zwang, das Ineinander einer Umwelt und eines Ich in immer spezifischer Struktur und Färbung als einen immer erneuten Prozeß aus mir hervorzubringene? Was bindet mich an diesen Prozeß, es sei denn die Lust zu ihm, das Hangen an ihm, oder die Angst, ließe ich ihn los, in ein Bodenloses zu stürzen, vor dem mir graut, ein Nichts gegen ihn einzutauschen oder ein unsagbares Was?
Wie komme ich dazu, der zu sein, der ich bin? — wie komme ich dazu, immer irgend etwas sein zu müssen? und wo fände ich das Sein, das nicht ein bestimmtes Irgendetwas ist? sondern Sein schlechthin, unsagbar, grenzenlos, durch die Färbung keiner Eigenschaft getrübt. — Hier liegt für den Westen eine Grenze des Wahn¬sinns, — aber wir sind es müde, wir selbst zu sein; nicht nur dieses eine Ich, dessen Rolle uns gerade beschäftigt, nein: alles Ich, und sei es groß und herrlich, Gott oder Stern, — widert uns an.
Was gehe ich mich eigentlich an als der ich bin, was ich bin. Man muß augenscheinlich, wie ein Tier, gar kein Gefühl dafür haben, daß wir schon immer auf die eine oder andere Weise dabei gewesen sind, in allen Zeiten und Welten, — man muß wirklich blind sein für diesen simpelsten Umstand, um den Befund seiner Individuation für etwas Erfreuliches und Bewahrenswertes zu nehmen. Wie komme ich dazu, immer etwas sein zu müssen, anstatt ganz einfach zu sein? welche Hexerei geht da vor? es muß irgend etwas an mir oder in mir sein, das mich verzaubert, daß ich immer irgend etwas bin. Ich bin augenscheinlich nicht im Besitze meiner vollen Klarheit und Herrlichkeit, daß ich mich immer mit irgendeinem Bestimmten an mir verwechsle, wie wenn einer seinen Handschuh für die Haut nähme?
Was ist daran schuld? — ich selbst. Ich ganz allein. Weil ich immer irgend etwas tue. Denn Leben heißt, immer irgend etwas «tun», — dieses Wort im weitesten Sinne genommen. Auch Leiden ist solch ein «Tun», und alles Wahrnehmen, Fühlen, Denken schon gar, — vom Reden und Handeln zu schweigen. Leben heißt, daß irgend etwas Bestimmtes immerfort mit mir vorgeht. Und dieses Bestimmte, das ich tu, — bestimmt mich. Indem ich bin, vollstrecke ich mich jeden Augenblick neu, bestimme mich in gutem oder schlimmem Sinne. Dieses «Tun» — karman — gehört zum Lebensprozeß wie das Wasser zum Fließen. Es ist eine Art Stoff — dem frühgeschichtlichen Denken ist alles Wirkliche ein Stoff, kompakt oder fluid, — und dieser Stoff drängt sich wie Farbstoff oder Schmutz in die kristallen lautere Lebensmonade und hält sie von sich imprägniert.
Aber diese Imprägnierung bleibt nicht starr, — sie wirkt, und wirkend setzt sie sich um. Was wir gestern dachten, müssen wir heute tun; was wir jüngst litten, furcht heute unser Gesicht. So auch im Großen: alles karman, das die Lebensmonade durch Verhalten spezifisch an sich sog, baut an ihrem Hause von heut und morgen, — an Leib und Schicksal; es bildet an ihrem Leibe, und der Leib ist Träger wie Hieroglyphe des Schicksals.
Mit der Qualität unseres «Tuns» — ob trüb oder licht, ichver-sessen oder vom Ich gelöst — bestimmen wir uns stündlich neu. Indem wir in dieser oder jener Richtung zu uns Ja sagen, zu unse-rem Dumpfen oder Hellen, vollstrecken wir uns zu dieser oder jener Daseinsform. Solche Entscheidungen, allstündlich neu gehäuft, ergaben unsere gegenwärtige Person mit ihren Qualitäten, ihren Möglichkeiten und Grenzen. Sie bestimmen, noch weiterwirkend und ständig um neue vermehrt, unsere Zukunft: die Physiognomie und das Schicksal, das wir haben werden. Ihre bestimmende Macht reicht bis in Haarfarbe und Nasenform, in Krankheiten und Erfolge, Lebensdauer und Erkenntnisreife. Sie erklärt das alles in seinem spezifischen So-sein, sie bildet und erklärt die Individuation. Wir sind in allem unsere persönlichste Erbschaft; kein anderer als wir selbst verantwortet unsere Individuation; in Akten ohne Zahl, gewußt und unbewußt, haben wir sie gewollt und gewählt.
Indem das karman sich zu Leib und Schicksal auswirkt, wird seine Kraft Gestalt. Alles Gestaltige aber ist vergänglich. Indem karman als Leib und Schicksal abgetragen und erlitten wird, erschöpft es sich jeweils. Aber der spontane Vorgang der Lebens-handlung strömt immer neues zu; so vollziehen wir beständig an uns das Gericht und büßen für unser Sogewesensein mit Gegenwart und Zukunft. Alles was als Trieb und Bild, Empfindung und Tat, als Akt schlechthin dem Unbewußten entspringt und einem Reiz von außen oder innen Antwort gibt, ist Gestaltwerdung des karman-Stoffes, den die Monade in anfangslosem Gange als Essenz jeweiligen Verhaltens in sich «gebunden» hat. Gestaltwerdend scheidet er wieder aus, aber mit jedem Akt strömt neuer ein. So ist die Monade wie ein Teich, in den Quellen münden und dem ein Strom entspringt. Die Quellen sind, was wir vorzeiten oder jüngst erst «taten», der Strom ist, was wir sind und werden können und unserem Sein und Werden entsprechend tun und leiden müssen. Als Individuen sind wir, im Bewußten wie im Unbewußten, um und um bestimmt durch frühere Akte, — wir sind unsere eigene Geschichte, — und bestimmen uns allstündlich neu, indem wir unserer Individuation leben. Gar nichts Bestimmtes mehr tun, auf alle Akte überhaupt verzichten, das wäre der Weg zum Freisein von der Individuation und von allem unfreiwilligen Teilhaben an anfangsloser Lebensverflochtenheit.
Hier scheint das Leben alt geworden, — nach Jahrtausenden, die für uns verdämmern —: es will das Gesetz alles Daseins nicht länger dulden, daß es Individuation sein muß und mit ihrem jewei¬ligen Maß von Lust und Leid den Lebenstag durchlaufen soll. Aber das scheint nur so. Denn es rechtet ja nicht um die Last seines Lebenstages, wie Hiob, — sondern es erstarrt vor dem Wissen: auf Tage folgen immer Tage, ohne Ende, Ziel und Sinn. Zeit ist unend¬lich und Leben auch. Hier langt das Leben vielmehr in frühgeschichtlich-urtümlichem Ahnen um sich selbst in seine tiefere Schicht: Leben schlechthin zu sein im Wandel vergehender Masken, und will nur diese Tiefe sein ohne das Spiel der Oberfläche. Der Grund zu diesem Willen ist ein unfreiwilliges Teilhaben am geleb¬ten Leben über die Zeiten hinweg. Hier spricht ein Erinnern aus dem Unbewußten, das tiefer liegt als die Schicht individueller Erfahrungen, die ins Unbewußte abgesunken sind und aus ihm steigen können, hier spricht ein Schatz von Zeichen und Bildern, die, unserer Tiefe eingegraben, in Träumen und Vorstellungen uns als uraltes Gut aufscheinen, mit dem wir Heutigen Seelenlagen des frühgeschichtlichen Menschen reproduzieren. Die Lebendigkeit dieser altvergangenen Stadien, die wir als Gattung geschichtlich durchlaufen haben, bis wir die späten Menschen von heut und hier geworden sind, ist uns in größere Tiefe abgesunken und dumpf geworden; mit ganz anderer Gewalt steht diese Kraft, vergangene Stadien wirksam zu erinnern, ihrer bannenden Macht innezusein, im geschichtlich früheren Inder da. Sein unfreiwilliges Teilhaben an verdämmernder Vergangenheit wirft den längsten Schatten über seine Gegenwart und Zukunft; im Zwange, grenzenloser Herkunft sich bewußt zu sein, kann er sich nicht darüber täuschen, daß es endlos weitergehen muß.
Alles worin wir als Wesen voneinander verschieden sind, alle wechselnden Masken, Greifbares, Bewußtes und Unbewußtes an Erbe und Bereitschaften, in dieser oder jener Form zu sein, wird uns vom karman jeden Augenblick neu angeschminkt; — uralte, immer verjüngte Schauspieler des Ewigen Welttheaters, die wir sind, — schminken wir uns ab!
Wie löst man sich aus alledem? — es gilt, die Zuflüsse immer neuen karmans zu verstopfen, der Teich der Monade muß sich durch den Strom fortlaufenden Schicksals leerlaufen, ohne neu gespeist zu werden mit Bestimmungen, die neue Individuation er-wirken. Es gilt, sein Leben hinzunehmen, ohne zu reagieren. Völ-lige Reglosigkeit nach innen und außen, ein sich selbst Absterben, das wie Starrkrampf oder völlige Lähmung aussehen mag, ist der ideale Weg zur Lösung aus unfreiwilliger Verflochtenheit ins Leben, die uns Gestalt und mit ihr Grenzen aller Leiblichkeit an-bildet. In einem Gange stofflicher Reinigung, der über viele Leben läuft, wird die Monade sich mählich von aller anfanglos in sie ge-drungenen Trübe zu kristallener Reinheit läutern, durch immer neue Filter der Askese sinternd läßt sie den Schmutz des karman-Stoffs hinter sich zurück.
So erlangt sie endlich «völliges Ledigsein» (kaivalya) vom un-freiwilligen Teilhaben am gestaltbildenden Stoffe der Welt, der durch Akte aller Art in sie quillt und sie mit Vergänglichem verquickt. Auf diesem Gange wird sich, was ungewußt als Keime zu Physiognomie und Schicksal in uns liegt, an uns gestaltig als Leib und Leiden auswirken, — aber um sich stofflich zu erschöpfen, in-dem es sich vollstreckt. Ist aber das letzte karman in Gestalt von Leib und Schicksal abgebüßt, so ist alle Möglichkeit, Schalen der Leiblichkeit oder Individuation zu bilden, — und wär's ein Götter-leib, — geschwunden. Der Kristall eines Jenseits von Welt und Ich, der zeitlos von beiden imprägniert war, ist zu höchster Reinheit herausgeläutert, der Kern überindividualen lauteren Lebens bricht unanfechtbar, unaufhaltsam auf aus dem Bereiche der Gewalt, die alles bindet und verbindet mit dem Banne unfreiwilligen Teilhabens am gestaltigen individualen Leben.
Wie eine Luftblase dem Wasser entschnellt, wird die lautere Monade auffahren zur höchsten entrückten Sphäre der Welt: Hinauf in die Hirnschale der Weltmutter, deren Leib der Kosmos ist. Aufwärts schwebend scheidet sie aus der Erdsphäre der Menschen, die quer in der Mitte des Leibes der Weltenmutter liegt, der alle Weltensphären in sich beschließt, und wird auch den dämonischen Natur und Höllenreichen, die abwärts liegen bis zu ihren Füßen, auf ewig ungreifbar. Sie folgt dem Gesetz ihrer Schwerelosigkeit und quert spielend die immer leichteren, lichteren, aber immer noch farbenschweren Welten der Götter, die übereinander gelagert sind in Oberleib, Hals und Gesicht der Weltfrau, sie steigt zur Stätte wahlverwandter höchster Klarheit und bewegungsloser Stille, zur obersten Hirnwelt der Weltmutter.
Hier spricht keine metaphysische Spekulation: leibliche Yogaerfahrung sagt sich im indischen Rahmen eines altüberlieferten, vorarischen Weltbildes und mit seinem Vorstellungsschatze aus. Frühgeschichtlicher Denkweise entsprechend psychologisiert sich diese Erfahrung nicht, sondern prägt ihren Gehalt in die Stofflichkeit kosmisch-metaphysischer Symbole bildhaften Denkens. Aber es liegt kein moralisch-kosmologisches Mythisieren vor wie im späten Manichäismus und seinen Verwandten, kein mythisches Denken, nichts vergleichbar jenen Reichen des Lichts und des Bösen, das Kerne des Lichtreiches in balladeskem Kampfe gef an-gennahm, keine Weltschöpfung, nach hohem Plane bestimmt, die gefangenen Lichtatome wieder aus der Gefangenschaft des Dun-kels herauszudestillieren und die Macht des Bösen zu entkräften.. Hier entfaltet kein theologisches Dogma den Ablauf eines kosmischen Epos von mythischem Anfang zu ersehnter Erfüllung, wie bei Mani und auch bei Augustin; hier spielt kein spekulativ gewo-benes Drama kosmisch-sittlicher Kräfte wie im christlichen Mythos. von Eden über Golgatha zum himmlischen Jerusalem, — hier hat. vorarisch-indische Kultur in spätem Zeugnis sich ausgelebt zu einem rationalen Weltbild, — trotz Göttern und Dämonen und dem mythischen Bilde des Weltleibs als gigantischer Muttergestalt. (Abb. 1, S. 48).
Der Bann mythischer Weltinterpretation, der die Ursprünge des Manichäismus wie des Christentums befängt, darin die Geschichtsphilosophie der Kirche heute noch lebt, — sie ist eine Mythe, — ist hier gebrochen. Aber unsere späteren abstrakten Denkgewohnheiten sind dabei keineswegs vorweggenommen, sie bleiben seitwärts fern am Weg des Geistes liegen. Denn der archai¬sche Bann mythisierender Phantasie ward hier nicht durch den Geist gebrochen, sondern durch Yoga. Hier stößt das Leben, indem es seiner greifbaren Form, der Individuation, so willentlich wie mühsam abstirbt, zu seiner tiefsten Sphäre durch, zu seiner gestaltlosen Grenzenlosigkeit, zu seinem Sein schlechthin.
Es gilt, die Bildersprache dieses Yoga richtig zu lesen; es wäre ein optischer Trug, den die Sehgewohnheiten unseres anderen, abstrakten Denkens uns nahelegen, es wäre eine fälschliche Übertragung, anzunehmen, diese Größe «Sein schlechthin» wäre hier, als allen individual seienden Lebensgestalten begrifflich anhaftend, denkend aus ihnen herausgezogen worden als ihr Generalnenner, als das überindividuell Gemeinsame aller individuellen Daseinsmöglichkeiten. Vielmehr: Im konsequenten Abbau seiner Individuation erfährt das Leben in sich selbst als Grenzwert seinen überindividuellen Charakter, den es sonst, nach außen blickend in das Spiel der Welt, aus den Individuen zu abstrahieren vermag. In unendlicher Annäherung an diesen Grenzwert erfährt es ihn als schließliche Erfüllung dieses Weiterschreitens: als ein In-sich-selber-Wesen in völligem Ledigsein von allen Grenzen des Bestimmtseins.
Wenn Yogaerfahrung sich in Worten aussagt, im tönenden Zeichenschatz des Denkens, begegnen ihre Formeln sich zwangsläufig mit denen des abstrahierenden Denkens, das sich der gleichen Münze bedient; aber man verschüttet sich die Erkenntnis, wenn man das Andersartige des Wegs, auf dem sie gewonnen sind, und das Eigentümliche der Sphäre, in der sie wurzeln, nicht zu sehen vermag. Beides bezeichnet das Andersartige ihrer Kraft. Denn was der Mensch sich denkend erarbeitet, verwandelt ihn noch nicht; der Jaina-Yoga aber geht wie aller Yoga auf ein verwandeltes Sein und auf kein Denken, keinen geistigen Gehalt. Das Denken unter allen anderen Akten auszuschalten, liegt im Prinzip seines totalen Abbaus der Person.
Die Monade ist ewiges Leben. Nach aller Ereignisfülle anfangsloser Individuationen, die sie an sich erfuhr, geht sie zeitloser Ereignislosigkeit entgegen. Völlig geläutert gleicht eine ganz der anderen. Sie haben ihr Gesicht verloren, — eben darum ging es ja. Alle Grenzen des Erkennens, die jeder Organismus vom Wurm bis zum Menschen mit seinem spezifischen Apparat an Sinnes- und Geisteskräften dem Leben in ihm setzt, sind weggefallen, alle Grenzen der Macht zu wirken, die unser jeweiliger Leib mit seinen Gliedern und Organen uns läßt und die unser Kräftevolumen und unsere Gebrechlichkeit uns ziehen, sind ausgelöscht, alle Dumpf-heit und Ohnmacht, nach deren spezifischem Vorwalten alle Le-bensformen der Natur und alle Exemplare einer Gattung sich in eine stufenreiche Hierarchie ordnen ließen, sind dahin.
Aber in dieser Grenzenlosigkeit, allwissend und allmächtig Leben zu sein, ist alle Beziehung zum Reiche des Begrenzten, ist alle Wirkungsmöglichkeit dieser Kräfte auf die Welt und ihre Wesen geschwunden. Die erlösten Heiligen, in der Hirnschale der Welt über den Göttern wesend, vernehmen kein Gebet; in der obersten kosmischen Sphäre der «Ledig-Gewordenen» (kevalin) fehlt jenes besondere fluide Element im Raume, das nach der besonderen Physik der Jaina's allen anderen Weltsphären innewohnt und in ihnen «wie das Wasser dem Fisch» ihren Geschöpfen ermöglicht, sich im Raume zu bewegen. Rein, reglos, wandellos, einander völlig gleich, — glasklare Lebenstropfen als Niederschlag an der oberen Kuppel des Alls, — sind diese Monaden, von uns aus gesehen, «tot vor Unsterblichkeit».
In Indien kann man ungefähr jedem ansehen, was er ist. Er trägt das Mal seines Gottes auf die Stirn gezeichnet, trägt das Kleid seines Standes, seiner Kaste. Der Schmuck einer Frau verrät an ihr, ob ihr Mann noch am Leben ist, ob er gerade verreist ist. Alles Äußere ist vom durchgreifenden Lebensritual weitgehend geregelt, denn es hat magische Bedeutung, wie ein Amulett oder der Name der Person. Man ist nach Kaste, Sekte und anderen Bestim-mungen seines Daseins äußerlich so kenntlich, wie Tiere ihrer Gat¬tung nach an Fell und Federkleid, Bau und Gliedern. Die Götter erscheinen im starren Schmuck ihrer Waffen und Zeichen, darin sich ihre Kräfte verkörpern, — woran wüßte man sonst, daß sie es wirklich sind, die leibhaft den Frommen nahen oder in Bildern dargestellt sind?
So kennt die indische Kunst bei aller Feier sinnlichen Reizes an Göttern und Menschen die bare Nacktheit nicht, denn nur der ge¬schmückte Leib gilt als ein schöner. Einzig die Jaina's stellen ihre vollendeten Heiligen, die über Äonen immer wieder die Lehre erneuern, in völliger Nacktheit dar, — wie ihre Asketen ursprünglich völlig nackt einhergingen. Diese Nacktheit ist von sublimer Kahlheit und ganz unsinnlich. Vollkommene Anonymität und Ausdrucksleere liegt auf Leibern und Gesicht der «Ledig-Gewordenen», wie sie die Kunst der Jaina's darstellt. Sie ist der sinnvolle Aus¬druck dafür, daß sie schicksalslos geworden sind: aller Bestimmtheit ledig. Sie bezeichnet den Gegensatz der Erlösten zu allen anderen Wesen, deren Physiognomie bis in Tracht und Schmuck die Bestimmtheit, die Grenzen ihrer Individuation zum Ausdruck bringt. Die Nacktheit ihrer Heiligenbilder entblößt nicht das Schöne und Starke der Gestalt, es stellt nicht ihr Reizendes, ihre vollkommene Bildung, — die wohl vorhanden ist, — zu entzückender Schau; sie gibt die Barheit des Beziehungslosen, die glasklare Lauterkeit des völlig Gereinigten, die Unanrührbarkeit völligen Ledigseins. Darum wählt diese Kunst gern milchig spiegelnden Alabaster für ihre Gestalten : Nicht einmal Licht und Schatten können sie berühren. Aber ihre «Sieger»-Gestalten bewahren als Zeichen ewigen Seins die stoffliche Dichte des Wirklichen, sie sind nicht aufgelöst zu jenem bloßen Schein einer illusionären Phantasmagorie, in dem vollendete Bilder der «völlig erloschenen» Buddha's sich dem Auge geben (Abb. 2, S. 49).
Der greifbare Teil der Individuation ist der Leib, er ist dem Abbauwillen handhaft preisgegeben. Aber kein Selbstmord als Tat befreit von ihm, — Tat bindet neu, — nur ein Geschehenlassen in Nicht-«Tun». Darum ist Hungerfasten das große Gebot der Askese, und Fasten zum selbstgesetzten Tode der Gipfel des Yoga. Auch ein Laie, der das Gelübde der Jaina-Yogin, das härteste aller Mönchsgelübde mit minutiösen Regeln, stündlich alles «Tun» zu vermeiden, nicht auf sich nehmen mag, der mit Wohltätigkeit und kleineren Fasten sein Leben fromm verbringt, — oft ein Kaufmann oder Bankier mit blühendem Unternehmen, — wird seinem erbau-lichen Wandel die Krone aufsetzen und sich zu Tode fasten, wenn er sein Ende nahen fühlt.
Das Ziel des Yogin, der «Glut glühend» sich in Kern und Schale spaltet, um im Kerne souverän zu sein, jenseits des unfreiwilligen Teilhabens der Schale, ist hier überboten: die Schale wird faktisch abgebaut. Ein inneres Jenseits von Welt und Ich wird als ihr Kern aus ihr hervorgeläutert und aus ihr befreit. Aus dieser Sphäre idealer Unmenschlichkeit gegen die eigene Person stammt Gandhi von den Eltern her. Daher Gandhis Drang und Kraft, zu leiden, daher sein immer erneutes Wünschen und Drohen, durch Hungerfasten zu sterben, — freilich, und das ist modern, verkoppelt mit realpolitischen Erpressungen. Ist Leben unter solcher Zielsetzung überhaupt möglich? — aber es will ja gar nicht mehr gelebt sein in den Formen, die alle Individualität bejaht. Indien im Großen entschied geschichtlich gegen den Jaina-Yoga; als ein spätes Zeugnis seines vorarischen Altertums ragt er im starren Gewande einer besonderen Kosmologie und Psychologie in die Reihe jüngerer Yogaformen, die das Brahmanentum in Ver-schmelzung seines Erbgutes der Veden mit vorarischen Anschauungen und Bräuchen im Hinduismus hervorgetrieben hat.
Den geistigen Gegenschlag zur überspannten leiblichen Askese des Jaina-Yoga bringt die Bhagavadgitä, das Credo des Hinduis¬mus: ein Leben ohne alles «Tun», auch nur als Grenzwert, gibt es nicht; Leben und «Tun» sind untrennbar als Prozeß, aber das anscheinend Unvereinbare: Individuation und Souveränität, unfreiwilliges Teilhaben und völliges Enthobensein, lässt sich vereinen, — durch eine rein innere Distanz zur Person.
Individuation wird durch den Yoga der Bhagavadgitä als Schale erfahren, die den Kern überindividuellen Lebens in uns umschließt, ohne ihn zu imprägnieren. Yoga heißt: Spaltung wollen, heißt: alle Person als ein dem Wesen Fremdes von sich abspalten. Die Sphären der Sinne und des Denkens und über ihnen die Instanz, die sie zur Einheit des Bewußtseins bringt, sind Schalen. Diese Instanz ist es, die immer «Ich» macht zu allem was uns durchläuft, sie ist der «Ich-Laut», der als Grundton in aller Lebensmelodie mitschwingt, durch ihn wird das Chaos der Töne in uns erst unsere Melodie. Diese Instanz bildet alles uns Gegebene zur Schale unseres Bewußtseins. Darunter liegt die Schale des Unbewußten, der angeerbte und immer nachwachsende Schatz von Keimen und Be-reitschaf ten, aus denen das Ich sich immer neu vollstreckt. Un-gleich unserer Psychotherapie, die Heilung der Person im Ausgleich zwischen den Reichen des Ich und des Unbewußten sucht, greift dieser Yoga unter beide Sphären und hebt sie ab. Es spaltet sie als individuale Schalen vom überindividualen Kerne, dem Leben schlechthin in uns; er lehrt erfahren: das Preisgegebensein dieser Schalen in unfreiwilligem Teilhaben an der Welt sei ein äußerer Prozeß, der unseres Wesens Kern nicht anrührt. Das volle Opfer der Person schenkt uns ein anonymes souveränes Selbst. Die Schalen dieses Kerns, die Individuation und ihre Keime, faktisch abzutragen, wie der Jaina-Yoga lehrte, ist unmöglich, aber sie lassen sich als das schlechthin Andere in uns, das unser Wesen nicht berührt, abspalten; es läßt sich erfahren, daß zwischen diesen Schalen und unserem Kern ein Spalt klafft, über den kein unfreiwilliges Teilhaben eine Brücke schlägt.
Mit allem, was wir als ein Bestimmtes an uns fassen können, gehen wir uns nichts an. Was wir erleben, ob Leben oder Tod, rührt so wenig an unseren Kern, wie das Göttliche vom Spiele dieser Welt, die es aus sich entfaltet, von allem Lebensjubel und -jammer in ihr, betroffen wird. Wie das Göttliche — unendliches Leben — über der Welt west und die Welt — ihr innewesend — als seine Entfaltung spielen lässt, ohne Plan, ohne Ende: Vollzug ohne Be¬zug, — so lassen wir uns in unseren Schalen geschehen und schauen uns selber von innen zu: der da tut und leidet, ist nicht wir. Wir eignen ihn uns nicht zu. Wir spielen unsere Rolle, wo uns das Spiel hinstellt, und spielen sie ideal, weil wir ihr überlegen sind; sie verhext uns nicht mehr, daß wir an sie als unser wahres Wesen glauben, wir sind verlarvt in Individuationen, wie das gestaltlose Göttliche sich in die gestaltige Welt verlarvt. Diese gestaltige Welt aber ist nichts anderes als die Unzahl aller Individuationen in stetem Wirbel, und was in ihnen, unbetroffen, sich verlarvt, sind wir. So sind wir das Göttliche: Leben grenzenlos und betroffen von seinem Larvenspiel.
Solche Abspaltung der eigenen Person samt ihrer Beziehungs-fülle kann bei uns, wenn sie unfreiwillig zwangsläufig sich voll-zieht, Flucht in die Krankheit, Ausweg in Wahnsinn sein, wo kein sinnvoller Weg aus unlöslichem Wirrsal einer Lebenssituation greifbar ist; aber der in Indien diese Spaltung lehrt, ist Krischna, ein Heros geschichtlicher Sage, gefeiertes Haupt eines mächtigen Clans, der suggestive Einsager seiner Freunde im großen Kampfe epischer Ritterzeit; Freund und Feind unheimlich überlegen, hilft er den Freunden zum blutigsten Siege. Ein Wahnwitziger als Schlachtenlenker, — so ließe sich seine geheimnisvoll unmensch-liche Gestalt aus unserer Ebene von fern her mißverstehen; aber wenn in irgendeinem, erkennt Indien sich selbst in Krischna wieder und hat ihn zum großen Volksgott gemacht: in ihm als Heiland hat das Göttliche sich inkarniert, sein Wort, die Bhagavadgita, ist Offenbarung. Und Gandhi, der suggestive Einsager und mächtige Führer im großen Kampfe Indiens um die Unabhängigkeit, hat, ohne es zu wollen, im Glauben vieler die Aura auf sich gesammelt, in seiner Gestalt sei Krischna über die Zeiten hin wiedergekehrt. Die Spaltung, die Person und Schicksal, Leistung und Welt zum Spiel herabsetzt, das uns nicht betrifft, indes es unsere Schalen in unfreiwilligem Teilhaben durchspielt, gilt Indien als «Ende aller Weisheit» (Vedanta), und Yoga ist der Weg zu ihr als höchstem Ziel.
«Keiner tötet und keiner wird getötet» — was immer uns durchläuft, das sind alles nur «Berührungen der Materie», die uns nicht antasten. Denn wir spielen unsere Rolle ohne einen Blick darauf, was sie an Lust und Leid einbringt; die vollkommene Distanz zu allen Sphären der Person: das ist Yoga. Das Leben ist ein Zeremoniell, aller Gehalt der Situation, der andere schreckt oder reizt, daß sie ihr Ich vor ihm bewahren oder an ihm mehren möchten, ist uns rein figürlich. Die Richtschnur unseres Handelns ist eine Etikette: wo uns das Schicksal hinstellt, vollziehen wir, was uns in diesem Stande als ein natürlicher Kreis von Pflichten aufgegeben ist. Das Spiel der Welt hat seine Tradition in Regeln, und ein Teil dieser Tradition ist die Moral; an ihr zu wandeln und zu deuten, hieße unfreiwillig teilnehmen und eingreifend sich verflechten in das Spiel der Welt. Wir aber hängen an keinem Gehalt; der Bezug auf die Güter des Lebens, und auf das Leben selbst als Gut, ist aufgeopfert, — das ist unser Yoga. Unsere vollkommene Aktivität ist ein grandioser Leerlauf, und sie kann vollkommen sein gegenüber den Forderungen, die unser Schicksal an uns stellt, weil sie leer läuft. Keine Regung, keine Hemmung unsererseits, kein un-freiwilliges Teilhaben an ihr macht ihre ideale Linie zittern. Was um uns und mit uns geschieht, ist rein figürlich; aber da Geschehen oder «Tun» unausweichlich ist, solange Individuation uns umgibt, vollziehen wir «das uns aufgegebene Tun».
So warfen junge Leute, die ihr Schicksal auf den Platz stellte, «Jung-Indien» im Kampfe um die Unabhängigkeit zu spielen, Bomben gegen Polizeistationen. Um mit solchen Attentaten zu vollstrecken, was ihnen an ihrem Platze aufgegeben war: die «Mutter Indien», die greifbare heilige Erscheinung der göttlichen Weltmutter, vom unreinen Griff der Fremdmacht zu befreien. Wenn sie dann — schon hinreichend verdächtig — mit der Bhagavadgitâ in der Tasche aufgegriffen wurden, genügte das zur Anerkenntnis ihrer Schuld. Sie wurden aufgehängt. Für figürliche Attentate, die das Schicksal durch den Platz, an den es sie gestellt hatte, von ihnen forderte, gingen sie gelassen in den figürlichen Tod.
Eine Mythe des Hinduismus erzählt, wie die Welt immer neu entsteht, nachdem der Gott in ihrem Spiel von Blüte zu Verfall die entfaltete wieder in sich gesogen hat. Dann ist wieder alle Gestalt der Welt zu den Urwassern der Lebensflut zerlöst, daraus sie sich geballt hatte; die Welt, der Leib des Gottes, liegt wieder da als ein einziges mächtiges Meer, und auf sich selbst, dem Meer, das einer Riesenschlange gleicht, liegt Vischnu, der Allgott, als ein schlum-mernder Riese.
Die Welt der Gestalten, die er entfaltend aus sich trieb, ist wie-der in ihn eingegangen, in seinen Leib, die Flut. Bald aber regt sich wieder im Schlummernden seine unendliche Kraft. Spielend treibt sie aus dem Kelch seines Nabels, wie aus Wassers Tiefen, eine Lotosblume hervor. Ihr Kelch erschließt sich, auf ihr thront Brahma, die weltentfaltende, ordnende Kraft des Göttlichen. Er ist «sattva» : Ideales Sein, kristallene Klarheit, Meeresstille des Gemüts. Er schickt sich an, aus magischer Helle reiner Kontemplation eine neue vollkommene Welt hervorzutreiben, an Stelle der vergangenen alten, die im Laufe ihres Lebens über vier Weltalter hin immer dämonischer und dunkler und schließlich heillos trüb und verworren ward, reif zum Einschmelzen. Aber er wird gestört: Aus dem Schmutze der beiden Ohren Vischnus erheben sich zwei furchtbare Dämonen und drohen ihm den Tod. Sie prahlen: wir sind die beiden anderen Seiten Gottes, — des Göttlichen, das der Stoff und die Wirklichkeit der Welt ist —: «rajas», blendender Wirbelstaub der Leidenschaft, der die reine Sicht kristallener Klarheit verwölkt, und «tamas», Dunkel, Dumpfheit und brütende Trübe, bestialische Gemütlichkeit der Triebe. — «Es gibt nichts Höheres in der Welt als uns», so sprechen sie, «wir umhüllen das All. Heilige Seher vermögen wohl über uns hinweg zu schreiten, aber schwer überwinden die Menschen uns. Weltalter um Weltalter quälen wir die Welt, wo Glück und Freude ist, wo Glanz und Ruhm strahlen, wo alles ist, was Wesen wünschen mögen —: das alles sind wir!»
Brahmâ, ihr lauterer Widerpart, weiß, Gott schuf aus sich selbst auch Leidenschaftswirbel und dumpfes Dunkel. Zusammen mit ihm selbst, der lichten Klarheit, bilden die beiden die drei Aggregatzustände des Göttlichen, wenn es sich stofflich zur Gestalt der Welt differenziert. Gott selbst wird zwischen seinen drei Gewal¬ten schlichten. — Da reckt der schlafende Gott-Riese seinen Arm zu traumhafter Länge, rafft die beiden dämonischen Gestalten an sich und zermalmt sie. Aber indem er sie wieder in sich hinein nimmt, tröstet er sie, «ihr beide werdet auserlesen sein in werden der Zeiten Werden, — eure Stunde ist noch nicht da!»
Der ideale Anfang einer neuen Welt, den Brahmâs Lichtgestalt leitet, gibt den verwirrenden und trübenden Gewalten noch keinen Spielraum, aber die Mitte des Weltganges sieht sie groß und das Ende liegt ganz in ihrem Schatten. Ihr wachsendes Spiel bestimmt den Gang der Welt, — er ist ein unaufhaltsamer Niedergang. Am Ende haben die dämonischen Gewalten des Göttlichen das Spiel gewonnen und Brahmâs Ordnung in völliges Wirrsal verkehrt. Dann ist die Welt wieder zum Einschmelzen reif, zur Heimkehr in die gestaltlosen Urwasser, denen sie entblühte. Zum Anbeginn trägt Vischnu, dessen Leib die Welt ist, weiße Farbe: Brahmâs kristallene Helle; aber von Weltalter zu Weltalter verfärbt er sich dunkler: über das Rot der Leidenschaft (rajas) trübt sich sein Schein zu tiefem Schwarz. Dann liegt die Welt im Bann des «Dun¬kels» (tamas), der ihrer Auflösung voraufgeht.
Schelling spricht einmal in den «Weltaltern», diesem Torso einer Geschichte Gottes, über dem sein Genius verstummte, mit jener hochfahrenden Sehergeste, die ihn so gut kleidet, von dem «sich selbst zerreißenden Wahnsinn», der «auf dem Grunde und am Anfang aller Dinge» sei, — «jener sich selbst zerreißende Wahnsinn, noch jetzt das Innerste aller Dinge, und nur beherrscht und gleichsam zugut gesprochen durch das Licht eines höheren Verstandes», — er ist «die eigentliche Kraft der Natur und aller ihrer Hervorbringungen». Diesen «sich selbst zerreißenden Wahnsinn, das Innere aller Dinge und die eigentliche Kraft der Natur» sieht Indien in den beiden dämonischen Gewalten der feuerroten Leidenschaft und des tierischen Dunkels: Sie sind der Kraftrausch und die Trägheit der Welt. Brahma aber ist der Inbegriff eines höheren Lichtes, das sie bezwingt. Aber die beiden sind ewig wie er und nur von Mal zu Mal am Anfang einer neuen Welt von ihm «zugut gesprochen»; die Welt wie sie läuft, tränkt sich naturhaft immer mehr mit ihrer Dämonie und Trübe.
Das Abbild des sich selbst zerreißenden Wahnsinns sind in der Kunst der Völker der Fetisch und die Fratze; in ihnen schreit das dämonisch Unentrinnbare des Chaos in uns sich selber an und lebt seinen eigenen Schrecken. Es ist der Gang der griechischen Kultur aus archaischen Greueln zu ihrer Humanität, der diese sich selbst zerreißenden Kräfte des Chaos durch das Licht eines höheren Verstandes beherrscht und zugut gesprochen hat; in der klassischen Kunst verliert schließlich auch das Antlitz der Meduse seinen Schrecken, der versteint. Das göttlich Dämonische humanisiert sich. Die Christenheit vollstreckt, was hier geschah; mit dem freiwilligen Teilhaben des Göttlichen am dämonischen Chaos der Vergänglichkeit, mit Christi Eintritt in die Menschenwelt, ward der Bann des Dämonischen endgültig gebrochen. Es hat keinen Raum im Hause Gottes, es ist aus ihm verwiesen und zeigt seine Fratze, enttäuscht und vergrämt, grotesk und gebrochen, als Chimäre nur außen an Dächern und Türmen der Kathedralen, — Spott und Gelächter für die Heiligen des Herrn. Es ist aus der eigentlichen Welt der Gläubigen verdrängt; uneigentlich aber lebt es fort, und die Liebe, mit der seine Mißschaffenheit, sein obszönes Gebaren gebildet ward, deutet darauf, daß es, wenn auch offenbar verdrängt, im Geheimen noch mächtig ist.
Denn der klassische und der christliche Sieg über das Dämoni-sche wollen immer neu erkämpft sein von den ungeläuterten Genien der Völker, die diese beiden geerbt haben; das Ideal der Humanität und die christliche Gnade vollenden ihr Werk der Läuterung nie. Aber beide fordern als geschichtlich wirkende Größen den kollektiven Aufstieg der Welt zu einem bessern Stande, der ihren Ideen entspricht. Daß die Griechen einmal waren, was sie uns scheinen, daß Christus den gereinigten Weltstand schuf, — diese beiden Mythenideale des Abendlandes verpflichten es —: Nun darf es nicht mehr hinter sie zurück zum offenen Ja an die dämonischen Gewalten des eigenen Chaos, mit denen es sich selbst zu zerreißen droht. Was ihrer Forderung, undämonisch zu sein, widerspricht, wird nach Möglichkeit verdrängt. Denn der Glaube an ein fortschreitendes kollektives Vollkommenerwerden der Welt blieb bislang das Rückgrat des Abendlandes: religiös in der Idee der Ecclesia mili-tans und ihrer Weltmission, säkular im Fortschrittsglauben der Humanität, materiell im Rausche der weltverbindenden Technik.
In der westlichen Kunst hat das Dämonische kein Lebensrecht mehr in der Sphäre des kollektiven Ausdrucks, des repräsentativen Betriebes; es flüchtet in die Form von Kitsch und Schmutz, der Chimären von heute, an denen sich das Zeitkind erlabt, indem es sich dabei schämt oder selbst verlacht; — oder es lebt in der Kunst Vereinzelter als individuelle Explosion: als Wahrheit begehrt, aber abseits; als Ausdruck genial, aber nicht verpflichtend. Die offizielle Kunst Europas, die seine Ideologie repräsentiert, ist im Leerlauf klassischer und christlicher Formen verödet.
Für Indien aber ist der sich selbst zerreißende Wahnsinn nicht nur «am Anfang», sondern heut wie je (soweit es nicht verwest¬licht ist) «auf dem Grunde aller Dinge», ja er beherrscht die Welt, seit mit Krischnas Tode ihr letztes Zeitalter kam, in dem ihr Leib voll «Dunkel» ist. Darum werden uralte Fetischbilder Vischnus als Jagannäth, als «Herr der Welt» noch immer neu geschnitzt und thronen im Allerheiligsten des großen Wallfahrtstempels von Purl, — ein roher Stumpf mit grell gemalter Fratze, streng wie im archaischen Anfang indischer Dinge, ein puppenhaftes Greuel voll grauenhafter Lustigkeit: das dämonisch Groteske, urwüchsig Un-heimliche als Bild des Göttlichen (Abb. 3, S. 64). Hat Indien kollektiv als Kultur verdrängt, was uns zu verdrängen aufgegeben ward von unseren Idealen? — Augenscheinlich nicht. Die Kulte, die sein letztes Zeitalter beherrschen, die großartige und vielschichtige Religion der Tantra's, sind uralten vorarischen Gutes voll, das neu zur Herrschaft kommt; da gibt es neben den gepriesenen Wegen der Selbsterlösung auch Orgien des Dämonischen, tiefsinnig in Lust und Grauen, — von uns her gesehen: Teufelsmessen.
So geht in Indien das Kollektive, die Kultur, wie die ganze Welt den unabänderlichen Weg ins immer tiefere Dunkel. Aber der ein-zelne kann sich dem Gefälle entwinden. Er ist in allem, in Gestalt und Bewußtsein wie im Unbewußten, aus den drei Aggregatformen des göttlichen Weltstoffs gemischt, — wie alle Welt. Ihr allgemeines Mischungsverhältnis in jedem Weltalter zieht dem Individuellen der Person, die in der Zeit steht, seine Grenzen —: So hohe Heilige wie im Anfang der Welt, sind heute nicht möglich. Aber Yoga lehrt doch, den Gang der Welt, des Makrokosmos, rückwärts drehen im Mikrokosmos des eigenen Leibes. Durch Askese läßt sich die Vorherrschaft der verwölkenden und trübenden Gewalten in uns brechen, sie lassen sich abbauen, bis wir ganz reines «sattva» sind: ideales Sein, von tierischem Dunkel und menschlichen Leidenschaften frei.
Das ist der Stand, an dem wir unser Ledigsein von unfreiwilligem Teilhaben an Ich und Welt als das Geheimnis unseres innersten Wesens zu ergreifen vermögen, das uns zeitlos lang verborgen blieb. Nun sind wir wie die Welt am Anfang war, als Brahmä unangefochten sie entfaltete: die Dämonen sind zermalmt, Erkenntnishelle, ein wortloses Wissen um alles, wie es sich verhält, erfüllt uns; das Unbewußte, völlig gereinigt und von keiner Regung des Ichs gekreuzt, schwimmt im eigenen Lichte zeitloser Klarheit.
Das ist ein letztes sublimstes Teilhaben, jenseits des Ich, reglos und lauter, aber noch der reinsten Form alles Weltgehaltes unfreiwillig inne, — ein Schritt darüber hinaus, und wie in einem Film, der rückwärtsläuft, versinkt die reinste Ausgeburt des Lebens, Brahmä auf seiner Lotosblüte, wieder im leiblosen weltlosen Stande des schlummernden Gottes. Das völlig reine Unbewußte, — erste gestaltige Entfaltung des unentfalteten göttlichen Weltstoffs und selbst der Entfaltungsschoß des Ichs und seiner Welt, — sinkt zurück ins Unentfaltete; die Monade findet ihr «Ledigsein» (kaivalya) von allen Ausgeburten, die sie verschalen.
Aber auf dem Gange zu diesem Ziel vertritt dem Yogin alles noch ungeläutert Dämonische seiner Natur wieder und wieder den Weg. Überwand er die Außensphäre der Sinne, naht es sich ihm innen wie von oben immer wieder als überirdische Versuchung, als kosmische Gewalten, die ihn zu zerreißen drohen, weil er sich über sie erheben will, — oder sie wollen ihn verführen mit gleißender Lust, ihn rückwärtsreißen durch unfreiwilliges Teilhaben in Verlangen. Das weite Reich der schwarzen Magie, von Teufelei und Teufelinnen voll, vom Zauber der Allmacht funkelnd, erhebt sich als Ausbruch des scheinbar schon erloschenen Vulkans verdrängter, doch nicht weggelaugter Dämonie. Sein Aschenregen verwölkt mit Glut und Dunkel das Firmament der reinen Helle, die ätherische Sphäre, in die der Yogin schon sich aufzuheben wähnte. Hier liegt die Zone wahrer Krise, hier entscheidet sich's: Zum Ikarussturz in dämonische Inflation des Ego, das sich großer Magier fühlt, zum Titanensturz in die eigene Flammentiefe, — oder aber zum Durchschauen des eigenen Schwindels, daß alles dieses: Welten und Gewalten, nichts sind als Ausgeburten unserer eigenen Dämonie, entfesselte Spiele des Unbewußten, das den verschlingt, der es mißbraucht.
Diese Versuchung steigert sich bis zur letzten Stufe des Weges; wendet sich der Yogin von ihr ab, zur Sammlung im Abbau des Dämonischen, so tritt er ins «Ledigsein» und erfährt in sich das Abgespaltensein, das alles, was andere bedrängt, hinter sich läßt als schalenhaft. Der Buddha nennt diesen Stand des Losgelöstseins von unfrei-willigem Teilhaben an Ich, Welt und Unbewußtem nicht «Sein schlechthin», sondern «Erlöschen»; er faßt ihn vom Prozeß des Abbaus her als dessen Endvorgang. Der Buddha ist «erloschen» von uns aus, die wir noch «entflammt» sind. Mit dieser Bezeichnung vermeidet er die Gefahr ontologischen Aussagens, dieses Sein, das doch von allem Seienden verschieden ist, zu verdinglichen, die Gefahr aller Yogatheorie, in Ontologie oder Metaphysik zu entarten. «Erloschen» meint: was sich losgelöst hat, ist ungreifbar geworden für alles, was einmal an ihm teilhatte, — ungreifbar wie der Prozeß der Flamme, wenn sie verwehte; ungreifbar auch für alle Bestimmungen durch Worte und Begriffe, die alle aus der Sphäre des Greifbaren abgezogen sind.
Der Buddha ist die vollkommene Leerheit von allen Bestimmun¬gen, die an uns teilhabend uns in die Welt verflechten. Darum stellt die Kunst den Erloschenen unter dem Baume seiner Erleuchtung als das «Leere» dar. Ein leerer Thron steht unter dem Baume, um tobt vom Heere der Versuchungen. Da rennen die Mächte, die drohend und lockend seine Stille der Selbstversunkenheit in Erleuchtung stören wollen, gegen ein Leeres unter dem Baume an; die Gewalten des Dämonischen branden auf Kriegselefanten, Waffen regnend, von außen gegen ein Leeres; da lockt die Lust des Lebens aus Frauengestalt, — ihr Locken geht ins Leere. Der Buddha hat wie Achill Furcht vor dem Tode und Lust zum Leben überwunden; unüberbrückbar hat ein Spalt sich um ihn aufgetan, der nichts an ihn heranläßt; das Abgespaltene, die Wirklichkeit, an der wir anderen teilhaben, Person und Welt, ist für den Losgelösten Phantasma; mit seinem eigenen Leibe ist er sich ein Phantasma im Rahmen der großen Phantasmagorie der Welt (Abb. 4, S. 65).
Einen Schein im Schein der Welt, — so bildet die indische Kunst in einigen vollkommensten Gebilden die Gestalt des Buddha. Und stellt neben die stoffliche Dichte der unauflöslichen körperlichen Wirklichkeit in der Jainaplastik, mit Buddhabildern ein entkörper¬tes Wesen von blasenleichter Leere, einen baren Schimmer, — un-greifbar wie ein Klang (Abb. 5, S. 80). Hat Yoga der Welt von heute etwas zu sagen, — mit seinem Ziel der Spaltung? mit seiner Forderung, uns nur figürlich zu nehmen und die Welt für eine Phantasmagorie? und in uns und ihr jenseits beider zu treten?
Das kam ja alles schon vorzeiten einmal auf uns zu als Bot-schaft vom Osten, — damals als das Abendland an der großen Wende seiner Geschichte sich zu dem vollstreckte, was es geworden ist. Was anderes bedeuten die Entscheidungen jener christlichen Konzilien, die um die Natur des Gottessohnes stritten und den Doketismus verwarfen, als den Sieg über die indische Versuchung, Welt und Ich zum Phantasma zu degradieren? Da erwiesen die er¬erbten Kräfte des Westens ihre Stärke: der Realismus des Imperium Romanum, die Diesseitigkeit des Judentums und der griechi¬sche Logos, dem Mensch und Welt ein Wirkliches sind, dessen Erkennen Freiheit schenkt. Auf ihrem Grundriß baute sich das christliche Europa auf mit seinem Glauben an ein Fortschreiten in der Geschichte.
Als man um die Natur Christi stritt, wie Göttlich-Transzendentes und Menschlich-Irdisches in ihr zusammenkämen, rang man um die Natur des Wirklichen. Welche Seite ist die wahre am Gott-menschen? und wie durchdringen beide einander? — aller Streit um die Natur Gottes ist ein Ringen, die Natur des Wirklichen zu bestimmen; dem religiösen Denken ist Gott die oberste Wirklichkeit, aus der Bestimmung seiner Natur bestimmt sich der wirk-liche Charakter des Menschen und der Welt. Ihre Bestimmungen: was beide sind und werden sollen, fließen zwangsläufig aus der seinen.
Der Doketismus lehrte, Gott als Sohn ist nicht wahrhaft Mensch geworden; das ist unvereinbar mit seiner weltenthobenen transzendenten Größe. Nur scheinbar, nur figürlich nahm er menschliche Bedürftigkeit, Leiden und Tod auf sich. Seine Passion war ein Scheinspiel für die Welt, — wie der Buddha sich als Schein im Schein der Welt weiß. Jesu Leiden war ein Nicht-Leiden, sein Menschtum Maske seiner einzig göttlichen Natur.
Aber die Christenheit entschied gegen diesen illusionären Charakter der Heilstatsache, — entschied für ihre Wirklichkeit. Größtes Wunder, — ist sie doch real. Es ist das Wunder, das die Welt verwandelt hat, daß Gott im Sohne wahrhaft Mensch geworden ist. Zwei Kreaturen in einem Leibe, — fasse es, wer es kann; «wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch» in Einem, veredeus, vere homo, ist Christus dem Vater verwandt und vom Weibe geboren.
Der buddhistische Yoga führt zu dem Schluß, daß es, vom Standpunkt des Erleuchteten, nie einen Buddha, nie einen Buddhismus gegeben hat, — Schein im Scheine, wie alles Geschehen. — Der Doketismus, wenn er seine Konsequenzen zieht, muß ebendorthin kommen: Welt und Ich sind nur Masken des in ihm verlarvten Göttlichen; war die Heilstatsache sublimster Schein, kann auch ihre geschichtliche Auswirkung kein letzter Ernst eines Weltgeschehens sein.
Aber der Westen hielt sich an das Wunder der Verwirklichung des Unfaßbaren; das ewig Unverflochtene ist in freiwilligem Teil-haben leibhaft Kreatur geworden. Hier ist der Spalt, der das Ewige in seiner reinen unantastbaren Transzendenz vom Vergänglichen, Unzulänglichen in absoluter Spannung trennt, überbrückt durch das höchste Wunder: die Gnade. Damit ist diese Spannung in die Kreatur hineingenommen, sie wirkt als treibende Kraft in der Geschichte des Abendlandes. Jesus hat das Wunder vorgelebt: Die göttliche Natur im irdischen Leibe; seitdem gilt es, sein Wunder in der Welt zu verwirklichen, es gilt, die um und um vermischte, unzulängliche dem absoluten Ideal entgegenzuläutern.
Unter diesem Appell läuft die besondere Dynamik des Abendlandes: in geschichtlichem Gange den Weltstand nach oben zu verwandeln, — im Glauben an die Läuterungsfähigkeit der Welt unter der fortwirkenden Gnade von oben, deren höchste und leibhafte Inkarnation Christus war. Es geht um einen kollektiven Prozeß, — das Vertrauen des Menschen auf seine eigene Vernunft und sittliche Kraft ließen ihn weltlich werden als Programm des Fortschritts und der Erddurchdringung.
Daneben ist Indien spannungslose Statik in kreisenden Läufen. Naturhaft spielt die Welt zwischen Jugend und Altern; in diesem Spiele tauscht auch die menschliche Ordnung endlos «Paradieses-helle mit tiefer schauerlicher Nacht». Das ist das Spiel des Göttlichen mit sich selbst in ziellosem Selbstgenuß seiner gestaltigen Fülle entfalteten Scheins, da bleibt dem Kollektiven nur Beugung unter das Gesetz des Alls, dem Sternenwelten wie Arten der Tiere entquellen und erliegen, — kosmisch-tellurische Perspektive beherrscht den Gang der Menschheit. In allem Wandel bleibt sich alles gleich, die eine Kraft des Alls lebt sich in wechselnden Aggregaten. Das ewig Episodische kann nur figürlich sein. Da ist kein Raum, dem Menschen als Kollektiv Sinn und Ziel zu setzen; da ist nur Geschehen, keine Geschichte. Es gibt keine kollektive Aufgabe, nur kollektives Blühen und Verfaulen in unfreiwilligem Teilhaben am Rhythmus der Verwandlungen, am kosmisch-gemeinen Los. Nur der einzelne vermag wunderbar, in Selbsterkenntnis und -verwandlung durch Yoga jenseits des Gesetzes zu treten: er spaltet sich von der Sphäre, in der es spielt.
Es ist dem Menschen nirgends gesungen worden, sein Leben solle tragbar sein. Aber er macht sich's erträglich mit vielen Listen, und dieselben Dämonen, die es ihm verleiden, helfen ihm dazu. Und er erfand sich, wie er's trüge, wenn er im unfreiwilligen Teilhaben an den Dämonen leidet: er spaltet die ganze Sphäre, in der sie mächtig sind, das Außen und das Innen, von sich ab als bloße Schalen seines Wesens, oder er hofft beider Reiche durch Vernunft und guten Willen Herr zu werden, setzt das Untragbare in der Perspektive fortschreitender Entwicklung als ein mählich Ver¬schwindendes und spaltet, was nicht verschwinden will und sein bewußtes Dasein stört, verdrängend ins Unbewußte ab, — zwei mögliche Lösungen, die Indien und Europa jedes für sich aus sei¬nen Anlagen entwickelt hat.
Diese Notwendigkeit Indiens, bewußt abspalten zu müssen, anstatt die Spaltung verdrängenden Automatismen zu überlassen, entspricht augenscheinlich einer anderen Notlage des indischen Typus, als unsere europäische ist. Wo immer man die Lebensäußerungen und -reaktionen des indischen Menschen betrachtet, gewahrt man ein intensives Gefesselt- und Ausgeliefertsein an das Gegebene der Sinnensphäre; daher hat die indische Dichtung eine Drastik des Anschaulichen, ihre Farben eine Leuchtkraft und Glut ohnegleichen. Das Wirkliche ist von einer bannenden Plastik, die sich nicht vergeistigen läßt, die Intensität des Sinnenprozesses kann unmittelbar als schmerzhaft empfunden werden, als bren¬nend: «das Auge steht in Flammen, das Ohr steht in Flammen .. . Alles steht in Flammen ...» so hebt die erste Predigt des Buddha an, die «Flammenpredigt». Ihre Worte sprachen aus, was keiner Begründung bedurfte und, wie es unmittelbar empfunden war, von vielen empfunden werden sollte.
Gemessen am Inder, steht der Abendländer vag und zweideutig zur sinnlichen Gewalt der Umwelt, ungebannt von ihr, nur halb auf sie bezogen. Verfallensein an sie, was dort Natur ist, geht uns gegen die menschliche Würde. Die Unmittelbarkeit des Sinnlichen ist uns über mehr als zwei Jahrtausende hin durch den Logos ge-brochen, den «Geist», der die «wahre» Welt hinter dem Schein des sinnlich Gegebenen zu finden weiß, — ist gebrochen durch den Asketismus des Christentums, der sich in den Kirchen der Reformation eher verstärkt hat. Ob diesem Abendländer, der sinnlich eher verklammt, intellektuell distanziert zum eigenen Leibe und den Erfahrungsfeldern der Sinne steht, mit indischem Yoga gedient ist, der darauf zielt, den Menschen von der erstickenden, schmerzhaften Umklammerung durch die Sinnensphäre zu erlösen und dem indischen Amor vacui dient, — ist zweifelhaft.
Jene Ablehnung der indischen Formel für das Wirkliche ge-schah im Abendlande, als es sich mit der Christenheit einen neuen Weltstand schuf, — ist wieder eine neue Weltzeit unter einem neuen Sternbild im Anbruch? welche apokalyptischen Zeichen, die dafür noch ausstehen, dürften wir nicht von uns und unseren Dämonen erwarten ? Es gab eine Zeit, wo das antike Abendland sich selber uner-träglich wurde, da gebar ihm der Orient einen neuen Weltstand: die Christenheit. Tacitus, noch rein römisch-antikischgesonnen, nennt sie «exitiabilis superstitio» — «vernichterischen Irrwahn», und sagt, daß die Christen zu Neros Zeit weniger wegen der zweifelhaften Schuld am Brande Roms den qualvollen Massentod fanden, als «odio generis humani convicti» — «überführt des Hasses gegen das Menschengeschlecht». — Im Konservatorenpalast auf dem Kapitol steht eine Büste des Kaisers Commodus, vor seines-gleichen sollte man opfern als dem bildhaften Inbegriff geltender Weltwirklichkeit, diese Erscheinung sollte man als Hieroglyphe der Weltessenz und darum als göttlich anerkennen: — aufgeputzt mit Waffe und Trophäe des mythischen Gottsohnes und Heilbrin¬gers, mit der Keule des Herakles, die toten Baumelpranken des nemeïschen Löwen über die Alabasterbrust des Narziß gekreuzt, den Löwenrachen im Kontrastspiel aufgespreizt über das klassi-sche Philosophengesicht mit dem goldgepuderten Kräuselbart des sinnenden Weisen, Platons Weiser als Herrscher, Zeus' Haupt strahlend verjüngt durch die Künste des Friseurs, — eine parfümierte Vogelscheuche, die Eitelkeit in Person, drapiert aus dem Pompösesten an Maskenbestand des Mythos und Logos von einst, ein übertünchtes Grab (Abb. 6, S. 96).
Nein, diese Welt, und der sie so vertrat, kam für die Christen nicht mehr in Frage, von diesem Anblick wandten sie sich und schritten gelassen in die Löwengrube Daniels, in den feurigen Ofen der singenden Jünglinge und vermählten sich einer neuen Wirklichkeit, für die zu leiden, den Tod zu leiden, lustvoller war, als die Lust dieser geschminkten Leerheit zu teilen. Die Entschei-dung der Märtyrer, hierzu «nein» zu lächeln, leidend «nein» zu tun, gab unserer Welt eine Dimension mehr.
Im Hofe desselben Konservatorenpalastes steht der kolossale Kopf Constantins. In ungewissem Respekt vor der neuen Macht, die in eine neue Dimension des Wirklichen weisend unermeßlich wuchs, und von ihr — Zufall oder Erwählung? — emporgetragen, flimmert das Gesicht Constantins, des rätselhaft erkorenen Werk-zeugs der Weltstunde. Das zweideutigste Gesicht der Antike, vielleicht aller Zeiten, voll von der ungeheuren Zweideutigkeit des endgültigen und unhemmbaren Überganges eines Weltstandes in den anderen. Welche Kette von Zufällen, Ereignissen, Fügungen trug ihn empor zur umfassendsten Macht, die seine Welt zu vergeben hatte, die vor ihm die wenigsten Hände, wie die seinen, auf lange hatten halten und entscheidend schwingen mögen? waren es die irdischen Legionen oder wahrhaft himmlische Scharen, die den abendlichen Sieg an der Tiberbrücke erfochten? — besser nicht wissen wollen, sich tragen lassen vom völligen Gegen- und Durcheinander wallender Kräfte, deren Auftrieb und Versiegen den Einen rätselhaft erwählte, dem Ganzen obzuwalten (Abb. 7, S. 97). Ist der Osten noch einmal berufen, dem westlichen Menschen den Frieden zu geben, der höher ist als alle Vernunft, den er — von keiner Kirche mehr zu binden — erstrebt und nicht finden kann? Freilich, gemessen an dem Wirklichkeitssinn, der den Frieden der Menschen mit kollektivem Vernunftwillen erorganisieren will als materialen Zustand der Verhältnisse, mit blutiger Sozialreform, Neugliederung oder Konferenzen, — gemessen an diesem Wirklichkeits- und Wertgefühl von Moskau über Rom und Genf bis New York und rundherum, muß diese indische Lehre Gelächter und Wahnwitz erscheinen, harmloser Sparrn und privater Seelenflug, solange ihre Formel, daß die Wirklichkeit des Bewußtseins nur figürlich ist, bloße Rede bleibt. Aber wie würde sich der westliche Mensch, wieder einmal antik geworden, in ohnmächtiger Wut und mächtiger Verfolgung gegen eine «exitiabilis superstitio» erheben, — Nationale und Liberale, Sozialisten und Kapital, Kirchen und Gottesfeinde, alle zumal, — wenn Menschen aufständen, die lächelnd und für sie selber beiläufig, dafür sterben könnten, daß sie nur figürlich, mit einem belanglosen beiläufigen Teil ihrer selbst in die Vernichtung gehen. Indes die anderen in allgemeinster Wut solche scheinbaren Deserteure ihrer Welt faktisch aber vergeblich totschlagen, um ihnen zu beweisen, daß sie damit wirklich in ihrem wesentlichsten Teil getroffen würden. Solche Möglichkeiten, die uns unmöglich dünken, weil uns vor ihnen der Atem kurz wird, sind vielleicht eben darum die Füße jener, die uns hinaustragen wer¬den und schon vor der Tür stehen; das Wort Turennes (das Nietz¬sche sich zu eigen machte) «Carcasse, tu trembles? — tu tremblerais bien davantage, si tu savais où je te mène!» ist wohl die Losung des Menschen auf seinem Gange durch die Geschichte.
In der «Genealogie der Moral» sagt Nietzsche einmal von der moralischen Begriffswelt, «ihr Anfang ist, wie der Anfang alles Großen auf Erden, gründlich und lange mit Blut begossen worden» — es ist nach Nietzsche eine lange Erziehungsgeschichte, bis der archaische Mensch, das «notwendig vergeßliche Tier», einer ward, «der versprechen darf», weil er sich an sein gegebenes Wort unbe-dingt zu erinnern vermag. Es scheint um alle Errungenschaft eines neuen Standes des Menschen ähnlich zu stehen, die neue Dimension der Christenheit ist mit dem Blute der Märtyrer «von Anfang, gründlich und lange begossen worden». — Bedarf es einer ähnlichen Libation, um die Idee von der Figürlichkeit des greifbar Wirklichen dem Menschen neu einzuverleiben, um ihn aus dem antiken Weltstand von heut, den er täglich aus sich hervorbringt, ohne ihn ertragen oder lösen zu können, in einen neuen hinüberzuführen? Philosophieren ist nach Sokrates ein Sich-Kümmern um den Tod, — aus dem Schatten, den Vergänglichkeit über das Leben wirft, wächst auch der Yoga. Das ist der Sinn der Legende von jenem indischen Prinzen, dem Zeichendeuter bei seiner Geburt am Leibe ablasen, ihm sei bestimmt, ein weltbeherrschender König oder ein weltüberwindender Buddha zu werden. Sein Vater wollte alle Boten der Vergänglichkeit ihm fernhalten, daß er in der Welt bleibe und König sei, und nicht in die Einsamkeit ginge, um ein Yogin zu werden. Er schloß ihn ein in einen Park und stellte alle Freuden um ihn, daß sein Blick nicht die leidvollen Züge im Antlitz des Lebens träfe. Ein kühler Palast für des Sommers Glut, ein warmer für den Winter, ein dritter für die Regenzeit wandeln dem Prinzen den mahnenden Vergang der Jahreszeiten zum Spiele wechselnden Behagens, wohlbewachte Tore verriegeln sein Idyll mit Frauen und Blumen, Lautenspiel und Freuden gegen die fürchterliche Wirklichkeit des Lebens.
Aber der künftige Buddha langt über die Mauern seines Paradieses, als verlange ihn nach der nahrhaften Bitternis des Wirklichen; auf drei Ausfahrten ins Leben der Menschen begegnet er dem Greise, dem Siechen und dem Toten auf der Bahre, — dreimal spricht die Vergänglichkeit ihn an. Zum Vierten begegnet er einem Yogin als Sinnbild ihrer Überwindung. Und als er diese Erschei-nung und ihre Worte in sich bewegend heimkehrt, trifft ihn Ver-gänglichkeit mit ihrem feinsten, schärfsten Pfeile, ihm kommt die Botschaft entgegen: ein Sohn ist dir geboren! — Da fliegt ein halbdunkles Wort von seinen Lippen, «Rähulam jätam, bandhanam jätam» — «ein kleiner Râhu ist geboren, eine Fessel ist geboren». — Ein bitterer Witz, ein Wortspiel, das Klang und Sinn der Botschaft verwandelt. Râhu ist ein Dämon, der am Himmel dem Monde nachjagt und ihn zu verschlingen droht, wenn der Mond sich verfinstert; der Mond aber ist Sinnbild und Quell aller vegetativen Lebenskräfte, er ist das Gefäß des Göttertrankes «Todlos», vor allem aber ist «Mond» ein zärtliches Wort für «Sohn», als Inbegriff
der Augenfreude und Erquickung. Wie der Mond den Göttern den Trank ihrer Todlosigkeit schenkt, spendet der Anblick des Sohnes dem Vater die tröstende Gewißheit, nach dem Tode fortzuleben: mit seinen Ahnenopfern speist der Sohn die Toten des Geschlechts im Jenseits, daß sie nicht ins Bodenlose stürzen. Darum ist ein anderes Wort für Sohn «Freude» — nandana —, er ist die höchste Freude seines Vaters und des ganzen Geschlechts; mit Bangen erwartet, erlöst er seine lebenden und abgeschiedenen Vorväter von dem Alp, ohne fernere Totenopfer ins Nichts vergehen zu müssen. — «Ein kleiner Mond ist geboren, Freude ist geboren», das muß der Ruf gewesen sein, der ins Ohr des Prinzen schlug, aber er ver¬kehrte seine Zeichen spielend in den Gegensinn: nicht einer, der ihm Leben schenkte über den Tod hinaus, aber einer, der ihm das Leben nähme und die eigene Vergänglichkeit anzeige, schien ihm verkündigt; keiner, der ihm eine «Freude» (nandana) sei, aber eine Fessel (Bandhana), die ihn durch Liebe und Bedürftigkeit an Haus und Welt bände. Denn der Sohn ist der lieblichste und unerbittlichste Bote der Vergänglichkeit, er offenbart sie dem Vater, indem er als sein wiedergeborenes Ich erscheint, als sein zweites Selbst, berufen, ihn zu überleben und den Lebensraum von ihm zu erben. Auch ohne daß er bestimmt ist, den Vater zu erschlagen, ist Ödipus sinnbildlich Tod und Todbringer des Laios, wie das Korn, das aus der Ähre fällt um zu keimen, die noch ragende in ihrem Anspruch fortzuragen Lügen straft, indem es aus ihr fällt. Das ist der Sinn vom Mythos des Vaters Kronos, der seine Kinder fraß, sobald sie ans Licht traten; er begriff, daß ihr bloßes Dasein für ihn Tod meine, daß neben ihrem Leben sein Weiterleben nur eine Gnadenfrist besage. Ihr Ans-Licht-Treten sprach über ihn das Todesurteil der Vergänglichkeit und löschte ihn schon aus vor dem Medusenantlitz der Natur, die von ihm nehmen muß, was sie den Kindern geben wird.
So wird der künftige Buddha von allen Boten der Vergänglich-keit heimgesucht, von ihnen gemahnt beschreitet er den Weg zu der «Erleuchtung» in Yoga, die ihn über sie hinaustragen soll. Darum spricht er, als er die Frucht seiner Erleuchtung den Wesen aller Welten darreichen will, «Aufgetan ist denen des Todlosen Tor, die Ohren haben, — mögen sie Glauben schenken!» — Unter seinen frühsten Jüngern ragt ein Freundespaar hervor, der eine mit Wunderkräften begabt, der andere mit Erkenntnis, — als sie auszogen, den wahren Lehrer zu finden, gaben sie einander das Versprechen, «wer von uns beiden zuerst das Todlose erlangt, soll es dem anderen künden». Dieses Todlose kann nicht die Frucht des Zeitgebundenen sein. Alles Gewordene muß zerwerden, so auch die Frucht, die es her vorbringen kann; «alles Entstandene ist gebrechlich», alles Ge-stalthafte vergeht, — kein Opfer, keine Tat wirkt das Wunder der Wandlung, den Bann der Endlichkeit zu sprengen. Das bezeichnet die Grenze von Ritualwerk und Moral: sie sind endlich und vermögen nur Endliches zu wirken. Die Griechen hielten dem Antlitz der Vergänglichkeit den goldenen Schild des Ruhms entgegen, des «Ruhmes, der nie erlischt», den Achill um den Preis langen Lebens wählte: die Unsterblichkeit des großen Namens; die Christen überwanden den Schrecken des Todes durch den Glauben an einen Auferstandenen, der seine Gläubigen zu ewigem Leben erweckt, — der indische Mensch weiß sich ganz Kreatur, dem allgemeinsten Lose preisgegeben. Gebannt in unfreiwilliges Teilhaben am Lebensfiusse, der sich in ihm und rings um ihn zu Gestalten ballt und sie zerrinnen läßt ohne Ende, lebt er seine Vergänglichkeit, sie jagt ihn, — wie entrinnt er ihr? wo fände er das Todlose, das nicht geworden ist und nicht zerwird?
Dieses Unvergängliche erscheint in der Vergänglichkeit selbst, ihr Spiel in allem Gestaltentausch ist das ewig Währende. In und hinter aller Gestalt, die aufblüht und zerfällt, und ein reiner Vor-gang ist, ob Baum oder Leib, kein Bestand, ob kurzlebig oder lang-während, — in alledem west ein Bestehendes, das alles Greifbare an sich hervortreibt und, selbst ungreifbar, sich in ihm anzeigt. Gemessen an ihm ist alles Greifbare ein Schein, denn es verfliegt wie eine Wolke, war nicht da und wird nicht sein, es ist flüchtig wie eine Gebärde, unwiderbringlich wie ein Eindruck, schon zer-bröckelnd, sei es gleich wie für die Ewigkeit gebaut.
Die Begriffe «real» und «irreal» gewinnen fürs indische Denken Farbe und Gehalt an den Vorstellungen des Unvergänglichen und Vergänglichen. Weil alles Greifbare in der Welt vergänglich ist, wie ein Eindruck, eine Empfindung, ein Gefühl, ist es nur Schein (Maya), — die Welt in jedem Augenblick eine wechselnde Gebärde des Göttlichen, ihr Schicksalswandel über Äonen der spielende rasende Tanz seiner Kraft, die von sich selber trunken ist, — aber das todlos Unvergängliche kann in seinem Wesen nie Erscheinung werden. Was immer erscheint und greifbar wird, ist Schein des Unvergänglichen. So steckt das Todlose als sein inneres Jenseits in allem Vergänglichen drin, — aber wer erfaßt es? Yoga ist der Weg über die Schwelle dieses Jenseits in uns.
Seine Lehren geben die Technik dieses Weges, hinabzusteigen durch die greifbaren Schichten der Person, das Reich der Sinne und des Denkens, das ihren Gehalt zur Einheit des persönlichen Bewußtseins bringt, einwärts durch die Sphäre, die umfassender ist als das bewußte Ich, durch Schichten rein innerer Erfahrung und Vergegenwärtigung bis in eine Tiefe, die alles das verschlingt wie sie es trägt.
Yoga ringt um das Problem aller Philosophie: was bin ich ? wo fange ich an, wo ende ich und worin gründe ich? wo sind die Gren-zen des Ichs: ist die Person das übergreifende Ding, wie das Be-wußtsein gern wähnt, oder ist sie nur die helle Blüte an einem dunklen Baum, eine gestaltige Welle auf einem dunklen tieferen Wasser, ein Oberflächengebilde, herausgewölbt aus einem Ande-ren, das sich ihr entzieht, sie aber in ihrer Vergänglichkeit gewäh-ren läßt? Es gilt dieses Andere in uns zu erfassen, um die Ordnung der Abhängigkeit von ihm zu begreifen und zu meistern, — denn es geht darum, souverän zu werden im Hause unseres Leibes, unserer Welt. Wir sind es nicht, denn das hieße, nach Belieben aus unserer Ganzheit schöpfen, — wann können wir das? Wir haben uns nicht ganz, wir haben nur was jeweils uns bewußt wird, — ein Fließen¬des, Entgleitendes, — die Nacht verschluckt es, der Tag verstreut es. Wie wenig haben wir von dem was alles in uns liegt, als einen Besitz, über den wir willentlich verfügen können, — oder wie wenig davon hat uns? zuweilen langt es nach uns oben aus seiner Tiefe als ein Erleuchtetsein, als eine Fülle, — dann läßt es uns wieder gleichmütig wie ein Ungenügendes aus der Hand fallen.
Ob wir es beherrschen wollen oder ihm dienen, um von ihm beherrscht zu sein, von ihm erfüllt zu sein, wie der Soldat von der Idee, — wie wenig können wir es beschwören, es zwingen, daß es immer sich uns zuneigt, uns bereit ist, statt oft zu schlafen und viel taub zu sein. Yoga ist diese Kunst des Zwingens, er lehrt die Technik zum großen Abenteuer der Niederfahrt in unsere Ganzheit, in der das Ich «zerschmilzt, wie Salz im Wasser». Unsere Ganzheit ist an ihrem greifbaren Teil der Leib, mit allem, was er an Vorgängen und Instanzen in sich schließt. Wir leben in ihm wie in einem verwunschenen Schloß, das der beklemmenden Phantasie Kubins oder Kafkas entstammen könnte. Wir sind zwar die Herren, — aber was gehorcht uns? wir sitzen in der Kammer unseres Bewußtseins, durch ihre Fenster gewahren wir draußen die Welt, durch ihre Tür kommt das Innere des Schlosses an uns heran. Wir geben Befehle und werden bedient, aber oft von fremden Gesichtern und auf eine befremdende wirre Weise. Man bringt uns was wir nicht wünschen, und was wir verlangen, erhal-ten wir oft nicht, oder spät und ungelegen. Das Haus ist verwunschen, wir kennen uns nicht aus in seiner verschlungenen Weitläu¬figkeit. Oft scheint es, die dienenden Geister sind gegen uns verschworen, sind ausgeflogen oder feiern Feste für sich. Vor Aufständen sind wir nicht sicher. Es spukt, Geräusche dringen durch die Wand, — poltern Geister? sind Gäste nebenan, die wir nicht baten? ist's das Gesinde mit Flüstern und Streit? wie leben eigentlich diese Leute, und wie viele sind es?
Yoga wird eine Lampe genannt. Mit ihr in der Hand durch-schreitet der Yogin furchtlos die Gänge und Gewölbe seines Lei¬bes, der seine Welt ist. Er durchwandert diese rätselreiche Stadt mit den neun Toren, wie der Inder den Leib mit seinen neun Pfor¬ten nennt, — durchwandert sie wie Harun al Raschid das nächtliche Bagdad, dessen Geheimnisse sein Herrscher nicht kennt. Wie kann er das? Kraft seines Atems, denn der ist überall im Leibe rege.
Die indische Medizin hat von der Rolle des Atems im Haushalt des Leibes eine andere Vorstellung als wir, sie ist so umfassend wie einfach; Yoga bewahrt davon ein Bild mit besonderen Zügen, altertümlicher und phantasievoller — die Überlieferung seiner Ein¬geweihten hat es mit erstarrender Treue als ihr Geheimnis durch die Zeiten getragen. Die indische Physiologie ist ausgeprägt «pneumatisch». Drau-ßen in der Welt ist der Wind der Allesbeweger, er regt die Blätter, beugt die Saat, wirbelt den Staub und kräuselt die Welle. So ist er in der kleinen Welt des Leibes als Atem (prana) gleichfalls der Allesbeweger. Was wir als Hauch der Kehle gewahren, ist nur der «oberste Atem», dessen Ein und Aus das Leben verbürgt. Der gött-liche Lebenswind in uns hat viele Gestalten und Funktionen. Er schiebt die Nahrung durch den Leib, er treibt das Blut in den Adern, er facht das Bauchfeuer an, das die Speisen verkocht, er verteilt aus der Mitte den nährenden Saft und die Wärme an alle Glieder, er bewirkt alle Austausche im Leibe und seine Ausschei-dungen. Stirbt einer, an einer Wunde verblutend, so endet sein Leben nicht nur an Blutverlust, sondern weil zugleich die bewe-gende Lebenskraft des Atems dem Riß entfährt. Innere Atemkraft wirkt alle Bewegung, sie innerviert die Muskeln, löst aber auch alle unwillkürliche Bewegung aus : das Zucken der Lider, Schlucken und Gähnen, Niesen und Speien. Aufwärts strömend ins Haupt be¬wirkt ein Atem Denken und Sprechen. In allen Kanälen des Leibes fährt Atemwind einher, — und es sind 350 000; in einem eiför¬migen Knotengeflecht der Nabelhöhe entspringen 72 000, und 101 münden ins Herz, den Sitz des Lebensatems. Der größere Teil die¬ser Kanäle entspricht unseren Nerven, aber die Kraft in ihnen ist Wind. Gemessen am Allüberall des Windes im Leibe spielt die Lunge keine Rolle als sein besonderes Gefäß. Der Yoga kennt sie gar nicht. Nach seinem Leibesschema (Abb. 8, S. 112) laufen von beiden Nasenöffnungen zwei Kanäle durch den Leib auf beiden Seiten hinab bis zur unteren Öffnung der Wirbelsäule. Das Rückgrat durchzieht als Mittelachse innen die kleine Welt unseres Leibes, wie der mittlere Weltberg Sumeru, auf dessen Himmelsgipfel die Götter wohnen, aus den Tiefen der Unterwelt den indischen Makrokosmos als Achse durchragt.
Sonne und Mond ziehen ihre Kreisbahn um den Weltberg, so schlingen die beiden Hauptwege des Atems ihren Gang um das Rückgrat; sie sind die Bahnen für ein Sonnenhaftes und ein Mondhaftes in der kleinen Welt des Leibes. Mit jedem Atemzug, den der Yogin abwechselnd durch den rechten und den linken Nasenkanal tut, vollzieht sich innen ein Sonnen- und Mondumlauf, wechselt Tag mit Nacht. Indem der Yogin sich auf diesen Vorgang sam¬melt, hebt er den Zeitrhythmus, den der Gang der Gestirne außen ihm aufzwingt, auf. Für die kleine Welt seines Leibes wird er wie der Weltgeist, dem unsere Tage und Nächte nur wie Atemzüge sei¬nes Weltentages sind. Zeit, diese unerbittlichste Wirklichkeit mit ihrem Jetzt und Einst, mit dem unausweichlichen Bann des Gegenwärtigen und der Unwiederbringlichkeit des Vorüber, wird hier in einem anderen Sinn erfahren: als das Wesenlose reiner Anschau¬ung, als der bloß subjektive Rahmen des Erfahrens, der einzig für unser Alltagsbewußtsein Grenzen zieht.
Die beiden großen Atembahnen vereinen sich am unteren Ende des Rückgrats mit dem Kanal des Rückenmarks, der als zentrale Bahn des Lebensodems den Leib durchzieht. Alle drei durchströ¬men lebensspendend den Kontinent des Leibes wie die drei heiligen großen Flüsse Indiens Ganga, Yamunä und Sarasvati mit allen Rinnsalen, die in sie münden, den Körper Indiens durchrieseln. Im Zentrum zwischen den Brauen begegnen sie sich aufs neue. Den Strom des Atems in die Mittelbahn des Rückgrats zu lenken und dort mit seinem Spiel zu wirken, ist ein wesentliches Ziel des Yoga, wenn er als «Hathayoga» mit Zwang (hatha) arbeitet.
Freilich ist der Leib in seiner alltäglichen Verfassung dazu wenig geeignet. Das Netz seiner Kanäle ist verklebt, er ist schlaff und ungeschickt zu den Spannungen und Bewegungen, die er in sich üben soll. Es gilt, ihn rein und geschmeidig zu machen, in allen Teilen willig, den Atem aufzunehmen, zu stauen und zu leiten, wo-hin der Yogin will. Äußerlich vorbereitende Übungen sind Reini-gung von Mund, Nase und Rachen, von Luft- und Speiseröhre mit Luft- und Wasserbädern, mit Zeugstreifen und Pflanzenstengeln, die zeitweilig hinuntergeschlungen werden, Magen- und Darm-waschungen mit Luft und Wasser, aber das eigentliche Element, das reinigt, ist der Atem selbst. Rhythmisch eingesogen im Wech-sel von rechts und links, lange festgehalten und in bestimmtem Zeitmaß ausgestoßen, erhitzt er den Leib und verzehrt alle Schlak-ken in ihm. Asketische Lebensweise, insbesondere Diät, die schwere und scharfe Kost zugunsten maßvoller, milder und leichter Nahrung auschließt, befördert den notwendigen Umbau des Organismus. Von den drei Aggregatformen, die der lebendige Weltstoff in all seinen Gebilden aufweist, in den Nährstoffen außen wie im Physischen und Psychischen innen: lichte Klarheit, feurige Bewegtheit und dumpfe Schwere, — gilt es dem ersten der drei zur Vorherrschaft im Leibe zu verhelfen.
Eine besondere Gymnastik begleitet diese Atemübungen. Sie besteht nicht in Bewegungen, sondern im Vollzug teils ausgewoge-ner, teils schwierig verschlungener Körperhaltungen im Sitzen und Hocken, Sich-Strecken und Balancieren. Schiva, der große Yogin unter den Göttern, der Urlehrer des Yoga, soll vierundachtzigmal hunderttausend solcher Haltungen innehaben, soviele als es Arten lebender Wesen gibt, — von diesen sind einige dreißig im Besitz der Menschen. Ihr göttlicher Quell gibt ihnen die Würde, wie in der indischen Liebeslehre die vielen Haltungen der Zärtlichkeit und Hingabe — verwandt nach Komplikation und subtiler Unterscheidung — ihre Weihe davon haben, daß der überweltliche Schiva sie in endlosem Liebesspiel mit seiner Gattin, seiner weltentfaltenden, weltwirkenden Gotteskraft, offenbart hat.
Im Yoga dienen die Sitzhaltungen (âsana) dieser Stellungs-gymnastik, Muskeln und Glieder zu völliger Willfährigkeit in Spannung und Entspannung durchzukneten; sie machen schlank und geschmeidig, sollen jung erhalten und vielen Erkrankungen, beson¬ders der Atemwege und Eingeweide, vorbeugen. Sie sind Indiens hygienische Stellungsgymnastik, die, wenn nicht «Todlosigkeit», doch langes Leben und Gesundheit verleihen soll. Ein guter Teil von ihnen reicht mit seinen Anforderungen an Geschicklichkeit und Ausdauer ins Akrobatische, ja Schlangenmenschenhafte (Ab-bildung 9, S. 128).
Manche von ihnen ahmen (wie einige Haltungen der Liebeslehre) Tierhaltungen nach (Frosch, Heuschrecke, Schlange u. a.) und erfordern besondere Geschmeidigkeit; es mag aber auch eine altertümliche Form der Selbstverzauberung in diesen Haltungen liegen, da manche von ihnen Tieren angehören, die ursprünglich Erscheinungsformen von Göttern waren, dann zu ihren Wappenzeichen wurden und ihnen als Reittier dienen, so Stier und Pfau, Schiva und seinem Sohne, dem Kriegsgott eigen, und der Sonnenvogel Garuda, der Vischnu trägt und sein Gefährte im Kampfe ist. Wahrscheinlich ist das vor allem bei der Haltung des sitzenden Löwen mit heraushängender Zunge, die keinen gymnastischen Wert hat, vielmehr reine Mimik ist; sie ahmt eine mythische Er-scheinungsform Vischnus nach (wie vielleicht auch die Fisch- und Schildkrötenstellung) : Halb als Mann, halb als Löwe gestaltet überwältigte Vischnu in mythischem Kampfe den weltbeherrschen¬den Dämon Goldgewand, der die Götter ihrer Macht beraubt hatte; die sakrale Kunst stellt ihn dar, wie er mit heraushängender Zunge sitzend seine Pranken in den Leib des erschlagenen Feindes wühlt (Abb. 10, 11, S. 129).
Solche Übungen, durch Mimik angenommener Haltungen sich in ein Göttliches zu verzaubern, gehören zum altertümlichsten Erbe des Hathayoga. Ihnen verwandt sind Haltungen der Hände, die zum Yoga täglicher Andachtsübungen im tantrischen Kulte gehören. Die Tantra's lehren eine Unzahl von Figuren oder Prägun-gen (mudrä) für die Hände: bestimmte Fingerhaltungen symboli-sieren göttliche Kräfte, ihre «Prägungen» werden einzelnen Gliedern und Teilen des Leibes aufgedrückt (nyasa), indes gleichzeitig eine symbolische Silbe geflüstert oder innerlich vorgestellt wird, die das Wesen der betreffenden göttlichen Kraft im Reiche des Schalles ausdrückt und ihre Gegenwart im Bewußtsein des Andächtigen erweckt. Mit solchen «Prägungen», dem Leibe rings aufgelegt, beschwört der Gläubige alle Gottwesenheiten, die rings in seinen Gliedern und Organen als ihre Kräfte wirksam sind; mit ihrer Beschwörung verzaubert er sich aus seinem menschlichen Alltagsstand in ein Beieinander göttlicher Mächte und wird sich in seinem menschlichen Leibe seiner verborgen vielfältigen Gottnatur bewußt. Der Wert der gymnastisch-akrobatischen Übungen liegt außer in ihrer hygienischen und verzaubernden Wirkung darin, daß sie es dem Adepten ermöglichen, seinem Leibe höchste Geschicklich-keit und Ausdauer für eine Reihe klassischer Sitzhaltungen zu geben, die der eigentlichen Atemregelung und Sammlung auf innere Vorgänge dienen. Durch Bilder der Buddha's und anderer sit¬zender indischer Heiliger sind sie zu weltweiten Sinnbildern des Yoga geworden. Sie sollen den Leib fest zusammenfassen, daß er stabil «wie ein Topf» den Atem in sich aufzunehmen und festzu-halten vermag, sollen alle Ermüdungs- und Druckgefühle, die da-bei zu einer Änderung der Stellung Anlaß geben könnten, fern-halten, auf daß man sich ohne jede Ablenkung durch unfreiwillige Körpergefühle den Yogaübungen hingeben kann. Zu den Sitzhal-tungen kommen «Prägungen» des Leibes : Muskelkontraktionen und Verlagerungen, die den innen gespeicherten Atem durch Druck und Bewegung willkürlich leiten sollen. Ein Hauptziel ist, die Luft aus den beiden Hauptwegen und aus dem Unterleib in den Mittel¬kanal des Rückgrats zu pressen, in die Suschumnâ, die «Ader des vollkommnen Glücks». Die «Leuchte des Hathayoga» kennt zehn solcher Prägungen, alle «machen Alter und Tod zunichte» in dem doppelten Sinne, daß sie vollkommene Gesundheit und Langlebig¬keit verleihen, anderseits das Tor zum inneren Jenseits entriegeln und den Adepten in den Besitz des «Todlosen» setzen, das in ihm verborgen ist.
Dieses «Todlose» wird auf vielfache Art erfahren. Es kann z. B. als Göttertrank «Todlos» im Kosmos des Leibes geschmeckt werden. Zuhöchst im Haupte, wo im Weltleib der Jaina's die milchweiß todlose Region der ewig Erlösten liegt, schwebt im kleinen Weltleibe des Adepten der Mond, das Gefäß der Lebensmilch, des Göttertrankes. Der Mond trieft den Lebenssaft herab, der den Leib erhält; aber unten im Bauche brennt das Sonnenfeuer, todbringende, tropische Glut. Sie verschlingt ständig, was vom Monde herabströmt, darum ist der Leib alterndem Verdorren unterworfen. Der Yogin lernt seine Zunge verlängern, indem er an ihr reckt und mit kleinen Schnitten die Zungenwurzel mählich um ein gutes Stück vom Unterkiefer löst, bis er sie rücklings in die Rachenhöhle schlingen kann. Er legt sie an den Gaumen und schmeckt dort den Saft, der vom Lebensmonde herabträuft. Immerwährend den Gaumen «küssend» erfährt die Zunge einen Geschmack, der alle möglichen Geschmacksarten in sich vereint als ein Jenseits aller Unterschiede, in denen die Erscheinungswelt des Geschmacks spielt. In dieser schillernd übergegensätzlichen Empfindungsfülle oszillierend kostet die Zunge den Saft «Todlos». — Eine andere «Prägung», das Zusammenziehen der Kehle, soll verhindern, daß der Lebenssaft hinunterrinnt ins Bereich des Feuers, das ihn verzehrt.
Ein anderer Zweck der «Prägung», in der die Zunge nach hinten geschlungen wird, ist, den Luftkanal zu sperren und damit das Ausströmen des tief eingesogenen Atems zu verhindern. Ein Zu¬stand des Unbewußtseins tritt ein, in dem Welt und Ich schwinden: sie sind nicht mehr. Ein Zustand vergleichbar dem traumlosen Schlafe ist willentlich hergestellt: alles als Gestalt individuell Umrissene, alles als Vorgang vergänglich Verfließende löst sich auf, zerschmilzt in seinem Gegensatze: einem Ungreifbaren, Gestalt- und Vorganglosen. Alles Dasein ist Bewußtsein, — «und die Welt, die ungeheure, lebt von deinem Atemzug» (Hermann Hesse) : dieser Tatbestand wird hier im Abbau des Bewußtseins durch Atemdrosselung erfahren. Das ist der physiologische Sprung ins innere Jenseits, ins Sein hinter der Individuation, ins Sein schlechthin. Welt und Ich sind durch ihn abgebaut, der Mensch erfährt durch seinen gewollten Vollzug die Souveränität, sich über beide in das hinabschwingen zu können, was sie in jedem Traume innen, jedem Erwachen außen hervortreibt.
Das indische Denken über das Wesen des Wirklichen nimmt seinen Ausgang immer wieder aus dem Verwundern, wie Wach¬welt und Traumwelt gestaltig greifbar aus einem Tieferen, Dunk¬len, das gestaltlos ungreifbar ist, aufsteigen und im tiefen Schlafe wieder in ihm zergehen: in ihm ist das überindividuale, schicksallose, zeit- und raumenthobene göttliche Sein unmittelbar gegeben. Jedes tiefe Einschlafen ist ein kleiner Weltuntergang, jeder Erden¬tag des Wachseins ein kleiner Weltentag des Kosmos unseres Leibes. Er mißt nach indischer Rechnung 21 600 Atemzüge. So mißt die Periode der großen Welt draußen nach Tag und Jahren, die Atemzüge des großen Weltwesens sind. Als seine Atemzüge bilden sie den Großen Weltentag, an dessen Ende das Weltwesen immer wieder in den erquickenden Schlummer einer Weltnacht verfällt und sich selbst ungreifbar wird, bis es zu einem neuen Weltalter erwacht. Weltalter aber reihen sich aneinander als Lebenstage des Weltwesens, unterbrochen von diesen «mittleren Untergängen» der Weltnächte, bis in großen Perioden der Weltleib zur Auflösung reif geworden ist und sich in einem Großen Weltuntergange zerlöst, aus dem er über eine Große Nacht als ein völlig neuer wieder aufersteht. In diesen Rhythmus kleiner, mittlerer und großer Untergänge ist der Mensch mit der Welt seines kleinen Lei-bes hineingestellt als in ein oberflächenhaftes Scheinspiel in der Ebene des Geschehens oder des Bewußtseins, — eines menschlich kleinen oder kosmisch göttlichen Bewußtseins, — Hathayoga aber lehrt ihn, die Maya dieses Rhythmus beliebig zu durchstoßen, um nach Gefallen zu sein, was unter diesen Rhythmen und ihrem Ge-staltenspiel, unangefochten und jenseits von ihm, im Menschen wie im All verborgen west.
Der Atemlehre des Hathayoga liegt eine eigentümliche Vorstellung von Atem zugrunde: Der Atem der Kehle ist nicht eine gewisse Menge Luft, die Zug um Zug von innen gegen andere von außen eingetauscht wird, er ist vielmehr eine Art unsichtbares Organ, er schnellt wie eine Zunge aus Mund und Nase hervor und schlingt sich wie ein elastisches Band, das innen befestigt ist, wieder in den Leib zurück. Der Umfang, in dem er jeweils dem Leibe entschnellt, hängt vom Grade der Anstrengung und Arbeitsleistung des Men-schen ab. Das ist eine altertümlich simple Deutung des Befundes stärkerer Atmung bei physischer Kraftleistung und Zuständen der Erregung. Tief atmen schafft die Bereitschaft besonderer physischer und psychischer Kraft, vollkommene Ausatmung anderseits ist der Tod. Daraus ergibt sich der Schluß: wer es dahin brächte, den Atem innen nach Belieben festhalten zu können, der brauchte nicht zu sterben. Hier liegt die ganz altertümliche Denk- und Vor-stellungsgeschichte des Hathayoga, die seine Praktiken erst verständlich macht: wo Atem ist, ist Leben. Das Gleiche gilt vom Samen. Daher lehrt der Hathayoga seltsame, mißverständliche Übungen, beiläufig im Traditionsgut mitgeschleppt, die dem Men-schen die Souveränität auch über den unwillkürlichsten Vorgang erotischer Erregung schenken sollen. Wer gewillt ist, die Lebens-kraft, die Leben zeugt, unter keinen Umständen dank besonderer «Prägungen» und Lenkung des Atems herzugeben, — der brauchte nicht zu sterben. Eine abseitige Praktik, in der eine uralte Intuition großartig naiv aufblitzt; sie hat ihren Platz in der asketischen Yogalehre finden können, weil auch sie lehrt, wie der Mensch todlos werden könne, und weil der Inder allem Physischen und Physiologischen mit Ehrfurcht gegenübersteht als der Offenbarung gött¬licher Kräfte, deren Wesen keinen Wertgegensatz zwischen Fleisch und Geist zuläßt. Es geht darum, nicht zeugen zu müssen, das Geschlecht in sich und dem anderen nicht durch den Vorgang der Zeugung erkennen zu müssen, — das heißt also: zurückzuspringen vor die Szene unter dem Baume der Erkenntnis in den reinen Zustand des Paradieses und der Todlosigkeit. Denn die Frucht der Erkenntnis meint ja Zeugung, das Wort «erkennen» bedeutet im Alten Testament «zeugen», und so ist die Frucht vom Baume der Erkenntnis, die den paradiesischen Zustand endet, die Frucht des Todes, — das Gegenstück zur Frucht vom Baume des Lebens. In dieser merkwürdigen Yogaübung flammt der urwüchsig alte Wille auf, unsterblich zu sein, wie der erste Mensch im paradiesischen Stande, der Wille, zu erfahren, daß man dem Zwange der Natur, zu zeugen, auch wo er unwiderstehlich scheint, enthoben ist: Frei von dem Banne, unfreiwillig teilzuhaben am Lebensflusse, der durch die Kreaturen strömt, jenseits des Doppelgesichts entstehenden und vergehenden Lebens, an dem Zeugenmüssen und Sterben-müssen das helle und das dunkle Antlitz sind, die dasselbe meinen.
Der Hathayoga kennt viele Wege, dem todlos Seienden in und hinter allem vergehend sich Geschehenden innezuwerden, und öff¬net sich zu anderen Yogalehren, die auf ihm als Technik aufbauen. Daher nennt er sich die «Stiege», die aus physiologischer Übung zu höheren Verfahren führt, wie eine Stiege aus dem Erdgeschoß zum Oberstock läuft. Sammlung auf den Atem ist ein Weg, ins Jenseits innen zu gelangen. Die Sinne einwärtsziehend, wie die Schildkröte ihre Glieder unter dem Schilde versammelt, das Bewußtsein von allen Vorstellungen freihaltend, gibt sich der Yogin einer inneren Erfahrung hin: er lauscht dem Rhythmus seines Atems, und dieser Rhythmus singt und tönt. Zuerst ist es wie das Läuten feiner Schellen, die man an den Knöcheln trägt, daß sie den Takt klingeln, wenn man zu Ehren der Götter tanzt; dann tönt es wie eine Handglocke, die man zu Anfang der Andacht rührt, um alle un¬heiligen Kräfte aus dem Raume zu scheuchen; dann dröhnt es wie Vischnus Muschelhorn im Kampf mit den Dämonen, — und was anderes ist unser Lebensfunke innen, als das höchste Göttliche im Kampf gegen die Dämonen des Ichs: Lust, Zorn, Verblendung. Dann klingt es wie Lautespielen auf den Nervensträngen, den Kanälen des Lebensodems: Die weltwirkende Lebenskraft, uns innen, rührt an dieses Saitenspiel; dann ist es, als ob sie unsern Geist und unsern Lebensodem wie Zimbeln aneinanderschlüge, im Tanze das höchste jenseitige Wesen, ihren Gemahl, verehrend. Es schallt wie die Rohrflöte, mit deren Weise Krischna, der menschgewordene Allgott Vischnu, als Hirt auf Erden Hirtinnen, Herden und Vögel entzückte: das Rückgrat ist wie ein großer Baum, unter dem sie lagern, unsere Sinne sind die Frauen, die «Ader höchster Lust» (Suschumnä) ist die Flöte, durch die sein Atem in Wohllaut streicht, Geist und Atem sind die beiden Hände, die sie greifen, sechs lotosgleiche Zentren, die am Rückgrat übereinander aufgestockt liegen (Abb. 8, S. 112), haben je eine geringelte Schlange (kundali) in sich, — das ist ihre Lebenskraft, — es sind sechs Schlangenköniginnen, die zum beschwörenden Ton der Flöte tan-zen, und ein Schlangenkönig, ihr Gemahl, hebt seinen Kopf im höchsten Lotos, indes sein Ende im untersten ist, und tanzt mit ihnen. Dann tönt es wie eine Kriegspauke im Kampfe unseres Lebensfunkens gegen die Leidenschaften des Ich, es schallt wie die Handtrommel, die Schiva im Tanze rührt: Der überweltlich Jenseitige tanzt innen als Lenker unserer Leibeswelt; — es dröhnt wie Donner einer Wolke, die mitten am Horizonte, in der Mitte unserer Brauen steht, und Blitze eines höheren Lichtes schießen aus ihr, indes ihre Regengüsse den Brand löschen, mit dem wir an Welt und Individuation, Schicksal, Geburt und Tod inbrünstig zu hängen gewohnt waren.
Alle diese Töne gilt es zu hören und in ihrer Bedeutung zu fas-sen. Sie sind Alle Bestandteile, einzelne Klänge des großen Urlauts OM, mit dem das allem innere Jenseits sich im Reiche des Schalls offenbart. Ein Bewußtsein, das sich ganz auf diesen Ton fixieren kann, «zerschmilzt» in ihm und erreicht sein Jenseits : «wenn das Bewußtsein des Yogin sich ganz diesem Ton hingibt, vergißt es alles Außen und kommt samt dem Tone zur Ruhe. Wer sich diesem Yoga in Übung ergibt, überwindet die Sphäre des vielfältig quali¬tativ Entfalteten (die Sphäre des greifbar entfalteten Ich- und Weltleibes), er lässt alle Aktivität hinter sich und zerschmilzt im reinen Äther des qualitätfrei-unentfalteten Geistigen.» Er vergeht innerlich wie eine Wolke in der Ätherbläue des Firmaments.
Eine andere Übung ist, dem Gesange des Atems innen zu lauschen. Rhythmisch im Ein- und Ausströmen tönt er «ham — sa, ham — sa» oder im Aus und Ein «sa — 'ham, sa — 'ham». Mit «ham — sa» sagt er seinen Namen an, denn «hamsa» heißt der «Wildschwan» (es ist sprachlich unser «Ganser»), und der Lebensatem ist ein Wildschwan, der unablässig in uns auf und nieder fliegt, wenn man ihn nicht durch Stillstand des Atems zur Ruhe bringt. Er ist die greifbare Offenbarung unseres Lebensfunkens, an dem unsere gegenwärtige Individuation wie alle früheren hängt; — aber sein Laut sagt zugleich sein Geheimnis : «sa 'ham, sa 'ham», denn «'ham» oder «aham» bedeutet «ich» und «sa» ist «er», — «ich bin er» : Ich, der Diesseitige, bin Er, der Jenseitige; Ich, die Individuation, bin das Überindividuale, das sich zu ihrem Schein verlarvt; Ich, das Kreatürliche, bin in Wahrheit das todlos Göttliche. Von Sonnenauf- bis -untergang atmet der Mensch 21 600mal, so oft bewegt sich der Schwan durch alle Lotoszentren im Käfig des Leibes; als Lebensprinzip wohnt er im achtblättrigen Herzlotos, und je nach dem Lotosbiatt, auf dem er gerade weilt, bestimmt sich die Richtung unseres Empfindens als Lust oder Zorn, Ermattung, Hunger und anderes. Weilt er aber in der Mitte des Lotos, dann verlangt es uns über die Welt und alles, was uns in ihr mit Neigung oder Widerstreben hierhin und dorthin wendet, hinaus. Sein Ton «hamsa» «sa—ham» ist der «ungesprochene Flüsterspruch» (ajapa—mantra), der ohne unser Zutun ständig an der Schwelle unseres inneren Jenseits erklingt; ihn zum Schweigen zu bringen und in seinem Schweigen zu zerschmelzen, heißt dem brahman innewerden, unserem überindividualen todlos göttlichen Wesen, das sich in uns zur individualen Lebenskraft (jiva) verlarvt. «Wer das Oberkönigtum (die Allmacht) im Yoga sich wünscht, der soll sich nur in Sammlung (samadhi) auf diesen Ton vereinfältigen, alles Denken fahren lassend, mit angespanntem Sinne, denn der Ton wirkt wie eine Schlinge oder Falle auf die Gazelle ,Gemüt' und wird auf der Jagd gebraucht nach der Gazelle ,Gemüt', sie zu erlegen.» Vom Ton des Atems wird das schlangengleich unstäte Bewußtsein hypnotisiert wie eine Schlange vom beschwörenden Flötenton, und wie es mit ihm zusammen schwingt, löst es sich mit ihm zusammen auf, «wie Feuer mit dem Holz, auf dem es brennt, sich selbst verzehrt hat, wenn es das Holz aufgezehrt hat». Dieses technische Prinzip liegt vielen Yogaübungen zu¬grunde: unser Gemüt ist den Eindrücken von außen, den Regungen von innen offen, in diesem Banne unfreiwilligen Teilhabens an innen und außen ist es «verstreut», nach vielen Seiten hin unwill¬kürlich hingegeben an Dinge und Stimmungen, die ihr Wesen ihm aufprägen. Aber Sammlung oder Vereinfaltung (samadhi) sam¬melt das Gemüt «in eine Spitze» und hält mit ihr etwas fest, das fixiert wird. Sie hält das Gemüt am Fixierten fest und bewahrt diese Fixierung beider ineinander so lange, bis das Gegenüber von Fixiertem und Fixierendem in eins verschmilzt. Das ist «Ineins-setzung» (samadhi) oder «Zerschmelzen» (laya).
Im Tantra-Yoga täglichen Kults kann dieser Vorgang sich an einem innerlich visualisierten Gottesbild vollziehen; der Einge-weihte wird in diesem Akt zur Gottheit, die er aus seiner eigenen ungreifbaren Substanz innen aufgebaut hat, sein andächtiges Ge-müt schmilzt in die Gottheit hinein und sie zerschmilzt in dem gestaltlos reinen Sein der inneren Tiefe, aus der ihre Gestalt sich aufgebaut hat. An Stelle solch einer Gottesgestalt steht hier der Ton des Atems, die Manifestation der Lebenskraft (jiva): Der Ton hat das Bewußtsein in sich aufgenommen und schwindet mit ihm zusammen ins Unbewußtsein hin: damit kehrt der jiva in seine wahre, verborgene Natur des brahman, des überindividualen tod-los Göttlichen heim. Ein Mythos erzählt, was der Schwan als der Atem des Allgottes singt, — es ist dasselbe Lied, das auch im Menschen erklingt. An jedem Weltabend nimmt der Gott die Welt, die er entfaltet hat, mit ihrer welkgewordenen Gestaltenfülle wieder in sich zurück, dann trägt er sie schlummernd innen in seinem Leibe; wie ein Traum der äußeren Welt in uns spielt, so spielt dann die Welt im Innern des Gottes weiter mit idealer Vollkommenheit. Und über ihrem Ablauf als Traum Gottes klingt das Lied des unvergänglichen Gottes, harft der Atem des Schlummernden: «viele Gestalten nehme ich an und schwimme im großen Weltmeer, wenn Mond und Sonne vergangen sind, langsam dahin» — das ist der Zustand der Weltnacht, in der die Welt wieder zu den Urwassern des Un-bewußtseins, dem gestaltlosen Leibe des Weltwesens zerschmolzen ist, — «ich bin der Herr und bin Schwan. Ich brachte die Welt aus mir hervor und weile im kreisenden Vergehen der Zeit.»
Auch unsere tieferen Träume kennen diesen Schwan als Sinn-bild, er ist wohl die höchste Form des Seelenvogels. Für Indien ist er der Ausdruck des metaphysisch-transzendenten Aspekts der Seele, einer letzten Größe, die tiefer liegt als alles Gestaltige in uns, tiefer noch als die gestaltenträchtige und zeichengebende Schicht des Unbewußten. Er bezeichnet den ichüberlegenen, weltüberhobenen Teil unseres Wesens, der bei unserem scheinbaren Verflochtensein in den bannenden Wirbel des Daseins unanrührbar, unverflochten bleibt. Über den Spiegel der Lebenswasser hin zieht der Schwan seinen Pfad, er tunkt den Hals in ihre Tiefe, aber er ist nicht an sie gebunden, denn er ist beschwingt. Er hebt sich aus der unteren Flut auf ins kristallene Himmelsmeer und rudert in ihm noch freier, sich gemäßer als in den schwereren Wassern. Er wandert wohin er will. Der heimatlose Wildschwan, der seine Bahn spurlos über Fernen des Raumes zieht, und hier einfällt auf einen See und dort in eine Bucht, ist Indien das Zeichen des fesselfreien tiefsten Prinzips in uns, das sich spielend hier und dort und immer wieder für den Aufenthalt eines Lebens an Verleibungen hergibt. Warum ergreift es immer wieder, Leda in der Begegnung mit dem Schwan zu sehen, als sei in diesem Bilde mehr gegeben, als im Abenteuer Europas mit dem Stier, — mehr als eine tiefe amouröse Stunde und die Grazie eines großen Gottes, der um die Träume eines jungen Weibes weiß? ist Leda nicht wie Psyche selbst: heimgesucht und hingegeben dem göttlich Tieferen in ihr, das nur bei ihr zu Gast ist, — ein Überindividuales, Unhaltbares, Unberührbares, das sie versehrt und auflöst? — In Indien ist der Schwan das Zeichen Brahmäs, sein Reittier und sein Sinnbild in der Reihe der Tiere. Der heimatlose Asket, der nirgend mehr auf Erden zu Haus, frei schweift und alles Gestaltige in sich in den ungreifbaren Äther¬raum des brahman aufzulösen trachtet, aus dem es sich wie Ge¬wölk verdichtet hat, heißt ein «Schwan» und «höchster Schwan» (hamsa, paramahamsa).
Immer tönt in uns der Atem, die Stimme des Lebensfunkens «ich bin Er», aber nur der Yogin hört sie und versteht sie. Im Mythos ringt einmal Krischna, der menschgewordene Allgott als Hir-tenknabe mit einem Schlangendämon; zum Entsetzen der Hirtenfrauen scheint er im Wasser vom Dämon überwältigt, von den Windungen der Schlange umstrickt und gelähmt, vor ihrem Gift-hauch ohnmächtig geworden. Da ruft ihm sein Halbbruder Räma, wie er ein menschgewordenes Stück Vischnu, vom Ufer her zu, «göttlicher Herr der Götter, was entfaltest du dieses menschliche Wesen an dir? Weißt du nicht um dein eigenes anderes Wesen: du bist der Nabel der Welt, Schaffer, Wegraffer und Hüter aller Welten, du bist alle Welt! Menschliches Wesen hast du gezeigt, Knabenspiele hast du gezeigt, darum bezwinge jetzt den Dämon!» So wird Krischna sich selbst in Erinnerung gebracht, ein Lächeln spaltet den Kelch seiner Lippen, klatschend schlägt er auf die Windungen, die ihn fesseln, spielend löst er seinen Leib aus ihnen, beugt das Haupt der Schlange unter seinen Fuß und hebt an, stampfend darauf zu tanzen, bis der Schlangendämon um Gnade bittet. Im Sinnbild der beiden gottmenschlichen Brüder, Stücke ein und desselben Göttlichen, in der Selbstverlorenheit des menschlichen Götterknaben an seine menschliche Rolle, an die Windungen der Schlange und ans Grab der Wasser, und in der Unangefochtenheit und Klarheit seines brüderlichen zweiten Ich stellt sich das Doppelgesicht unseres und allen Wesens dar: Dass wir Jiva und brahman in einem sind, kreaturgebannt und preisgegeben, zugleich aber todlos frei. Ein altes indisches Gleichnis spricht von zwei Vögeln, die an einem Baume sitzen: Der eine frisst die süße Beere, der andere schaut gelassen zu; — sie sind ein und derselbe Vogel unter zwei Aspekten, Yoga aber ist der Weg, ihre Einheit zu erfahren und die Weltverlorenheit des Vogels, den seine Natur zwingt die süße Beere zu naschen, als eine Haltung an uns zu begreifen, die uns nicht berührt. So sind auch die beiden Vögel des alten Symbols im Laufe seiner Geschichte zu einem verschmolzen: Jean Paul spricht einmal von dem «zweiköpfigen Adler der Fabel, der mit dem einen niedergebückten Kopfe verzehrt, indes er mit dem andern umherblickt und wacht».
Es gibt auch optische Wege, dem inneren Jenseits inne zu wer-den. Der Yogin sammelt sich auf ein Zentrum zwischen den Augen¬brauen, einen zweiblättrigen Lotos; hier erschaut er zunächst den reinen Atherweltraum des Herzens. Wie seine Sammlung sich vertieft, lösen fünf ätherische Räume vor seinem inneren Blick ein-ander ab: es sind in ihrem feinsten Aggregatzustande die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, aus denen ungreifbar fein und stofflich dicht alles in der Welt sich bildet. Der erste dieser Ätherräume, der irdische, ist wie ein dunkler Wald bei Nacht, der folgende des Wassers, in das die gestaltige Welt immer wieder zergeht, glüht wie Weltuntergangsfeuer; der nächste, feu-rige, schimmert in vielerlei Licht, der vierte luftige strahlt wie tausend Sonnen, und der letzte des ungreifbaren Äthers ist aller benennbaren Eigenschaften bar. In ihnen brechen lautere Wellen eines höheren Lichtes auf, wie reine Wogen des Milchmeers der Lebensessenz und des milchigen Trankes Todlos, sie schimmern wie Blitze, wie Glühwürmchen und selbstleuchtende Edelsteine in der Nacht. Unter Myriaden Strahlen geht die Sonne der Erkennt-nis auf, vor ihr weicht das innere Dunkel der Welt- und Ichbefan-genheit. Der Schwan, der da spricht «ich bin Er» und immer im Gegenüber von jiva und brahman lebt, gewinnt die Kraft, im Lichte dieser Sonne sich frei zu bewegen, er fliegt innen von Lotos zu Lotos, die drei großen Lebensströme des Leibes, zur Rechten und Linken und im Rückgrat, strömen frei und kreisen in sich. Alle Tätigkeit der Sinne hört auf, und das Denken (manas), das wie der Mond (candramas) ist, geht unter im Meer der Seligkeit. Ein liebendes Vogelpaar, das nach indischer Anschauung allnächtlich Trennung voneinander leiden muß und sich sehnt, am Morgen sich wiederzufinden, begegnet sich in diesem Sonnenaufgang, endlich wieder vereint: es ist das mittelbare Wissen um die Einheit von jiva und brahman, wie das Wort der Lehre es vermittelt, und das unmittelbare Wissen der Erfahrung, daß es wirklich so ist. Beide werden eins, ein Wissen um Alles, eine unbeschreibliche Erfahrung ist da, — alle Dunkelheit löst sich auf in Licht.
Jetzt ist der Yogin «selbst-sich-erleuchtendes Licht», seine Sonne der Erkenntnis ist das rein schauende Auge zu seiner ganzen Welt innen und außen. Ihr Licht, nicht zu beschreiben, ist den Weltzugewandten tiefstes Dunkel, es ist Erscheinung des brah¬man; in ihm verschwindet das Ich wie der Schein einer Lampe im hellen Tageslichte. Ein Zustand, in dem man wie reinster Himmelsäther ist, ungreifbar, farblos, gestaltlos, jenseits aller sagbaren Eigenschaft. Man ist wie im Tiefschlaf, jenseits von gestalterfüll¬ter Wach- und Traumwelt, in einem höchsten Glück, in Worte nicht zu fassen. Das ist höchste Vereinfaltung (samâdhi), mit der Hathayoga sich zum königlichen Yoga (Räjayoga) erhebt, zum Ziele des Vedanta, dem «vierten Zustand» des brahman, jenseits der drei alltäglichen: Wachsein, Traumschlaf, Tiefschlaf.
Vielgliedrig und vielsagend wie keine zweite unter den Yoga-übungen ist was sich das «Bewegen der Lebenskraft» (schakti-câlana) nennt. Hier findet die Technik der Atem-Regelung, seine Konzentration und Leitung ihre stufenreichste Aufgabe. Die im Leibe wie in einem Topfe aufgespeicherte motorische Lebenskraft des präna wird einem Gewaltakt dienstbar gemacht. Sie soll aus den beiden Kanälen, die von der Nasenwurzel her als Hauptwege des präna abwärts den Leib durchlaufen und sich am unteren Munde des Rückgrats begegnen, durch einen angespannten Druck, der alle Leibestore schließt und alle innen kreisende Windkraft vereinigt, in den Kanal des Rückgrats von unten hinaufgepreßt werden. Der Atem soll den Eingang zur innersten Ader des Rückgrats auftun und die Schlange der Lebenskraft wecken, die dort im tiefsten Lotoszentrum des Leibes — im Muladhâra, d. i. «Wurzel-Halt» — schlummert. Sein Druck kann sie erwecken, daß sie im Rückgrat aufwärts steigt, wie eine Quecksilbersäule im Thermo¬meter. Als vegetativ-animalische Urkraft trägt diese Schlange den Mikrokosmos unseres Leibes, er ruht mit dem Rückgrat als Achse auf ihr: so trägt die Weltschlange Schescha, das Sinnbild der kos¬mogonischen Urwasser in der Tiefe, den Makrokosmos auf ihrem Haupte, indem sie seine Achse stützt, den Weltberg, der die Welt vertikal durchzieht, aus dem tiefsten Grunde der Unterwelt unsere Erdsphäre zentral durchragend bis in die Götterhimmel an den Rand der Überwelt. Die Schlange verkörpert die welt- und leibentfaltende Lebenskraft, sie ist Gestalt der weltwirkenden Gotteskraft (schakti). Zu dreieinhalb Ringen (kundala) geschlungen hält die «Geringelte» — Kundalini — das männliche Symbol der zeu-genden Gotteskraft, das Lingam, als ihr weiblicher Aspekt im Mulâdhära umschlungen. Sie schläft, — die vegetativ-animalische Lebenskraft ist tiefes Sich-Selbst-Innesein, das sich in keiner Wachheit des Bewußtseins gegenständlich wird. Aber sie soll erwachen und aufsteigen zu einem höchsten Lotoszentrum im Zenith der Hirnschale den Weg rückwärts gehen, den sie abwärts stieg, als sie den Leib aus erstem embryonalem Zellendasein entfaltete. Die indische Embryologie lehrt, daß der befruchtete Keim im Mutterschoße sich vom Kopfe her entfalte: im Laufe des ersten Monats bildet sich als erstes der Kopf aus, im zweiten Monat Schultern und Arme, im dritten tiefer unten die Magengegend, dann im vierten Rücken und Gesäß, im fünften schließlich die Füße. So steigt die Lebenskraft, den Leib aufwölbend und gestaltend, aus dem Gegenpole des Gestaltlosen niederwärts und nimmt ihren Sitz am Grunde der ausgebildeten Gestalt, in der Zone der Entleerung und des Geschlechts. Der Lotos Mulâdhära, in dem sie schläft, trägt das Zeichen der Erde, und die Zone der Entleerung birgt das Erdhafte: den Kot. Als animalische Lebenskraft aber sitzt die Schlange an der Zone des Geschlechts.
Bei uns lehrt die Embryologie: wenn das befruchtete Ei sich furcht, differenziert es sich zunächst in diese unterste Zone der Entleerung und in die höchste des Kopfes, dies ist die erste Polarität embryonaler Entfaltung, die sich aus dem undifferenzierten Beisammensein befruchtender Vereinigung erhebt. Der Weg, den der Yogin der Kundalini aufzwingt, daß die Entfaltende aus ihrem vegetativen Schlummer am Grunde des Leibes aufsteige und in ihren Gegenpol des Unentfalteten zuhöchst eingehe, führt also gewissermaßen zurück in jene embryonale Präexistenz, in das früheste Stadium der Kosmogonie unseres Leibes, ehe unser Mikrokosmos die innige Verschmolzenheit polarer Zonen auseinandertrieb. Der Druck versammelter Atemkräfte weckt die Schlange und zwingt sie aufwärts im innersten Kanal der Wirbelsäule. Fünf
Lotosblumen mit wechselnder Blattzahl sind übereinander an ihrem Wege aufgestockt, sie durchquert alle und erreicht die höchste, die tausendblättrig die Hirnschale umkleidet. Die Stationen dieses Weges, diese sechs Lotoszentren, stellen von oben nach unten gelesen den Gang der Weltentstehung dar. Er schreitet über fünf Stufen: am Anfang west der göttlich lebendige Weltstoff als unentfaltet und gestaltlos. Wenn er, zeitlos pendelnd zwischen Ein¬schmelzung und Entfaltung der Welt, aus diesem Zwischenzustande des In-sich-selbst-Verschmolzenseins zu spielender Selbst-entfaltung und Verstofflichung anhebt, ist sein erster Schritt die Selbstverwandlung in das stofflich zarte Element des Raums. Ungreifbar fein, ätherisch ist es der Träger des Schalls. Aus ihm ver-dichtet sich ein Teil zu Luft, die greifbar ist in der Berührung des Windes; ein Teil der Luft ballt sich zu Feuer, aus dem sichtbaren Feuer verdichtet sich Wasser, der Träger des Geschmacks; aus den greifbaren Wassern aber steigt das kompakte Element Erde, das zu den Sinneseigenschaften aller früheren den Geruch besitzt. Aus der Mischung dieser aller entsteht die sinnlich wahrnehmbare Gestaltenwelt.
Die fünf unteren Lotosblumen des Mikrokosmos sind Zentren der fünf Elemente und ihre Aufreihung am Wege vom Hals zum Schoß entspricht den Entfaltungsschritten des lebendigen Weltstoffs in seiner Selbstverwandlung zu wachsender Dichte, Schwere und Differenziertheit. Zwischen der erdhaften Urschlange, die im Erdlotos unten schlummert, und dem Hirnschalenlotos oben spannt sich der Leib als ein ständig werdender Kosmos. Der Heimgang der Kundalini aufwärts rafft diese entfaltete Welt in den Schoß des Unentfalteten zurück. Dann löst sich die vielfache stoffliche Realität in unstoffliche Potentialität auf, das Gestalthafte, das sich stofflich differenzierte, kehrt heim zum Stande undifferenzierter reiner Kraft.
Welt und Ich sind nicht ein schlichter Bestand, aber sie ge-schehen sich in jedem Augenblick; diesen ewigen Vorgang, ständiges Verwandlungsspiel, packt der Yogin wo es ihm einzig zur Hand ist, in der Kosmogonie seines Mikrokosmos, in sich selbst, — und führt die Kraft, die ihn zur Leiblichkeit entfaltete, heim in ihren leiblosen Ursprung. Der Mikrokosmos fließt zurück in seinen Quell, — mit ihm die Welt, die ihn umgab, denn sie ist nur an ihm gegeben: das Sichtbare als Spiegelung im Teich des Auges, das Meer des Hörbaren als Rauschen in der Muschel unsres Ohrs.
Die Kosmogonie der sichtbaren tastbaren Welt, wie Indien sie schaut, ist ein zunehmender Verdichtungsprozeß: immer ballt sich ein dichteres Element aus einem fluideren; dieser Vorgang wird den Wandlungen der Atmosphäre verglichen: wie ihr Unsichtbares, ihr Nichtsein fürs Auge, sich zu Dunst verdichtet, Dunst zu Nebelstreifen, der Streifen Wolke wird und Wolken Niederschlag gebä¬ren, aus dessen Saft handhafte Gestalt sich aufbaut, so quillt die gestaltige Welt immer greifbarer aus dem Schoß des Unentfalteten. Auf dieses Spiel passen von fern Goethes transparente Verse, mit denen er Howards Wolkenlehre feierte, jenes Hinab und Hinauf, Gestaltung und Entstaltung: nachdem sich «niederwärts, durch Erdgewalt herabgezogen, was sich hoch geballt», schwimmt die geballte Haufenwolke wieder zum Stratus auseinander, die Streifenwolke flockt zum Zirrus auf, die Flocke löst sich wieder in die Atmosphäre:
«so fließt zuletzt, was unten leicht entstand, dem Vater oben still in Schoß und Hand.» Das Lotosschema des menschlichen Leibes ist das kosmogonisch gestufte Abbild des Weltgebäudes. Der Leib bildet die Welt des Entfalteten, die Hirnschale aber birgt den Gegenpol des Unentfal-teten, der tausendblättrige Lotos befindet sich, so heißt es, «außer-halb des brahman-Ei's», also außerhalb des entfalteten Kosmos, d. i. des Leibes. Zu ihm gelangt nur, wer über alle Zonen sich dif-ferenzierender Gestaltigkeit hinauszusteigen vermag in die Ruhe gestaltlos undifferenzierten Seins. Diese Vorstellung ist in Indien uralt. Die Veden kennen es freilich nicht, aber die Vorstellung der Jaina's vom Weltleib als Leib der Weltfrau meint dasselbe. Dort ist das Weltgebäude ein menschlicher Leib, dem Yogin ist sein Körper ein Kosmos und ist gestaltet wie jener Leib der Weltfrau. Sie trägt in ihrer Leibesmitte, in Höhe ihres Schoßes, die kreisförmige Erdscheibe, eben dort liegt im Yogaschema der Erdlotos Mulâdhâra. Auch wird die Erdscheibe selbst in der mythischen Kosmographie der Inder als Lotosblume angesehen — inmitten ihres Blütenbodens liegt der indische Kontinent — und sie wird die «Göttin Lotos» genannt. Die Erde aber ist die Heimat der Schlangen, der Herrscher chthonischer Lebenskraft, wie der Him-mel der Ursprung ihres Feindes, des göttlichen Sonnenvogels ist, der mit seinen Strahlen den Lebenssaft der Erde, die Schlangen der Flüsse und Bäche verzehrt. Darum lebt die Schlange Kundalini im Erdlotos. Oberhalb der Erdfläche in Rumpf und Hals des Weltleibes erschaut der Jaina immer leichtere, reinere Götterwelten; so liegen im Schema des Kundalini-Yoga die göttlichen Elemente als Sphären in den vier höheren Lotoszentren immer leichter und lichter übereinander, Feuer überm Wasser und Luft über beiden, zuhöchst aber der Äther. Der Jaina-Yogin, der sich selbst erlöst, steigt schwerelos durch alle diese Schichten der Schwere und Trübe aufwärts zur Stätte der Erlösten am Innengewölbe der Hirnschale des kosmischen Wesens, — er nimmt also den Weg der Kundalini aus der Zone des Schoßes in den Zenith, wo der Kundalini-Yogin den tausendblättrigen Lotos weiß.
Die göttliche Urmutter aller Welt, die nach der Lehre der Jaina's alle Wesen und Sphären als ihr Leben in ihrem Leibe trägt, ist ein Schwestersymbol der Kundalini selbst. Sie ist eine Weltmut¬ter, die ewig schwanger geht mit der Welt; aber wie ein reifes Kind, vollentfaltet webt der Kosmos in ihr und füllt sie ganz, sie trägt ihn, indem sie sich trägt, — aber auch Kundalini, dem Kos¬mos des Leibes inne, trägt ihn mit allen seinen Sphären, die sie auf ihrem Gange abwärts entfaltet hat, — trägt ihn als Schlange der Tiefe auf ihrem Haupte, indem sie das Rückgrat, die Achse des Leibes, den Weltberg des Mikrokosmos, auf dem Haupte balaneiert, wie die Weltschlange der Tiefe in der indischen Kosmologie die Welt auf ihrem Haupte schwebend hält.
Die Weltfrau und Kundalini sind der makrokosmische und mikrokosmische Aspekt derselben Größe : der schakti, die göttlich alle Gestalt webt und trägt. Im Bilde der Weltfrau ist sie von außen umrissen als Leib, der alle stoffliche Lebensfülle der Welt entfaltet in sich beschließt, im Bilde der Schlange ist sie als alle Gestalt innen durchwirkende Lebenskraft gefaßt.
Erfahrungen gewaltsamer Atemkunst zum Ziele des Unbewußt-seins haben dieses Schema mit archaischer Bildkraft ausgeformt. Der Yogin soll es nicht lernen, um an ihm als Bild sich im Besitze einer besonderen Erleuchtung zu wähnen, es bietet ihm eine An-leitung, die inneren Erfahrungen seines Übens sich zu deuten, und eine figürliche Wegkarte fürs Weiterschreiten im Prozeß des Abbaus. Dieser Plan des Leibes will nicht gewußt und nur betrachtet, er will durchlaufen und aufgerollt sein, sonst bleibt er eine Einbildung ohne Wirkung. Wirkende Einbildungen aber, die als Übungen den Adepten verwandeln, gehören zum Bestande der Tantra's, denen Hathayoga nahesteht. So lehren die Tantra's die Gottheit im Lotos des eigenen Herzens schauen und innen kultisch verehren, aber dabei geht es nicht bloß um eine innere Vision der Gottheit, vielmehr gilt es ihr Bild aus dem gestaltlosen Inneren aufzubauen und ihre Gestalt nach vollzogener Verehrung wieder einzuschmelzen in die gestaltlose Substanz der eigenen Tiefe. Daran gewinnt sich die Erfahrung der eigenen verborgenen Gotthaftigkeit: der Gläubige zaubert in täglichem innerem Kult die Gottheit aus sich selbst hervor und läßt sie wieder im eigenen Dunkel verschwinden. So lernt er sich als das Göttliche wissen. Solch ein Prozeß ist der Weg zu einer anderen Wirklichkeit als der alltags erfahrenen, sein Gehalt aber ist wirklich im eigentlichen Sinne des Wortes, denn er wirkt Verwandlung dessen, der ihn sich einbildet. Als gewollte, freiwillig erzwungene Einbildungen sind solche Vorgänge in ihrer Wirkung ungewollten Einbildungen oder Zwangsvorstellungen verwandt. Ein Kind z. B. bildet sich ein, die Pferde auf der Straße müßten ihm etwas antun; infolge dieser Zwangsvorstellung ist es nicht auf die Straße zu bringen; seine Einbildung zwingt ihm eine Wirklichkeit auf, die es ganz beherrscht und ihm die allgemeine Alltagswelt verwandelt. Aber solche Einbildungen, die den Menschen vergewaltigen und beherrschen, bilden das Wirkliche weithin; von Gemeinschaft und Sitte geheiligt, wirken sie die an Bedeutungen reiche Seite der Welt, in der wir leben, ja für die wir leiden und sterben können. Die Wirklichkeit, der wir emotional erliegen, ist gefärbt, ja wesentlich gewirkt mit geheiligten Zwangsvorstellungen unserer Gemeinschaft, die uns die Welt als ein in sich bestimmtes Ganzes schenken.
Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet ist Hathayoga eine Technik, mit der sich ihr Adept willentlich Einbildungen einzwingt, die sein Ich und die Welt in ein Aufhebbares verwandeln. Er bricht den Zwang der Vorstellung von Welt und Ich, den die Gemeinschaft — nicht nur die menschliche, aber die Gemeinschaft der Natur — vielfältig ihm auferlegt, durch den Zwang seiner inneren Technik, die ihre wirkende Kraft aus dem Jenseits beider, dem Ziele ihres bildhaften Weges schöpft. Sein Adept lebt in der Welt und spielt in Anpassung an ihren Lauf das Weltkind; aber das ist nur Schale, wie der Eingeweihte tantrischen Kultes sein Menschsein als Schale weiß, aus der er in täglicher Andacht sein geheimes Wesen als göttlichen Kern hervorzaubern kann: sein Jenseits aus dem alltäglichen Diesseits.
Solch ein Zurückschreiten in uns selbst über Welt und Ich hin¬aus gibt sich freilich auch ohne Zwang, die Natur schenkt es uns im traumlosen Schlafe jeder Nacht, aber er sagt nichts über Ich und Welt im Verhältnis zu ihrem Jenseits. Sie schenkt es auch in der Entrückung liebender Umschlingung: Welt und Person versinken, Ich und Du sind ein Jenseits beider, — Indien lehrt in die-ser Vereinung von Weib und Mann das Verschmelzen des Weltleibes mit dem Weltgrunde, die Auflösung des gestaltig Entfalteten im Gestaltlosen erfahren. Eine andere Entrückung über Welt und Ich liegt im Gebet, im Versinken oder Aufschwung zu Gott. Solche Wege hinter uns zurück, über uns hinaus, sind uns notwendig: Ohne sie werden wir krank. So hält Natur Krankheit bereit als ein anderes Mittel, uns vom Ich und seiner Welt zu lösen. Wer sich in beide zu sehr verfing und, ihrer Oberfläche hingegeben, Stimmen seiner Tiefe überhört, den wirft etwas aufs Krankenbett, und was ihn verstrickte, wird gewaltsam abgestellt. Jetzt muß er ganz Kreatur sein, an die Belange von Ich und Welt zu denken ist ihm verboten, und wenn er sich erholt, liegen sie wie durch einen Golf von ihm getrennt am Ufer des Vorgestern. Aber Krankheit bleibt meist ein unzulänglicher Versuch ohne Folgen, uns vom Banne des Ich und der Welt zu lösen; ein wenig durch sie verwandelt und uns enthoben, bleiben wir es selten auf lange.
Mit der Krise der Gläubigkeit im 18. Jahrhundert sind alte Wege, die Religion weist, über uns selbst hinauszutreten, um das Leben in Welt und Ich zu ertragen, vielen nicht mehr offen. Ihr Notstand sucht Auswege: das ästhetische Erlebnis, die Entrük-kung in der Kontemplation großer Kunst, zuerst von Schopenhauer gepriesen, der auflösende, fortschwemmende Sturz titanischer, sehnsüchtiger Musik seit Beethoven, die Einheit erotischer und musikalischer Erlösungskräfte im «Tristan» — das wurde Ersatz im 19. Jahrhundert. Entrückungen auf Augenblicke, nur zu erhof¬fen, nicht zu erzwingen; das Jenseits in uns tut sich nicht auf, nur weil wir klopfen und seiner bedürfen. — Es wird geleugnet, und an Stelle des Ganges in die Tiefe tritt das seitliche Hinausdrängen aus dem Ich. Darin liegt die Faszination des Gemeinschaftserlebnisses: hinaus über das Ich durch Aufgehen in der Aura symbolischer Personen und Zeichen, in der verschmelzenden Atmosphäre, die das Ich auslöscht. Ein Vereinfachtes an Gehalt, ein Elementa¬res an Formel wird verlangt als das einzig wirklich Verbindende; der Drang der Bewegung zeigt das Dringliche des Notstandes, zeigt, welche kreaturhaft dämonischen Kräfte aus der Tiefe innen nach dem Ich des Individualismus langen, das, in barer Bewußtheit als in seiner Würde abgeschnürt, danach verlangt, seine Schale zu sprengen.
Diesen explosiven pathetischen Vorgängen ist eins gemein: sie verlarven ihre Absicht und den vitalen Gewinn, um den es ihnen geht, — hier in Enthusiasmus für die Kunst, dort in Opferbereitschaft für politische und soziale Ideale, die sich außen verwirklichen sollen. Es scheint ihnen die Unschuld versagt, sich zu dem Notstand zu bekennen, aus dem ihnen die eruptiven Kräfte schießen, und das gute Gewissen, bei Namen zu nennen, worum es im Grunde geht. Yoga bedeutet dagegen — neben anderem — einen methodischen Versuch in aller Unschuld, die Kräfte, die aus dem Ich in sein inneres Jenseits verlangen, und jene anderen, die von ihm abgeschnürt in Explosion nach oben drängen müssen, durch den Kanal einer Technik miteinander zu verbinden, auf daß der Mensch aus seiner Ganzheit lebe, — nicht um in einer dämonischen Sphäre verschlungen zu werden oder in einer halluzinierten zu zerstieben, sondern um aus dem inneren Jenseits in täglichem Umgang mit ihm ein höheres Gleichgewicht zu ziehen, in dem sich Welt und Ich, wie das Schicksal sie gibt, in grenzenloser Gelassenheit bestehen lassen.
Es wäre zu wenig von diesem Schema und seinen Symbolen gesagt, wenn es seine Wirklichkeit nur daran haben sollte, daß es im Yogin, der es sich erfolgreich ein-bildet, wirksam ist. Die Tiefenpsychologie unserer Tage (C. G. Jungs Analytische Psychologie) hat in der westlichen Person Schichten aufgehellt, in denen völlig Ähnliches, ja fast Gleiches zu Haus ist. Der Symbolschatz unserer Träume, aber auch Leitfiguren und Sinnbilder, die den wachen Menschen unwillkürlich überfallen können und ihn bannen, so unverständlich sie ihm bleiben mögen, entspringen derselben Tiefe des zeitlos Unbewußten, das den Rohstoff der großartig stilisierten Schemata Indiens ausgeworfen hat, um seine Menschen an ihnen zu leiten. In der analytischen Psychologie werden die Menschen angehalten, zeichnerisch festzuhalten, was an rätselhaften aber sie faszinierenden Bildern in ihnen aufsteigt, und es ergibt sich, daß in den Gebilden, die so entstehen, eine Symbolwahl waltet, die bis ins Einzelne von Motiv, Form und Farbe einer hintergründigen Ordnung entspringt. Sie ist bestimmt vom Gehalte der Wirklichkeit, die den Menschen in seinem Kulturkreis umgibt, und ist doch nur die Variante eines allgemeinsten menschlichen Gutes an Formen und Symbolen, das in immer anderer Abwandlung, in spe-zifischer Stilisierung und Verwendung den Bestand aller Mythen, Riten und Religionen ausmacht. In dieser ursprünglichen Verwandtschaft liegt ein aktueller Antrieb der modernsten Psycho¬logie Europas, sich mit allem Ältesten und Fernsten versunkener Kulturen, verdämmernder Archipele zu befassen.
Freilich, die analytische Psychologie des Unbewußten, die diese fast zeitlose Schicht im gegenwärtigen Menschen heraufbringt, ist noch fern von jener klassischen Durchbildung ihres Symbolschatzes, wie indische Lehren sie besitzen; sie ist eben in den Anfängen, das Material aufzufangen und zu sammeln. Die Visualisierungen, die hier in Zeichnungen festgehalten werden, sind frei wachsende Gebilde; in einem Notstand der Person, der sie zum Arzt geführt hat, ergreift das Unbewußte mit den verdrängten, vernachlässigten Schichten der Person die Führung aus dem Wirrsal, in dem das Bewußtsein nicht mehr weiter weiß, und spricht durch solche Zeichen wie durch Traumbilder.
Sie sind ein Abbild des Notstandes selbst, sie spiegeln die beklommene Situation, andrerseits aber sind sie schon ein Ansatz, schon ein Versuch der Selbstheilung der Gesamtperson von ihrem Unbewußten her. In ihnen gibt das Unbewußte Laut; sie sind seine Chiffreschrift. In diese wildwachsende Flora eines Krankheits- und Heilungsprozesses greift der Arzt nicht gärtnernd ein, er läßt sie wachsen, beobachtet ihre Blüten und begreift an ihrem Knospen und Vergehen, an ihrem Wechsel den Gang der Krise in unbewussten Krankheits- und Wachstumsstadien. Aber er pflanzt nicht die Keime solcher Bildvorstellungen in den Patienten, daß sie ihm als Wegzeichen und Brücken eines vorgezeichneten Heil- und Verwandlungsweges dienen. Eben das scheint in Indien der Fall mit solchen Schemata, die man sich einbilden soll, um über sie und über sich hinauszuschreiten.
Ihr Material muß entstanden sein wie jene Visualisierungen des Unbewußten bei uns: frei aufschießend aus inneren Prozessen und das Bewußtsein als bedeutsam bannend. Aus diesem Ursprung erklärt sich die Faszination, die sie unmittelbar auch auf uns zu üben vermögen, ohne daß wir irgend etwas von ihrem speziellen Sinn verstehen, — sie rühren in unterirdischer Verfaserung an ein Wurzelgeflecht in uns, das uns mit ihnen verbindet. Aber solche spontanen Ausbrüche des Unbewußten sind in den indischen Schemata in ein anderes Stadium ihres Daseins getreten, ihr Aggregatzustand hat sich gewandelt und hat Zusätze erfahren. In vielen indischen Bildvorlagen für Yogaübungen ist das bildhaft Symbolische im einzelnen mit Silbenzeichen, z. T. in alphabetischer Folge oder als Anruf göttlicher Kräfte, ringsum besetzt, figürliches Bei¬werk an ihnen wird aus der theologischen Überlieferung rational deutbar, je mehr diese sich aufschließt. Und dann erweist es sich als allegorisch. Was anfangs rein symbolisches Rohmaterial ursprünglicher Visualisierungen aus dem Unbewußten gewesen sein muss, ist durch einen mählichen Gang der Deutung in ein allegori¬sches Schema verkehrt worden. Das Symbolische an ihm ist mit seiner eigenen Deutung übermalt und mit ihr verschmolzen worden, ist durch sie stilisiert. Denn diese Schemata dienen ja in Indien einem anderen Zweck, als bei uns die Zeichnungen der analytischen Praxis; an ihnen soll ja nicht ein ungeklärter Notstand der Person aus Zeichen des Unbewußten abgelesen werden, vielmehr einem Menschen, der zum Verwandlungsgange im Yoga bereit und reif ist, wird ein Weg gewiesen, kraft seines Unbewußten über den Notstand naiven Daseins und seines unfreiwilligen Teilhabens an Welt und Ich hinauszuschreiten.
Das ursprüngliche Material wurde im Rahmen des indischen Weltbildes, seiner Zeichen- und Wissenswelt gedeutet und zum gültigen Vorbilde eines bewährten Weges redigiert. Aus der be-sonderen, vulkanisch oder dämonisch begnadeten Substanz einzelner stieg der Rohstoff solcher Schemata Stück um Stück über die Zeiten auf, — ein Leitstern in der Nacht einer vielen gemein-samen Lebensnot, — und wies den Weg begnadender Verwandlung. Wer als Schüler zu einem solchen Lehrer kam, der im Besitz des Weges war, und den Weg von ihm lernen wollte, auf dem der Lehrer über sich selbst hinausgeschritten war zur Souveränität über Welt und Ich, der stand vor der Aufgabe, dieselben inneren Erfahrungen und Gesichte folgerichtig in sich hervorzubringen; sie waren die einzig bekannten Wegsteine des dunklen schweren We¬ges voller Gefahren, irrezugehen. So wurden die spontanen Erzeugnisse des Unbewußten im Meister und in anderen, die dessen Mei¬ster gewesen waren, zu willentlich angestrebten Wegetappen des Schülers. Aus den Ausbrüchen des einen wurden die Exerzitien des anderen; was bei den Frühen — uns ungreifbar — aus dem Innersten brach, ward bei den späteren Adepten — in der Tradition uns greifbar — zu Einprägungen, die ins Innere eingedrückt seinen bildsamen Stoff nach dem Vorbild gestalten sollten.
Dieser Herkunft entspricht es, daß in der Überlieferung vieler¬lei Schemata laufen, die in Einzelheiten voneinander abweichen, auch wenn sie das Gleiche wollen; ihr Rohstoff mußte, wie bei uns, so mannigfaltig sein wie geheimnisvoll einhellig in sich; seine Deutung ward einhellig und schuf große Typen, sie konnte die Mannigfaltigkeit im einzelnen wohl stilisieren, aber nicht auslöschen.
Zur Stilisierung des Stoffes boten rationale Analogien die Hand, etwa für die Ordnung der Lotoszentren: Der Lotos der Erde liegt am Orte des Kotes, des erdnahen Stoffs, der Wasserlotos steht in Höhe der Blase, der Feuerlotos darüber im Zentrum der Leibeswärme, der Luftlotos bei den Atmungsorganen, der Lotos des Raumäthers zuhöchst. So liegen auch die Elemente im Weltleib geschichtet: über der Erde die wässrige Wolkenschicht, darüber die Feuersphäre der Gestirne, Luft und Äther findet archaisches Denken zuhöchst, sie hüllen wie Häute das Weltei ein. — Die beiden Kanäle des Atems, durch die beiden Nasenöffnungen nahegelegt, haben ihr Ebenbild in der indischen Embryologie: Nach der Liebeslehre (die sich in vielem mit dem Hathayoga berührt, z. B. in der ausführlichen Lehre der Haltungen, asana) hat der Leib der Frau zwei verschiedene Kanäle, in denen die Empfängnis eines Knaben oder Mädchens erfolgt.
Die Lotoszentren sind um und um mit den Figuren und Silbenzeichen besetzt, die ihr vielfältiges Wesen ausdrücken. Der Lotos Mulâ dhära («Ursprungs-Behälter» oder «Wurzel-Halt») trägt im Innern ein goldgelbes Viereck: Die Erde, deren Elemente er darstellt, denn nach ältester Vorstellung ist die Erde keine runde Scheibe, sondern den vier Richtungen des Raumes entsprechend quadratisch geformt. Ein Elefant trägt sie, er wird im Lotos visua-lisiert als Götterelefant: Weißfarbig mit sechs Rüsseln. Entsprechend der quadratischen Erdform ist der dunkelrote Erdlotos vierblättrig und trägt vier Silben, die ihr Wesen beschwören, es sind die vier vorletzten Zeichen des indischen Alphabets. In seiner Mitte steht ein rotes Dreieck mit der Spitze nach unten, das Symbol des Weiblichen, Empfangenden. Im ausklingenden m der Erdsilbe «lam», das als Punkt (als «Tropfen») geschrieben wird, thront Brahma mit vier Köpfen und Armen als ein Kind, der «Lotos seines Gesichts ist Seligkeit», neben ihm seine Gattin (shakti) mit vier Strahlenarmen, «rotäugig, wie viele Sonnen leuchtend», und «immer trägt sie» — als Schoß des Lebens — «den Glanz des reinen Unbewußten (schuddha-buddhi) ». Im roten Dreieck aber, dem Symbol des Schoßes, wohnt der Liebesgott, der Herr aller Jiva's und lächelt die samsara-gebundenen Wesen an. Und darin steht das Lingam, das männliche Symbol, goldfarben wie der indische Mensch und die indische Erde; die Schlange Kundalini hält es mit dreieinhalb Windungen zärtlich umschlungen und deckt schlummernd seine Öffnung. Sie ist die weltbetörende, allesbetörende Gotteskraft, wie sie die Öffnung des brahman-Tors zum Aufstieg in die Transzendenz mit ihrem Kuss verschließt, sie schimmert wie die Girlande eines Blitzes und windet sich wie die Spirale einer Muschel. Leis und süß summt sie wie ein Bienenschwarm Worte zarter Dichtung in immer zarteren Kadenzen, sie trägt alles Leben im Rhythmus des Ein- und Ausatmens und der ganze Weltkreis leuchtet von ihrem Glanze. Sie heißt die allerhöchste Herrin und herrscht sieghaft als der Aufgang ewiger Erkenntnis.
In gleicher Fülle sprechenden Beiwerks weben die übrigen Lotoszentren. Auf den sechsblättrigen Lotos des Wassers folgt der zehnblättrige des Feuers in der Nabelgegend, dem Zentrum der Leibeswärme. Inmitten seiner rauchfarbenen Blätter findet sich ein Dreieck mit emporgerichteter Spitze, Symbol des Männlichen, wie das abwärtsgekehrte das Weibliche bezeichnet, zugleich Symbol des Feuers, daneben der Ziegenbock, das Reit- und Wagentier des Feuergottes. Durch die Zentren der Elemente aufsteigend wächst die Zahl der Lotosblätter: Im Ätherlotos oben beträgt sie sechzehn. Denn in ihm sind alle anderen Elemente, als aus ihm hervorgehend, virtuell enthalten, in jeder höheren Blätterzahl des höheren Lotos ist das jeweils daraus sich abspaltende nächste Element der Kosmogonie mitenthalten: im sechsblättrigen Wasserlotos der vierblättrige Erdlotos. Zugleich läuft von unten nach oben ein Gang von stärkster Farbigkeit zu immer gelösterer Helle: der Ätherlotos an der Kehle ist innen hellblau wie das Firmament, schneeweiß thront dort auf schneeweißen Elefanten Shiva, auf dem Schneegipfel des Himalaya in weltabgeschiedene Askese versunken, neben ihm seine Gattin, gleichfalls milchweiß wie der Trank «Todlos». Im Blütenkelche schwebt der volle weiße Mond, der Schoß des Trankes «Todlos», das Tor zur großen Loslösung für den in Yoga Geübten.
Das Lotoszentrum zwischen den Brauen (äjanä, «Anfang der Erkenntnis») ist bereits jenseits der Sphäre der Entfaltung, die höchste Blätterfülle des Ätherlotos vereinfaltet sich hier zu zweien. Zweiblättrig enthält es die reine Polarität des Männlichen und Weiblichen in sich, ehe sie zum Spiele der Kosmogonie auseinan-dertritt. In seiner Entrücktheit ist es völlig milchweiß. Das Abklingen der Farben im Aufwärtsgange entspricht der mählichen Reinigung des kristallenen jiva in der Lehre der Jaina's: hat er sich von allem karman-Stoff, der ihn verfinsterte, geläutert, so steigt er in die milchweiße Zone der Entrücktheit auf, — an die Stelle des tausendblättrigen Lotos. Dieses Abklingen der Farben im Aufstieg der Kundalini spiegelt visuell einen Prozeß der Loslösung und Entformung, indes die wachsende Blattzahl der durch-laufenen Zentren vom Erd- bis zum Ätherlotos einen Gang ständi-gen Zuwachses darstellt: eine Integration des Differenzierten in ein Höheres, darin es eingeschmolzen wird. Das sind die beiden Seiten, die, nur in scheinbarem Widerspruch zueinander, nach der Lehre der Yogasûtra's das Wesen des Weges ausmachen. Lingam- und Dreiecksymbol, an der allgemeinen Entfärbung teilnehmend, erscheinen im sechsten Zentrum oben zwischen den Brauen milchweiß, wie sie golden und rot im untersten standen, und wie sie rauchblau einander durchdringend im blutroten Lotos des Herzens erscheinen: innige Vereinigung zum Davidsstern, Männliches und Weibliches einander besitzend als Leben des Lebens, Herz im Herzen. Dieser Verwandlung des lebendig blutenden Lebens zur Milchweiße des Tranks der Todlosigkeit, zur Schneeregion der Askese entspricht der physiologische Befund des Yogin während der Kundalini-Übung: Die Leibeswärme weicht aus ihm schrittweise nach oben zurück, bis im Stadium zeitlicher Vollendung, wenn der tausendblättrige Lotos erreicht ist, nur mehr die Schei¬telspitze etwas Wärme zeigt, indes der übrige Körper, wie im Tode, erkaltet ist, um mit dem mählichen Abstiege der Kundalini mählich sich wieder zu erwärmen.
Der tausendblättrige Lotos zuhöchst, milchweiß dem farben-blühenden Leben und all seiner Differenzierung entrückt, aber sie in sich beschließend, wie das reine Licht den ganzen Regenbogen, trägt auf seinen zahllosen Blättern alle Silbenzeichen des indischen Alphabets in endloser Wiederkehr, indes sie auf allen Zen-tren unter ihm nur jeweils einmal auf einem ihrer Blätter figurieren. Er ist die vielfältige Integration alles aus seiner Transzendenz kosmogonisch zu Welt und Ich Differenzierten, — indem er nicht nur alles dort vereinzelt Verteilte als ganze Reihe in sich trägt, sondern diese Reihe unzählbar vielfach in sich beschließt: Symbol des Höchsten.
Dieser Weg über die Stufenleiter der auseinander entfalteten Elemente, wie er über ihre Einschmelzung schrittweis bis ins Jen-seits aufgehobener Fülle aller Unterschiede führt, ist zugleich ein Abbild des natürlichen Sterbeprozesses, wie Indien ihn sieht. Das tibetische Totenbuch «Bardo Tödol» gibt die indische Lehre im Gewande des lamaistischen Tantrismus, wenn es vom Vorgang des Sterbens und den Erfahrungen handelt, die ihm in dem «Zwischenzustande» (bardo) folgen, zwischen dem Abscheiden aus dem Leibe und dem Eingehen in eine neue Individuation.
Hier wird die Folge der Empfindungen eines Sterbenden in der Agonie beschrieben: zuerst stellt sich ein furchtbares Druckgefühl ein, als ob der erdhafte Leib in Wasser ertränke, dann löst sich das Erdhafte (dem der Mulädhära-Lotos entspricht) im Wasser auf: es geht über in ein erstarrendes Kältegefühl. Jetzt ist der Lebensfunke des Sterbenden aus der untersten, der Erdzone seines Mikrokosmos zurückgestiegen und hinaufgelangt in die höhere Zone des Wassers, dem der Svadhisthana-Lotos entspricht, der Gang der Wiedereinschmelzung der Leibeswelt, wie sie stufenweis entfaltet dasteht, hat begonnen. Jetzt ist der Sterbende ganz in der kalten Wasserzone. Aber das Kältegefühl dieser Sphäre, das ihn wachsend umfängt, schlägt auf seiner Höhe um in die Empfindung brennender Hitze; damit gelangt der Ablösungsgang des jiva aus dem Leibe von der Wasserzone in die Sphäre des Feuers, zum Manipûra Lotos, dem Zentrum der Leibeswärme am Herzen. Diese furchtbare Glut geht über in das Gefühl, in tausend Atome zerstieben zu müssen; da langt der jiva aufsteigend beim vierten Lotos der Luftsphäre, beim Anahata-cakra in Höhe des Herzens an.
Wenn dieses Gefühl verebbt, befindet er sich in der Äthersphäre, auf der Höhe des Vischuddhachakra in der Kehle. Wer dank Yoga ein bei Lebzeiten Erlöster ist, erhebt sich spontan über diese Sphäre; im Durchgang durch die beiden Lotoszentren der Transzendenz (den zweiblättrigen Lotos zwischen den Brauen — äjnâ-cakra — und den «tausendblättrigen» der Scheitel-höhe) verläßt sein Lebensfunke den Kosmos des Leibes durch den «brahman-Spalt» in der Hirnschale (brahma-randhra = Fontanelle) ; der jiva des Unerlösten aber bleibt umfangen vom ätheri¬schen Element und zieht in ihm aus Kehle und Mund des Sterbenden. Denn der unsichtbare, ungreifbare Äther ist das Element des Zwischenzustandes, der den jiva aufnimmt, bis er aus ihm in eine neue Verleibung gleitet.
So stellt der Aufstieg der Kundalini durch die Lotoszentren des Leibes eine willentlich geübte Vorwegnahme des natürlichen Sterbens dar. Er schenkt dem Adepten noch im Fleische ein neues todloses Leben, zu dem er wiedergeboren wird, wenn die Schlange der lebenentfaltenden Kraft aus dem tausendblättrigen Lotos zu-höchst über die Schwelle, die Diesseits und Jenseits trennt, wieder ins Diesseits des Leibes zurückkehrt und stufenweise seinen Mikro¬kosmos neu entfaltet bis zum untersten Lotos hinab. Dann ist dem Adepten ein Bewußtsein geschenkt, das wieder ein Alltagsbewusstsein ist, zugleich aber verwandelt durch den Schritt über die Schwelle des Jenseits und wieder zurück, — völlig verwandelt durch das Wissen um die Kraft, diesen Gang ins Jenseits und zurück nach Belieben wiederholen zu können, ja schließlich die Schritte zur Entfaltung des Diesseits von Leib und umgebender Welt nur tun zu müssen, wann es beliebt. Der Adept genießt als schließliche Frucht seiner Übung des Kundalini-Yoga das Bewusstsein, frei zu sein vom unfreiwilligen Gebanntsein an Mikrokosmos und Makrokosmos; wie das Göttliche — das er ja verborgen, nun aber offenbar sich ist — läßt er beide als Spiel der Selbstentfaltung und Differenzierung seines Wesens aus sich hervorgehen und nimmt sie in sich zurück, wie es ihm beliebt.
Begreift man als Sinn des Kundalini-Ganges, daß er ein Weg der Überwindung des Todes und der Wiedergeburt zu neuem, todlosem Leben ist, so rückt er nahe an bekannte alte und zeitlose Dinge des Westens. In der «Zauberflöte» treten zwei geharnischte Männer auf ; sie öffnen den Einzuweihenden den Weg der Prüfung, auf dem sie in den Sonnenstaat gelangen sollen, der die Mächte der Nacht be-kämpft, — die beiden singen: «Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden, wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden; Wenn er des Todes Schrecken überwinden kann, schwingt er sich aus der Erde himmelan. Erleuchtet wird er dann imstande sein, sich den Mysterien der Isis ganz zu weihn.»
Das Wissen der Eingeweihten und Logenbrüder des 18. Jahr-hunderts, das den geheimnisvollen Hintergrund in der «Zauber-flöte» bildet, geht in letzter Linie unmittelbar auf den bekannten Schluß von Apulejus' Roman «Der goldene Esel» zurück. Apu¬lejus' bedeutende Schilderung des Weges, den der Eingeweihte der Isis zu gehen hat, bietet nun eine genaue Entsprechung zum Aufstiegsweg der Kundalini. Und diese spät-antike Isis, die alle großen Göttinnen und Mütter des Vorderen Orients und des Mittelmeerbeckens in sich aufgenommen hat als Aspekte und verschiedene Namen ihrer allumfassenden Weltmutterschaft, steht in ihrem weltgeschichtlichen Raume ganz so da, wie die höchste göttliche Kraft, die Shakti, Weltentfalterin und Weltmutter, Kundalini, Herrin des Lebensgeheimnisses in Indien, die sich in Gestalt und Namen aller indischen Göttinnen und Götter verehren läßt. Was von dieser Isis bei Apulejus gesagt wird, gilt ebenso von Schakti-Kundalini: «in den Händen der Isis läge überhaupt das Leben eines jeglichen Menschen» — so ist Kundalini die Entfalte-rin und Erhalterin des Mikrokosmos unseres lebendigen Leibes, — «lägen die Schlüssel zum Reiche der Schatten» — so ist KundalinI die Führerin über die Schwelle des Todes zum Jenseits des tausend¬blättrigen Lotos, — «in ihren Mysterien würde Hingebung in einen freiwillig gewählten Tod und Wiedererlangung des Lebens durch die Gnade der Götter gefeiert und vorgestellt, ... durch ihre Allmacht würden ihre Eingeweihten dann gleichsam wiedergeboren und zu einem neuen Leben zurückgeführt» — hier wie dort geht es um die Überwindung der Vergänglichkeit und des Todes und um eine Wiedergeburt durch einen Vorgang, der geheimnisvoll verwandelt.
Was man über diesen Vorgang bei Apulejus erfährt, entspricht dem Ablauf des Kundalini-Prozesses : «ich ging bis zur Grenz-scheide von Leben und Tod, ich betrat Proserpinens Schwelle» — also das Reich des Todes wird betreten, der Abbau des kreatürlichen Ich wird vollzogen; Proserpina, die Herrin der Toten, ent-spräche hier der Schakti und Mutter in ihrem grauenvollen, tod-drohenden Aspekt als Maha-Kâli, als großer Todesgöttin, die als skeletthaftes altes Weib die Eingeweide des blühenden Lebens, das sie hinrafft, verschlingt. — «Und nachdem ich durch alle Ele-mente gefahren, kehrte ich wiederum zurück» — was tut Kunda-lini als Prinzip unseres Lebens anderes in ihrem Auf- und Abstieg durch die fünf Lotoszentren der Elemente? — «Zur Zeit der tief¬sten Mitternacht sah ich die Sonne in ihrem hellsten Licht leuchten» — so bricht das Licht des höchsten brahman aus dem Dunkel der Maya — «ich schaute die unteren und oberen Götter» — eine altägyptische Formel für «alle Götter» — «von Angesicht zu An-gesicht und betete sie in der Nähe an», — so verehrt der Yogin alle Götter, wie er sie in den Lotoszentren aufgereiht und ange¬siedelt findet, einen jeden an seiner Stätte, indem er ihr Bild innen sich aufruft und die Silben und Sprüche flüstert, die ihr Wesen enthalten.
Der Eingeweihte der Isis erfährt dann seine Heimkehr vom Jenseits des Todes im Sinnbild des Nachtlaufes der Sonne; von ihrem täglichen Tode im Westen kehrt die Sonne auf unterwelt-licher Nachtfahrt durch die zwölf Stundenhäuser der Tiefe allnächtlich zur Wiedergeburt im neuen Aufgang. Der Eingeweihte wird nacheinander in zwölf verschiedene Gewänder gekleidet, entsprechend den zwölf Stundenhäusern des Unterweltslaufes, in denen die unteren Götter und die Toten der Sonnenbarke zujubeln, die an ihnen vorüberfährt, «in tiefster Mitternacht leuchtend mit hellstem Licht», — dann wird der Eingeweihte endlich der versam¬melten Isisgemeinde gezeigt: «als Bild der Sonne ausgeschmückt stand ich gleich einer Bildsäule da» — er steht auf einer Holzbank unter dem Bildnis der Göttin Isis, augenscheinlich in der Haltung ihres Kindes Horus, in dem ihr Gatte und Bruder Osiris, wiedergeboren als sein Sohn, zurückgekehrt ist.
Dieses ganze Geschehen ist ein Vorgang, der einmalig am Ein-zuweihenden bei der Einweihung vorüberzieht, mit Räumen und Bildern, Kleidern, Formeln und Symbolen, mit Gebärden und Schritten durch Hell und Dunkel, — eine sakramentale Handlung, die von außen her vollzogen wird, damit der Einzuweihende sich daran innerlich verwandle. Der Adept mimt die Sonne, um ihr Wesen zu teilen: Als immer wieder Todgeweihter ein in Wahrheit Todloser zu sein; — durch den Mimus der Sonne, die aus der Totenwelt wiederkehrt, durchtränkt er sich mit ihrer todenthobenen Natur, so wie der Hathayogin, der Vischnu als Löwen-Mann mimt und sich in der Vorstellung durchdringt, der Gott zu sein, sich mit seinem übermenschlichen Wesen durchtränkt. Aber der Yogin des Kundalini-Ganges vollzieht mehr als einen Mimus, er verübt wirk¬lich eine innere Einschmelzung und Neuentfaltung des Mikrokosmos, er wandelt nicht einen sinnbildlichen Weg durch Gewölbe und Gänge eines Tempels, aber im Gebäude seines Leibes durchmißt er mit der Kundalini einen wirklichen Wandlungsweg im Gange der «Ader reinster Lust» aufwärts und abwärts.
In anderen Andachtsübungen entfaltet der Yogin in Anlehnung an eine gemalte Vorlage ein kreisförmiges konzentrisches Bild (mandala) in innerer Schau und setzt sich selbst mit seiner Imagi¬nation in den Mittelpunkt dieses Gebildes, in den sich selbst ent¬schwindenden, ungreifbar feinen Punkt oder Tropfen (bindu), aus dem die kreisförmige Gestalt in konzentrischen Formen hervor¬quillt und sich um ihn breitet. Er läßt diesen sich selbst ungreif¬baren Tropfen der Transzendenz in fortschreitenden Visualisierungen aus seiner in sich selbst aufgehobenen Fülle aller Gestaltmöglichkeiten überfließen zur konzentrisch-gestaltigen Vielfalt der Erscheinungswelt, und was er so aus dieser Mitte quellen läßt, nimmt er, wenn es entfaltet und angeschaut ward, wieder in sie — in sich — als Sphäre des Transzendenten zurück. Der KundalinI-Yogin ist sich selbst mit seinem Leibe ein solches mandala, vielmehr sein Leib ist wie der Kreissektor eines solchen mandala: der Mittelpunkt daran, das dem Zugriff entschwindende Transzendente, der Quell aller Entfaltung, ist der tausendblättrige Lotos des Jenseits, «außerhalb des brahman-Ei's» der Welt des Leibes, die konzentrischen Schichten aber, zu denen dieser «Tropfen» sich entfaltet, werden durch die übrigen fünf Lotoszentren bezeichnet, der Erdlotos (Mulâdhära) liegt an der Peripherie der Entfaltung des Mikrokosmos, als deren letzte dichteste Stufe, die Suschumnâ aber ist ein Radius des Kreissegmentes, der die Peripherie durch alle konzentrischen Sphärensegmente mit dem Mittelpunkte verbindet. Auf diesem Radius spielt sich die Uebung des Kundalini-Ganges ab: dieser gewollte Weltuntergang, dieses absichtsvolle Sterben und das Wiedergeborenwerden als Welt und Leib, das darauf folgt. Hier wird erfahren, wie wir zustande kommen und uns aufbauen, als was wir uns täglich haben; es ist als solle sich hier das Geheimnis lüften, das Hofmannsthal in seinem Distichon «Erkenntnis» anrührt:
«Wüsst' ich genau, wie dies Blatt aus seinem Zweige herauskam, Schwieg' ich auf ewige Zeit still: denn ich wüßte genug.» Hier greift eine innere Hand hinter den Schleier des Weltpro-zesses, wie aus dem transzendenten Einen (dem überweltlich ruhenden höchsten Schiva) das vielfältig Vergängliche, die Welt, wird, dank der unendlichen Bewegtheit seiner Kraft, der Schakti, die in uns Kundalini, die Lebensschlange, ist. Man erfährt erleuchtend die Einheit der Gegensätze Schiva und Shakti —: die in sich ruhende Transzendenz und die aus ihr und in sich spielende Imma¬nenz der Welt sind zwei Aspekte eines Bestandes. «Erleuchtet wird er dann imstande sein, sich den Mysterien der Isis ganz zu weihn» — was heißt das ins Indische übersetzt? Das Geheimnis der Isis als Kundalini, — wo wäre es nicht? Sie selbst ist das offenbare Ge-heimnis. Sie spinnt es als Mâyâ, von Welt und Ich und löst es, wie Penelope nächtlich ihr Geweb des Tages wieder auf im Heimgang zum transzendenten Einen, zum überweltlichen ruhenden Schiva des höchsten Lotos. Daß sie eins mit ihm ist, nie von ihm getrennt oder verschieden, die Gattin in unendlicher Umschlingung des Gat¬ten, und daß er jenseits scheint wie sie diesseits, — das ist ihr Geheimnis. Der Yogin, der es für sich erleuchtet hat, ist allein imstande, sich ihm «ganz zu weihn». Für ihn hat die Gewalt, die alle Wesen bindet, der Bann unfreiwilligen Teilhabens an Welt und
Ich in ihrer Vergänglichkeit, seine Macht verloren. Mitten im Leben steht er, ihm hingegeben als der vielfältigen Offenbarung der göttlichen Kraft, die sein innerstes Leben ist, von seiner Mayâ außen wie innen, in Welt und Leib, nicht überwältigt oder gebannt, in bodenloser Gelassenheit.
Ein Gleiches lehrt mit anderen Zeichen der spirituale Weg der Yogasütra's, die das Wesen des Yoga vom Psychischen her mit einer idealen Verbindung von Präzision und Weiträumigkeit in Formeln fassen. Einer ihrer Grundbegriffe sind die «Minderungen, Behinderungen oder Beschwerden» (klescha). In der Alltagsspra-che meint das Wort alles, was das ideale Befinden eines Gegenstandes, einer Person beeinträchtigt: ein welkgewordener Blumen¬schmuck, ein abgenutzes, beschmutzes Gewand ist von «klescha» betroffen, so auch die Schönheit des Monds, wenn eine Wolke sie befängt; aufreibende Geschäfte und Verpflichtungen sind «klescha», sie ziehen einen von seinem Wesen ab. Im Yoga sind diese «Minderungen» unserer eigentlichen Herrlichkeit fünf an Zahl: Befangenheit oder «Nichtwissen» (avidyä), das Gefühl «ich bin ich», Zuneigung und Abneigung und als letztes der Drang ins kreatürliche Dasein. Diese «Minderungen» sind Verkehrtheiten unseres wahren Wesens, indem sie «schwingen (oszillieren), festigen sie das Walten des psychischen und physischen Weltstoffs, der uns aufbaut» und sich in den drei Aggregaten der lauteren Klarheit, des Wirbelstaubs der Leidenschaften und der Dumpfheit der Kreatur darstellt. «Befangenheit» ist der Mutterboden der anderen, diese sind Wandlungsformen des «Nichtwissens»; in ihnen strömt sich Befangenheit als der naive Eindruck aus, Vergängliches und Unreines, Leidvolles und Wesenloses an der Welt und unserem natürlichen Dasein sei unvergänglich, rein, glückhaft und wesensvoll. Dieser zwingende Eindruck, der uns befängt, veranlaßt falsche «Benennung» : «unvergänglich ist die Erde, ist der Himmel mit Mond und Sternen, unsterblich die himmelbewohnenden Götter» — indes das Gegenteil Wahrheit ist. Das indische Vergänglichkeits¬gefühl setzt nicht bei der Hinfälligkeit der Kreatur ein, ihr gibt die hintergründige Wesenlosigkeit des Kosmisch-Astralen, die Vergänglichkeit der Götter das Relief.
Die Minderungen hängen sich an alles, was für uns die Form eines Gegenstandes annimmt, in allen Augenblicken unserer ver-kehrten Benennungen sind sie wirksam, aber für den Yogin, der sich vollendet, «schwinden sie der schwindenden Befangenheit nach». Dank Bemühungen im Yoga werden sie kleiner und kleiner, in Zuständen der Entrückung sind sie auf Zeit eingeschlafen, aber im Weltkind sind sie mächtig. Alle zusammen sind was man das Leben der Person nennen muss: Die Verfangenheit in die Welt, wie sie sich uns bietet, das Hangen an unserem Ich, wie es uns naiv gegeben ist, Zuneigung und Abneigung, die uns auf allen Wegen leiten, und der Drang ins kreatürliche Dasein, der uns mit dem Wurme eint, der Urschrei in Gefahr, «nicht will ich nicht sein, — ich will sein» — er ist der Schrei im Tode und schwingt uns hinüber in künftige Existenz. Anfangslos quillt er aus sich selbst, «denn wie empfände sonst ein eben erst geborenes Geschöpf, das den Tod noch nicht gekostet hat, Abneigung gegen die Eigentüm-lichkeit des Sterbens?» — dieser Urlaut meint auch, «nicht möchte ich nicht werden, — ich will werden»; er besagt den Drang des Lebens, über seine Gestalt hinauszufließen und neue Gestalten zu bilden, um nicht im Tode des Individuums verschlungen zu werden. Mythisch stellt sich dieser Drang als erste Regung des Weltentstehens dar; der «Herr der Ausgeburten», der Weltschöpfer der Veden wird durch zwei Motive zur Zeugung der Geschöpfe aus sich selbst heraus bewogen: er fühlt sich einsam und fürchtet sich, darum gebiert er die Fülle der Lebensgestalten aus sich, oder aber es verlangt ihn, «viel will ich sein, ich will mich ausgebären». Er ist nicht schaffender Geist, aber Kreatur, All-Kreatur, aus der alle Kreaturen kommen, und seine zwei Regungen sind ein Drang, — der Drang aller Kreatur: da zu sein, wie immer es sei, und nicht zu vergehen; über sich hinaus zu sein und nicht in sich zu vergehen.
Die Minderungen sind zeitloses Erbe unserer kreatürlichen Natur, sie liegen den anfangslosen Imprägnierungen unseres Kerns zugrunde, die als ein unbewußter Schatz von Bereitschaften, uns zu gebaren, von frühem Dasein her an uns haften. Sie wollen ab-gebaut sein; nicht bloß die Person, auch die Kreatur in uns soll abgestreift, ein Jenseits von beiden, das ungreifbar in uns ruht, soll uns zu eigen gegeben werden. Askese, Lernen und dem Göttlichen Sich-weihen sind drei Mittel des «tätigen Yoga», die dazu helfen. Askese glüht Unreinheit in uns hinweg, die aus anfangslosem Uns-Selbstbestimmen durch zahllose Akte des Verhaltens in früheren Leben mit vielerlei Tönung uns trübt (wie auch der Jaina-Yoga lehrt), — jene naturhafte Unreinheit, die auf den Minderungen beruht und früheren Imprägnierungen unseres unbewussten Kerns, bereit vorm «Netz der Dinge und Situationen» zu immer neuem spontanem Sich-Geschehenlassen ins Bewußtsein aufzubrechen. Stofflich besteht sie in einem Übermaß verwölkender Leidenschaft und animalischer Dumpfheit; beide sollen zerstäubt und aufgelöst werden durch asketische Glut, wie Sonnenglut trü¬bende Wolkengebilde aufsaugt und zerlöst in die ätherisch klare Stille des Firmaments. «Lernen» meint Rezitieren von reinigenden, heiligenden Silben und Worten und wiederholtes Aufsagen der Lehre, die vom Banne der Befangenheit erlöst und den Gang der Selbstverwandlung weist. «Sich dem Göttlichen weihen» meint, alles was man tut, samt den Früchten die es trägt, nicht für sich selbst vollziehen, sondern dem Gotte aufopfern nach der Devise, «was ich willentlich tu oder unwillkürlich, Reines oder Unreines: alles das lege ich auf Dich, von Dir gelenkt tu ich es» — vollkom¬mene Selbstabdankung in gläubiger Hingabe (bhakti), wie die Bhagavadgitâ sie lehrt: «ich bin es nicht, der tut».
In einem Leben, das sich ganz diesen Verhaltensweisen weiht, soll es gelingen, die «Minderungen» — den Inbegriff von Person und Kreatur in uns — «völlig klein zu kriegen» und «im Feuer der Askese ihren Samen», der zu immer neuem Blütenflor der Individuation, zu immer neuer Frucht des Schicksals aufschießt, «zu verbrennen», seine Keime zu töten, dann wird von allen Minderun-gen und Beschwerden unangetastet eine «feinste Erkenntnis» die Möglichkeit gewinnen, in Funktion zu treten. Es wird eine rein unterscheidende Erkenntnis sein: daß ein innerster, rein zuschauen der Kern in uns jenseits aller greifbaren Person und des Tiefendunkels ihrer unbewußten Bereitschaften steht, jenseits des psychisch-physischen Weltstoffs in uns, der sich durch «tätigen Yoga» von seinen niederen Aggregatformen verwölkender Affekte und animalischer Dumpfheit zu völliger Klarheit und Stille geläutert hat. Das Gemüt, durch Sammlung und Vereinfaltung aus dem beständigen Strudelflusse äußerer Eindrücke und innerer Reaktionen in einen klaren Spiegel gestaut, faßt diese jenseitige Größe in sich: sie hebt sich ab und begreift sich als ein unverwoben Jenseitiges, das nur gespiegelt wird von der völlig geläuterten Person.
Diese Erkenntnis, die Person und jenseitigen Kern voneinan-der scheidet, bedeutet die Einleitung eines «rückläufigen Prozesses» in uns : das ständige Aufschießen von Person und Welt aus unserer Tiefe im Sich-Geschehenlassen unbewußter Bereitschaften zum Gestaltigen innerer und äußerer Akte wandelt sich in den Abbau der Sphären, die von der Dynamik dieser Akte erfüllt, ja ständig neu von ihr gewoben werden. An Stelle der Welt- und Ichverflochtenheit tritt ein Abgespalten- und Ledigsein : der Zustand des «kaivalya». Sein Wesen ist mit «Ledigsein» nur einseitig begriffen: nur von der Seite des Abbauprozesses her, der Person und Kreatur als Schwerpunkt unseres Daseins auflöst; indem wir über beide hinaus und zurück nach innen schreiten, werden wir ja nicht ärmer sondern reicher. Das besagt ja der Begriff «Minderungen» als Zeichen für Person und Kreatur; ihr Abbau bedeutet den Weg¬fall von etwas, das uns beklemmt und hindert, unserer wahrhaftigen, uns lang verborgenen Herrlichkeit froh zu werden.
Der Weg zu diesem idealen Sein, unbeschwert von Minderungen, geht über eine Reihe von Übungen wunderbarer Erfahrungen, in denen das kaivalya als Fülle verborgener Herrlichkeit sich schrittweis zu eigen gibt. Man hat die besonderen Kräfte, die sich auf diesem Gange entfalten, als «supernormal powers» begriffen, — das sind sie, sofern man den verminderten, beschwerten Zustand des Weltkindes als den normalen ansieht. Sieht man aber, wie die Yogasütra's laut ihrer Bezeichnungsweise tun, das Person- und Kreaturhafte an uns als den abnormen, weil verminderten und be-schwerten Zustand an und spricht wie sie vom Stande des kaivalya — und von welcher anderen Ebene gültiger Wirklichkeit her sollte Yoga die Dinge benennen? —, so sind diese wunderbaren Kräfte uralter, lang vorenthaltener Besitz unseres tieferen Wesens; im Weltkind gefangen und schlummernd, werden sie endlich freige¬setzt. Innere Sammlung auf einen Gegenstand, die sich selbst ver¬gessend ganz in ihm aufgeht und nur mehr wie sein eigenes Aus¬strahlen ist, verwandelt den Adepten in den Gegenstand : sie verleiht ihm ein übersinnliches, überlogisches Wissen um dessen Sphäre. Solche Sammlung hat soviel Stufen, wie sie sich an Ge¬genstände des Fixierens heften kann, sie befaßt sich mit den Orga¬nen des Leibes wie mit Bestand und Elementen der Welt; auf die Zeit als vergangene, gegenwärtige und künftige gerichtet, befreit sie von der Bindung der Kreatur an Augenblick und Gegenwart und gibt ein Wissen um Vergangenes und Künftiges. Oder: das Unbewußte tut sich auf mit seinem Schatz an Imprägnierungen und Bereitschaften, der Yogin aber liest in ihnen intuitiv seine Ver¬gangenheit in früheren Leben, die sich zu diesem Schatz an Zeichen und Keimen in ihm niedergeschlagen hat. Sammlung auf den unmittelbaren Eindruck einer anderen Person führt dazu, um ihre Gedanken zu wissen. Sammlung auf die Sonne verschafft die Intui¬tion über den Bau des Kosmos, dessen allsehendes, wanderndes Auge die Sonne ist; Sammlung auf den Mond, den Herrn der Sterne, erschließt das Wesen der Sternenwelt, Sammlung auf den Polar¬stern schenkt Intuition des Sternenlaufs, der den Pol umkreist, Sammlung auf den Nabel, den Pol des Leibes, schenkt das intuitive Wissen um das Arbeiten der Organe. Solchem Erkennen ohne Grenzen folgen entsprechende Kräfte: Verlust der Körperschwere, Herrschaft über die Elemente, gedankenschnelle Bewegung durch den Raum und andere Fähigkeiten werden genannt.
Hier ist man mitten in der Sphäre der Magie des Unbewußten, wo es seine ungeheuren Möglichkeiten, aus der überpersönlichen Fülle unserer Tiefe zu schöpfen, dem Menschen lockend zur Verfügung stellt. Aber die Gefahr, in bodenloser Inflation des Ego aus der rauschhaften Traumwelt des Über-Ich in die kahle Tagwelt wachen Daseins wirken zu wollen, wird voll begriffen: alle diese Ausweitungen der Person sind kein Ziel des Yoga, wohl aber sind sie Wegzeichen, die als solche angestrebt werden sollen und sich einstellen auf dem Gange zum kaivalya. Es steht wohl am Ende dieser Erfahrungsreihe, aber nur für den Adepten, der sich nicht mit einem Rest von Ego in die Ausübung solcher Verlockungen verfängt. Diese Verlockungen seiner überpersönlichen Sphäre ver-dichten sich dem Yogin, wie er sie innen dem kaivalya zuschreitend durchquert, zu göttlichen Gestalten. Sie nahen ihm mit Glanz und Reiz und bieten ihm himmliche Freuden, den Trank der Todlosig¬keit, Erfüllung aller Wünsche, göttliche Einsicht. Er aber spricht zu sich, ohne ihrer zu achten, «geröstet auf den schauerlichen Koh¬len des zeitlosen Kreislaufs durch Geburten und Tode und umge¬trieben in seinem Dunkel, habe ich mit Mühe die Leuchte des Yoga erlangt, die das Dunkel der Minderungen vernichtet. Feindlich sind ihr diese Sinnendinge, deren Mutterschoß Verlangen ist, wie wehende Winde dem Licht einer Lampe. Ich habe das Licht dieser Leuchte erschaut; wie könnte ich, von dieser Fata Morgana der Dinge verführt, mich dazu hergeben, Brennholz zu sein für die von neuem entflammten Gluten des Lebenskreislaufs? — fahrt wohl, ihr Dinge, Traumbildern vergleichbar, Wunschziele Beklagenswerter!» — damit gibt er sich ganz der Sammlung in Yoga anheim. Er wird nicht einmal stolz darauf sein, diesen hohen Versuchungen begegnet zu sein und sie ausgeschlagen zu haben: solcher Stolz wäre eine letzte sublime Hemmung, ein letzter Triumph eines in Inflation zum Über-Ich geweiteten Ego. Dieser Gang über immer andere Fähigkeiten, die vom Weltkind her wunderbar scheinen, läßt immer neue Facetten am Kristall der ungeminderten Herrlichkeit unseres Wesens aufleuchten; sein Ende, das kaivalya, integriert all jenen stufenweis zugewachsenen Gewinn in sich, der sich als differenzierte Kräfte des Wissens und Wirkens an besonderen Bereichen der Welt und des Leibes entfaltet hat. Der Endzustand erreichter Herrlichkeit hebt sie alle zu undif¬ferenzierter Ruhe, unbezeichenbarer Einheit auf. Wie er negativ gesehen «Ledigsein» von Minderungen ist, meint er in seinem posi-tiven Gehalt die Integration aller Möglichkeiten, zu sein und zu wirken, die übergegensätzliche Totalität aller individuellen Bestimmtheiten, sich auf etwas zu beziehen, sich irgendwie zu ge-haben. So ist er Entrücktheit gegenüber jedem Schicksal, das sich allemal als Konsequenz der Individuation und Differenzierung er-weist. Es ist ein Dasein jenseits jeder Bestimmtheit und Abhän-gigkeit, eine in sich schwebende Fülle aller Möglichkeiten, die dem Zwange der Kreatur, sich in irgendeine greifbare Wirklichkeit vollstrecken zu müssen, enthoben ist. Ein Sein, das sich grenzenlos weiß und aller Bestimmung bar, wie es die Präexistenz des Göttlichen ist, wenn es sich noch nicht zum Spiele der Welt in Selbst¬differenzierung aus seiner Ruhe entfaltet hat: schicksallos, todlos. Der Weg zum kaivalya vollzieht an unserem Wesen die «restitutio in integrum», wie der Aufstieg der Kundalini die schrittweise Integration der aus sich differenzierten Elemente in den sie alle in sich integrierenden Äther vollzieht und im Heimweg über ihn hinaus zum überweltlich ruhenden Gott die totale Integration der Welt des Leibes erreicht.
Der rituale Lebensweg des Hindu ist mit Sakramenten bestanden, von Bräuchen, Festen und Observanzen eingefaßt, wie eine Landstraße von Bäumen. Von ihnen überschattet wandelt er dahin; sie umfangen ihn, ehe er geboren wird, und wissen ihn zu finden, wenn er schon lange tot ist. Sie stehen neben den Mythen von Göttern und Menschen, die in Epen und alten Überlieferungen ohne Ende das alle verbindende und leitende Gut an Sinnbildern und Formeln für die Wirklichkeit der Welt und des menschlichen Schicksals enthalten. Das moralische Element, Vorbild und Warnung, das die Mythen im Ablauf ihres Geschehens vorführen, verdichtet sich in den Observanzen zu formendem, erziehendem Zugriff auf den Menschen. In ihrer seelenführenden Funktion sind solche Observanzen dem Yogawege verwandt und aus ihrer Eigenart fällt Licht auf die seine.
Da gibt es eine Observanz, «das Hinschenken der Frucht», — sie wird von der Mutter geübt, die einen Sohn geboren hat. Einen Sohn zur Welt zu bringen, ist höchste Pflicht und höchstes Glück der Hindufrau; dazu ist sie geheiratet worden, daß durch sie der Mannesstamm des Gatten nicht abreiße, daß sie den Gatten und seine Vorväter im Sohne wiedergebäre. Durch diese höchste Frucht erhält ihr Leben einzig Sinn und Recht. Aber so sehr sie an der wahrhaften Frucht ihres Lebens hängt, — sie hat den Sohn nicht zur Welt gebracht, um ihn für sich zu bewahren, sondern um ihn an die Welt dahinzuschenken, wenn er reif ist, von ihren Knien in die Welt hinauszustreben.
Die große Bindung zwischen Mutter und Kind, naturhaft und innig, birgt in sich die Gefahr einer tiefen, kaum löslichen Lebenskrise, für die Mutter wie für den Sohn, wenn das Dasein der Mutter mit religiöser Ausschließlichkeit auf diese Bindung wie auf weni¬ges andere gestellt ist. Und die Gefahr dieser Lebenskrise kann die Beziehung und den Sohn vergiften. Aber die natürliche, notwendige und schmerzlichste Ablösung des Sohnes von der Mutter, daß sie die Frucht (phala) ihres Lebens als Gabe (däna) an die Welt da-hingibt, wird durch die Observanz (vrata) des Hinschenkens der Frucht (phala-dana-vrata) möglich gemacht.
Wer so Großes opfern will, muß mit kleinen Dingen anfangen und sich an ihnen auf das große Opfer hin erziehen. Der Anfangszeitpunkt dieser Observanz ist unbestimmt, er liegt etwa um das fünfte Lebensjahr des Sohnes herum, sie läuft über eine unbestimmte Zahl von Jahren und währt alljährlich einen Monat lang. Der Haus-Brahmane und geistliche Lehrer der Familie (Guru) be-stimmt ihren Gang; er entscheidet, wann die Mutter reif zu dem Abschluß ist: Früher oder später nach voraufgehenden Opfern das eigentliche Opfer des Sohnes darzubringen. Die Frau beginnt mit dem Opfern von kleinen Früchten, die sie sehr gern hat. Sie verzichtet darauf, sie zu essen, und bringt sie täglich mit Reis und allerlei Gemüse dem Haus-Brahmanen als Spende dar. Sie fastet morgens und reicht dem Guru diese Gabe, wenn er im Laufe des Vormittags das Haus besucht; er ißt davon und reicht ihr auch eine Kleinigkeit, die sie andächtig verzehrt. Sie fastet dann weiter bis zum Abend, da darf sie wieder kochen und essen. Jedesmal wenn er kommt, erzählt der Guru der Mutter eine mythische Geschichte von einer Frau, die alles zu opfern wußte und daraus die Kraft zog, alles zu bewirken; stumm und aufmerksam, heiliges Gras in den zusammengelegten Händen, lauscht ihm die Frau, nimmt seine Worte in sich auf und bewegt sie in ihrem Herzen. Jedes Jahr steht eine andere, wertvollere Frucht sinnbildlich im Mittelpunkt dieses Hinschenkens. Von Früchten schreitet das Opfer fort zu Metallen, von Eisen über Kupfer und Bronze schließlich zu Gold. Das sind die Metalle, aus denen der Schmuck der Frauen gefertigt ist. Eigentlich ist hiermit wohl die — mindestens teilweise, jedenfalls schrittweise — Hinopferung des Schmuckes der Frau gemeint. Denn ihr Schmuck ist mit den Kleidern der einzige persönliche Besitz der Frau, an dem sie hängt; — aber es können Gegenstände aus diesen Metallen an seine Stelle treten, die eigens dafür bestimmt sind, ihn sinnbildlich in dieser Observanz zu vertreten.
Die letzte, äußerste Steigerung dieses Opferganges ist ein völliges Fasten: die Frau reicht dem Guru frische Kokosmilch und muß den ganzen Tag Durst leiden. Brahmanen, Verwandte und Gesinde (Untertanen) wohnen der Zeremonie bei; sie vertreten als Zeugen die Welt, an die der Sohn dahingegeben werden muß. Zum Abschluß der Observanz werden zwölf Brahmanen, ein paar Bettler und Angehörige des fünften Standes der «Unberührbaren» zeremoniell gespeist: höchste und niederste Kaste, Spitze und Sockel der sozialen Pyramide stellen sinnbildlich und als Zeugen die gesamte soziale Welt dar, an die der Herangewachsene aus Heim und Mutterbanden überantwortet werden muß. Auch ein Verwandter vom Mannesstamm muß dabei zugegen sein, er ver-tritt den Teil der Welt, den das mütterliche Opfer des Sohnes an die Welt zumeist angeht. Die Observanz findet ihr Ende darin, daß der Guru die Mutter für reif erklärt, das Hinschenken des Sohnes an die Welt zu vollziehen. Dann bringt sie das Opfer der Frucht ihres Lebens —: Schweigend und innerlich.
Mythos und Ritus verflechten sich in dieser Observanz, um die notwendige Verwandlung an der Mutter zu vollziehen : sie von dem Liebsten zu lösen, das sie an sich gebunden weiß und immer an sich gebunden halten möchte. Der Ritus sinnbildlichen Hinschenkens erhält sein Licht aus den Mythen vorbildlicher Gestalten, mit deren immer erneutem Vortrag der Guru die Schritte des Opferganges begleitet. Ihre Haltung wird aus dem Unbewußten der Frau erweckt, um ihr Wesen nach sich zu gestalten, um sie zu erlösen und zu bewahren vor der triebhaften Gewalt der Bindung, die Mutter und Kind zum Schaden beider vergewaltigen kann. An die Stelle der rührenden aber bedrohlichen Dämonie des elementaren Gefühls tritt ein sinnbildliches Wesen im Innern, das diese Gefühlsflut in seinen Kontur aufnimmt und in seine Haltung verwandelt.
Liebe kann sich so gut in eifersüchtigem Umklammern wie in segnendem Freigeben bewähren. Wir haben die Möglichkeiten zu allem in uns. Aber wir sind nicht imstande, sie mit Vernunft und bewußtem Willen aus ihrem tiefen Schlummer zu wecken, wenn es not täte. Aber das Sinnbildliche, im Mythos immer wieder vernommen, im Ritus immer neu geübt, hat diese zaubernde, beschwö¬rende Macht über unser Unbewußtes, aus dessen Schoß die Dämonie des Triebhaften steigt, uns vergewaltigend, und wir können uns ihrer nicht erwehren. Wir sind nicht Herr unserer Gefühle, aber Leitbilder, mit Riten uns ins Unbewußte gesenkt, führen und formen unser Gefühlsleben.
Das ist der Sinn einer anderen Observanz, die von Schwestern an Brüdern geübt wird. Das Familienleben, zumal in der indischen Großfamilie, wo die erwachsenen Söhne mit Frau und Kind oft im Hausstande der Eltern leben, ist voller Reibungen. Die angeheirateten Frauen der Männer und deren Schwestern im Hause — wie verträgt sich das? In der Familie lebt man beieinander mit allen kleinen Plagen und Sorgen des Tages, reibt sich an den Eigenheiten des anderen — wann wird man sich bewußt, wie nahe man einander ist: ein Blut, ein Leben. Wichtige Gefühlsfunktionen werden vernachlässigt, verkümmern, schlafen, und oft erwachen sie, wenn es zu spät ist.
Die Observanz «das Stirnzeichen des Bruders» («bhratri sphota») wird in der zweiten Nacht des zunehmenden Mondes im Oktober geübt. Alle Schwestern der Familie tun sich zusammen und laden ihre Brüder ein; der Ritus, den sie üben, dient dazu, ihre Brüder vor dem Tode zu bewahren. Er wird als ein Opfer dargebracht, den Tod zu überwinden. — Andere Opfer werden geübt, einen Gott zu verehren, seine Huld zu gewinnen; hier kommt kein Gott in Frage; das Opfer besteht darin, daß die Schwester sich selbst darbringt an den Tod. So tat es einst die einzige Schwester des ersten Menschen für ihren Bruder Yama. Der erste Mensch, Yama (das ist «Zwilling») , hatte eine Zwillingsschwester Yamunâ (im vedischen Mythos «Yami» genannt), die hat für ihn den Tod überwunden. Indem sie sich täglich für ihn dem Tode opferte, wurde er zum todüberwindenden König im Reiche der Seligen, wurde zum Herrscher der Totenwelt. Diese mythische Begebenheit ist das Vorbild für die Schwestern, sie wiederholt sich in ihrer Observanz. Das Ganze ist eine Frage der Willenskraft und des Glaubens: weil Yamunä mit ihrer Willenskraft fähig war, ihren Bruder unsterblich zu machen, muß jede Schwester in sich den Glau¬ben entwickeln, mit ihrer Willenskraft an ihrem Bruder das gleiche Wunder zu vollbringen.
Alle Schwestern laden alle Brüder bei einer von sich ein. Sie fasten und richten den Brüdern ein besonderes Mahl, eine kleine Speise. Sie besteht aus lauter ganz reinen, lebendigen Dingen. Nach Mitternacht gehen die Schwestern aus und sammeln den nächtlichen Tau von den Blättern, reinstes Wasser vom Himmel, die Lebensmilch aus der oberen Welt, die alle Kreatur erquickt und aufbaut. Ein reines Herz voll sorgender Liebe ist es, des diese Observanz bedarf; und diese liebevolle Mühe, die den reinen Tau nächtlich zum Tranke sammelt für den Bruder, zeigt das reine Herz an. Zum Tauwasser kommt Reis, er ist rein und lebendig, da er frisch enthülst wird; dazu Banane, rein und lebend aus der Schale, und frische Kokosmilch aus der eben zerspaltenen Frucht.
Als Sinnbild erneuerten frischen Lebens erhalten die Brüder neue reine Gewänder von den Schwestern; sie legen sie an, nachdem sie gebadet haben. Dann nehmen sie das kleine Mahl entgegen. Die Zeremonie findet ihren Höhepunkt darin, daß die Schwestern den Brüdern mehrmals ein Zeichen (sphota) zwischen den Brauen auf die Stirn tupfen. Sie nehmen dazu Lampenruß, Sandel, Honig, Dickmilch und zerlassene Butter, die sie, jedes für sich, mit dem kleinen Finger der linken Hand verrühren und auftragen. Mit diesen Stoffen, die Leben bedeuten, zeichnet Yamunä die Stirn ihres Bruders, um ihn gegen den Griff des Todes zu feien. So ist auch die Speise aus reinsten Stoffen, aus Himmelstau und lebendiger Frucht, ein Abbild des Trankes «Todlos», von dem die Götter ihr ewiges Leben haben. Während dieser Zeremonie wird erzählt, so habe Yamunä. an Yama gehandelt und dadurch habe er den Tod über¬wunden und sei unsterblich geworden. Zum Abschluß der Observanz bekommen die jüngeren Schwestern von den größeren Brü¬dern ein kleines Geschenk — meist Süßigkeiten —, und die älteren Schwestern beschenken die kleineren Brüder.
Es handelt sich hier nicht nur um einen Zauber, der die Brüder gegen den Tod feien soll durch die Liebe der Schwestern. Die Nach¬ahmung des alten Zaubers, den Yamunä an Yama übte und dessen mythischer Erfolg die Wirksamkeit der Observanz beglaubigt, hat ebensosehr seinen Sinn darin, die Möglichkeit eines idealen Verhältnisses zwischen Bruder und Schwester, die auf dem Grunde dieser Beziehung überall im Leben verborgen liegt, zur inneren Wirklichkeit aufzurufen, auf daß sie die Gegenkräfte des Alltags und der menschlichen Unzulänglichkeit, die Ströme möglicher Verstimmung und Entfremdung, Gleichgültigkeit und Verfeindung paralysiere und durch ihr Gegenteil ersetze. Das mythische Urbild soll, was der Tag vielleicht verschüttet hat, aus der Tiefe des Unbewussten, in die es abgesunken sein mag, erwecken und aus seiner Verkümmerung zu beherschender Entfaltung ins Leben der Person heraufbringen. Wen solche Bräuche auf Schritt und Tritt umfangen und tra-gen, daß sein Weg recht unwillkürlich immer in den Geleisen läuft, die sie ihm ziehen, der braucht sich nicht bewußt zu werden mit Fragen und Entscheidungen, wie er sich halten und wohin er schreiten soll. Das ist schon für ihn vorgesorgt in der Weisheit der großen Kult- und Lebensgemeinschaft, die ihn sakramental empfing und segnete, ehe er geboren ward, und die ihn immer wieder segnet, — gerade auch wenn sie mit eigentümlicher Strenge sinnbildliche Opfer und Entsagungen von ihm verlangt. Er schwimmt, von der Strömung ritual-sakramentaler Observanzen getragen, zeitlebens sich selber unbewußt, — gleichsam unter Was¬ser treibt er im Strome des Unbewußten dahin. So fährt er im Einklang mit sich selbst und den ewigen Gehalten des Lebens einher, die mit Aufgaben, Beglückungen, Opfern und Leiden in jedes Leben treten. Es macht die Genialität solcher Observanzen aus, daß sie völlig treffend sind in ihrer Sinnbildlichkeit, — so völlig treffend wie unsere tieferen Träume und für die Vernunft manchmal so dunkel wie diese. Sie treffen das Unbewußte als den Regenten unseres Lebens in uns mit eben der Gewalt des Sinnbildlichen, in der die eigentliche Genialität des Unbewußten besteht, wenn es unsere Träume hervorbringt oder sonst durch unwillkürliche Handlungen uns Zeichen gibt.
Solche Bräuche sind ja auch von einem Unbewußten geschaffen, nämlich geformt vom kollektiv-überpersönlichen Geiste der Kult-und Lebensgemeinschaft, und sie sind bestimmt, ein Überpersön¬liches in uns, eben das tiefere Unbewußte, anzusprechen. Sie sollen es leiten, auf daß unsere Person sich im Überpersönlichen menschlichen Zusammenlebens richtig verzahne und auf daß sie den ewigen Gehalten des Lebens gewachsen sei, die auch ein überpersönliches an Schicksal und Anforderung sind, jenseits aller individualen, biographisch-geschichtlichen Situation, in die sie sich jeweils verlarven, uns gemeinsam mit aller lebendigen Natur.
Dieses Unbewußte als überpersönliche Sphäre unserer Tiefe ist voll gestaltigen Gehalts; hier hat sich, wie die Psychologie der Träume und anderer Äußerungen des Unbewussten zeigt, in Sinnbildern, in Urbildern niedergeschlagen , was der Mensch von je, seit und ehe er sich aus der Reihe der Tiere löste, an Schicksalhaftem erfahren hat. Unsere tieferen Träume bringen es uns herauf, und es ist nichts anderes, als was die Mythen aller Zeiten an Figuren, Situationen und sinnbildlichem Requisit bewahrt haben. Darum bedient sich die Weisheit solcher Observanzen, die den Lebensgang der Person aus ihrem Unbewußten her steuern wollen wie durch unsichtbare Klippenzonen, in denen wir unversehens scheitern können, mythischer Gestalten, um den Menschen durch jene not¬wendigen Gehalte des Lebens, die seine naturhaft unausweichlichen Krisenpunkte bedeuten, ohne Schiffbruch zu geleiten. Die Urbilder oder Varianten von Urbildern in Mythos und Ritus treffen das Un¬bewußte, das keine vernünftige Mahnung und Tröstung erreicht; — sie aber treffen im Unbewußten ein ihnen Verwandtes, ein Urbild, das in seiner Tiefe webt, und wecken es als Werkzeug des Regenten in uns, als ein Leitbild aus dem Unbewußten, das Macht gewinnen kann über unsere Person, auf daß sie sich ihm angleiche in ihrem Verhalten.
So wirken solche Urbilder, aus ihrem Schlummer in uns zu Leitbildern erweckt, Verwandlung an uns, indem sie, von ihresgleichen außen in Mythos und Observanz aufgerufen, in unserer Tiefe sich erheben und die Führung in uns an sich nehmen. Was unser bewusster Wille nicht in uns erwecken kann, erhebt sich aus uns zu leitender Funktion, daß es uns nach seinem Bilde verwandle und unsere formlosen Lebenskräfte leite, indem es sie in sich als eine bereite Urform aufnimmt und sich mit ihnen erfüllt, wie eine Form mit flüssigem Metall. Dann bewahrt uns das aufgerufene Urbild in uns davor, daß unsere formlosen Kräfte unter dem Druck der ewigen Lebensgehalte, die uns als aufgegebenes Schicksal beklemmen und zu zermalmen drohen, unsere Person zerreißen oder in die Irre jagen, — es gibt uns als altes, zeitlos gültiges Vorbild den Frieden mit dem unausweichlichen Schicksal der Kreatur. Das ist die besondere Funktion heiliger Gestalten und anderer Figuren, die sich zum Range mythischer Sinnbildlichkeit erhoben haben, daß sie uns verwandeln können zu ihresgleichen in Tun und Leiden, wenn sie ihr Bild, das in uns ruht als Möglichkeit großer Haltung, zu erwecken vermögen über die Brücke unserer Hingabe und Sammlung auf ihr Wesen.
Eine andere solche Observanz, die wie das «Stirnzeichen des Bruders» mit einem mythischen Urbild wirkt, ist der Sävitri-Ritus, den die indische Witwe vollzieht. Das Schicksal der indischen Witwe gehört wohl zum Schwersten, was einem Menschen aufer-legt sein kann. Die Hindu-Ehe ist ein Band für die Ewigkeit. Die Frau bleibt über den Tod hinaus die Frau dieses einen Mannes, d. h. der Mann ist unsterblich für sie. Aber halb noch als Kind ihm an-vermählt, verliert sie ihn oft, ehe sie ihn recht besessen hat. Mit dem seinen ist ihr Leben zu Ende. Was ihr nach seinem frühen Tode bleibt, ist kaum der Schatten eines Daseins.
Eine Observanz, alljährlich einen Monat lang geübt, soll der Witwe helfen, dem schicksalhaften Gehalt ihres Lebens gewachsen zu sein. In ihrem Mittelpunkt steht die sagenhafte Gestalt der Sa¬vitri, einer Königstochter, die den Sohn eines vertriebenen Königs heiratete, obwohl sie wußte, was ihm verborgen war : daß seine Tage vom Gott des Todes gezählt waren. Als die Zeit kam, da der Todesgott das Leben ihres Mannes holen würde, fastete sie drei Tage lang und reinigte sich, dem Gotte zu begegnen. Sie wich nicht von ihres Mannes Seite und folgte ihm in den Dschungel; da war's beim Holzholen in der blühenden Wildnis, als alle Natur vom Sommerregen erquickt in Blüte stand, daß der Gott des Todes kam und ihres Gatten Lebensfunken in seiner Schlinge fing. Aber sie sprach zu ihm von allem Heiligen und Guten, beschwor ihn und ließ nicht ab, bis sie das Leben ihres Mannes erbeten hatte, und das Augenlicht für seinen blinden Vater, Krone und Reich für den Vertriebenen dazu empfing und ihr selbst Söhne und Glück vom Gott verheißen waren.
Was Savitri vor Zeiten vollbrachte, ihren Mann wieder zum Leben zurückzuführen, als ihn der Tod schon geholt hatte, das sucht jede Frau, der ihr Gatte gestorben ist, in ihrem Leben zu vollbringen. Das ist der Sinn dieser Observanz, die im gleichen Sommermonat von der Witwe geübt wird und in einer Neumond-nacht enden soll, wie Sävitris Geschichte ihr wunderbares Ende in einer Neumondnacht fand. Die Observanz enthält drei völlige Fasttage, entsprechend dem Fasten Sävitrls vor ihrer Begegnung mit dem Gotte. Sie wird im Hause der Witwe vor dem Bilde der Hausgottheit geübt, die Gottheit ist als Zeuge gegenwärtig. Ein Brahmane, der Guru der Witwe, kommt jeden Tag und erzählt ihr die Geschichte von Sâvitri; die Frau, die bis zu seinem Kommen gefastet hat, lauscht ihm, heiliges Gras in Händen haltend. Am Ende der Observanz wird der Frau ein weißer Seidenfaden neunmal um den linken Oberarm geschlungen, er bezeichnet und schafft die unlösliche Verbundenheit mit dem ungreifbar gewordenen Gatten. Sie trägt ihn, bis die Observanz sich im kommenden Jahre wiederholt. So soll sich das Wunder der Wiederkehr des Gatten, sein Lebendigsein für die Gattin, wenn nicht greifbar im Raume, innerlich für die Gattin vollziehen. Das Urbild der Liebe, die den Tod überwindet, wird in ihrem Herzen aufgerufen als der Sinn ihres Lebens und Schicksals. Die Variante des Urbilds in Gestalt der mythischen Sâvitri erweckt es aus der Tiefe des Unbewußten zum Leben, auf daß es die Person überwältige und ihre Lebenskräfte, die chao¬tisch in Schmerz oder Verlangen sie zerreißen oder in die Irre treiben können, in sich aufnehme und sie in ihrem Wesen um¬forme zu einem Ebenbild der Sävitri.
Dem Unausweichlichen gewachsen sein, ist die Weisheit des Lebens. Das Unbewußte allein, das alles weiß und sinnbildlich in sich bewegt, uns aber als Person davon nur soviel sehen läßt als wir verdienen, wenn wir ihm zu lauschen vermögen, und nicht viel mehr als wir bedürfen, um unseren Weg durch die unausweichlichen Gehalte des Lebens zu wandeln, — das Unbewußte allein ist allem gewachsen. Es ist das alterslose Ganze, dem nichts Neues geschieht, was auch mit uns geschehe, und das dem Gange des Ich zuschaut wie die kummerlose Natur dem Aufblühen und Vergehen ihrer Geschöpfe. Seine wachste Zeit in den meisten Menschen ist die Kindheit, daher ist sie das eigentlich geniale Alter: zauberhaft, unbestechlich und allem nahe.
Darum gibt es in Bengalen eine Observanz, die von Kindern geübt wird; sie lehrt den Menschen das Einzige, des jeder bedarf :dem Unausweichlichen gewachsen sein. Es ist die Verehrung der Jamburi. Größere Kinder weihen die kleineren ein. Sie beginnen damit im fünften oder sechsten Jahre, und Kinder, die noch kleiner sind, beteiligen sich wenigstens in stummem Dabeistehen. Er-wachsene dürfen nicht dabei sein, ja sie wissen nicht einmal genau, wann die Kinder den Ritus üben, denn diese Observanz darf, wie alle ihresgleichen, keine unbeteiligten Zuschauer haben. Sie ge¬schehen ja alle um der Verwirklichung willen am Übenden selbst, nicht als Darstellung oder als ein sinnbildliches Zeremonial zur Belehrung und Weihung anderer. Darum muß der Ritus heimlich vor den Großen geübt werden. Er sieht fast aus wie ein Spiel der Kinder unter sich, die das rituale Leben der Großen mitangesehen haben, wie es das ganze Jahr durchspinnt, und die nun in ihrer kleinen Welt mit derselben Wichtigkeit des Geheimnisses jener Riten und mit dem unerschütterlichen Ernst des Kindes ein Glei¬ches tun, — aber mit welchem tiefsinnigen Ernst, der um alles weiß!
Die Observanz läuft über fünf Jahre und wird in den Winter-nächten des kältesten Monats geübt. Die Kinder stehen heimlich ganz früh morgens auf, wenn es noch dunkel ist, ehe noch ein Tier unterwegs ist, ehe noch ein Vogel seine Stimme erhebt. Jede Nacht formen sie eine neue kleine, kaum handgroße Figur der Jamburi aus Erde, — aus derselben Erde, in der sie tagsüber spielen und wühlen. Jeden Morgen, wenn der Ritus vorüber ist, wird die Figur weggeworfen, — so formen ja auch die Erwachsenen im Kult zu Haus sich täglich kleine Götterbilder aus Lehm, die nach der An¬dacht ins Wasser geworfen werden und darin zergehen. Die kleine Figur hat keine Arme und Beine, kaum angedeutet sind Augen und Mund. Mit einem kleinen Erdwall wird vor ihr ein kleiner Teich geformt. Daran sitzt sie und darin wird ihr Wasser dargebracht, dazu Blumen und heiliges Gras. «Ich bringe dir Wasser, bevor die Krähe davon getrunken hat; ich bringe dir Blumen, ehe eine Biene sie besucht hat» — solche Sprüche begleiten die Darbringung, und dazu wird die Geschichte von Jamburi erzählt. Ihr Sinn — und es ist der Sinn der Observanz — ist: Jamburi hat keine Füße und keine Hände, keinen richtigen Mund und keine richtigen Augen, und doch kann sie alles vollbringen, alles verwirklichen, — denn sie hat einen Willen; das wollen wir von ihr lernen.
Die Gebräuche steigern sich jeden Tag, und der innere Vorgang, der, an ihnen geweckt, sie begleiten soll, durchläuft die sieben Stufen des Yogaweges, der sich an ein Götterbild heftet: von der Betrachtung des leibhaftigen Bildes bis zur Loslösung auf sein inneres Abbild, dessen Schau keines äußeren Haltepunktes mehr bedarf, und von der inneren Anschauung dieses Bildes im Gegen-über von Schauendem und Bild zur Vereinigung beider (samadhi), zur Verwirklichung des Bildgehaltes im Andächtigen —: Beide tauchen ineinander und werden eins. Die Darbringung von Wasser und Blumen ist dann nur eine ein¬leitende Zeremonie; mit ihr bezeugt das opfernde Kind, daß es als echter ernster Schüler zur Jamburi kommt, wie ein Schüler zu sei¬nem Guru: ehrfürchtig und dienstbereit, — bereit die Lehre der Jamburi in sich aufzunehmen und zu verwirklichen. Dann folgt die Belehrung, aufsteigend über die Yogastufen. Die Erzählung vom Mythos der Jamburi bildet, immer erneut, die Brücke, auf der die stumme starre Lehrerin, der kleine Erdenkloß, den andächtigen Schülern gibt, was er von seinem Wesen mitzuteilen hat. — So gibt es ja auch heute noch Belehrung und Einweihung unter Erwachsenen (im japanischen und tibetischen Buddhismus), die im Gegenüber von Lehrer und Schüler erfolgt, begleitet von sinnbildlichen Gesten und festen Formeln, ohne daß dabei ein Wort der Belehrung gesprochen wird. Lehrer und Schüler haben sich in Askese gereinigt und in Übungen alle ihre Kraft darauf gesammelt, ein in Worten nicht Übertragbares einander mitzuteilen. Der Lehrer gibt, der Schüler empfängt etwas, das mehr als Wissen ist —: Eine Kraft, einen magischen Teil aus dem Wesen des Lehrers, der ins Ganze der Person, ins Unbewußte des Schülers dringt und aus der Tiefe ihn wandelt.
Das Ergebnis dieses aufsteigenden Prozesses ist: Der kleine Schüler der Jamburi hat, was sie ihn lehren kann, nämlich ihr Wesen, so in sich aufgenommen, daß es Wirklichkeit in ihm ge worden ist, — seine neue Wirklichkeit, zu der er umgewandelt ist. Ihr Wesen ist in ihn hinübergeflossen und zu seinem wesenhaften Bestand geworden. Wie wäre das möglich, wenn es nicht keimhaft in ihm läge, als eine der zahllosen Bereitschaften seiner halb form¬freien, immer formbaren und formbegierigen Lebenskraft, der «schakti» in ihm, die — wie die unendliche Kraft, die schakti des Allgottes, den Makrokosmos entfaltet und durchspielt — in der kleinen Welt seines Leibes waltet, vielfältig Gestalt annehmen und sich zu immer neuem Gebaren entfalten will?
Von hier ist der Blick auf jenen Yoga frei, der in täglicher Ver-ehrung der Gottheit ihr inneres Schaubild im Andächtigen aufruft. Die Literatur der Tantra's bietet zahllose Anweisungen für diese Form der «pujâ», der Verehrung des Göttlichen in einem seiner unendlich vielen Aspekte. Sie lehrt einen inneren Kult voll gläubi¬ger Hingabe (bhakti) an die «Gottheit, der einer opfert» nach dem Ritual, in das ihn sein Guru eingeweiht hat. Wie in der Observanz der Jamburi dient ein kleines Kultbild als Mittelpunkt für den Ritus der Darbringung und Verehrung. Zugleich aber dient es als Ausgangspunkt für die innere Anschauung des Frommen, die sich an seiner äußeren sinnfälligen Erscheinung mählich vollsaugen soll, bis sie des greifbaren Bildes entraten kann. Dann wird der äußere Kult, der mit Schmücken der Kultfigur, mit Darbringungen, geflüsterten Sprüchen, Lichterschwenken und anderem Zeremonial den Empfang und die Bewirtung eines hohen Gastes mimt, hinfällig. Diese Kultübung wird in die Sphäre rein innerlicher Anschauung verlegt. In innerer Schau wird die Göttergestalt mit ihrem Gefolge und Requisit in dem ihr eigenen Raume (Palast, Landschaft, Sitz unter einem Baume usw.) aufgebaut. Das geschieht schrittweis; der ganze Bildgehalt wird Stück für Stück bis ins Detail innerlich visualisiert und stetig festgehalten. Die Göttergestalt wird mit «geistigen», d. h. rein visualisierten Geschmeiden und Perlen geschmückt an Hals und Armen, Brust und Hüften, vom Diadem ihres Scheitels bis zu Ringen um die Knöchel; «geistige» Blumen werden ihr dargebracht, — in einem Prozeß fortlaufender Visualisierung soll sich das ganze äußere Zeremoniell abspielen.
Aber das ist, von der Endabsicht her gesehen, noch Vorberei-tung; die angespannte Bemühung innerer Schau drückt die gläu-bige Hingabe und Verehrung des Frommen aus, wie die Spenden und Sprüche der Kinder und ihr nächtliches Sich-Mühen im Kult der Jamburi. Das eigentliche Ziel ist, daß dieses innere Bild der Gottheit und der es in uns innerlich erschaut, aus der Zweiheit ihres Gegenüber zur gegenseitigen Durchdringung gelangen, in Eins verschmelzen (samâdhi). Dann erfährt der Gläubige, daß die Gottheit nicht von ihm verschieden ist, — sie webt nicht irgendwo draußen in der Welt und kam, ihn zu besuchen; auch thront sie in keinem Himmel über Himmeln —: aus seinem eigenen gestalt-losen Innern baut er sie auf mit allen Einzelheiten und läßt sie am Ende der Andacht wieder in seine gestaltlose Tiefe innen zerrinnen, in die Urwasser des Unbewußten, wie der indische Gott die Welt, die er entfaltete, wenn sie zur Auflösung reif ist, wieder ein-schmilzt in sich selbst, die all-eine nächtige Urflut. Aus dem Un-bewußten zwang der Fromme sich die Erscheinung des Göttlichen herauf, nachdem das Unbewußte ihre Form nach dem Modell des äußeren Kultbildes sich einverleibt hatte, — nun kann es sie in täglichem Prozesse er-innern. Wie Brahmä auf dem Lotos sich an jedem Weltanfang aus den Urwassern hebt und hebt, demiurgisch die Welt zu entfalten, und wie die Welt am Ende eines Äon sich im welt- und raumlosen Meere des Anfangs wieder auflöst, erhebt sich die Gottesgestalt als Ausgeburt und Hieroglyphe aus dem Innersten des Adepten, — als eine wahre Gestalt seines ungreifbaren Wesens, die ihm als solche unbewußt geblieben war und auf keine andere Weise willentlich ins Bewußtsein zu heben ging.
Die Zahl der Götterbilder, deren Verehrung in innerem Herauf-beschwören, Anschauen und Verschmelzen gelehrt wird, ist Legion. In immer anderen Varianten der Erscheinung, Tracht und Geste treten die großen und kleinen Götter des Hinduismus auf, mit wechselnden Waffen, Emblemen und Requisit, mit segnenden und drohenden Haltungen, gnädig und finster, und begleitet von ihren göttlichen Kräften (schakti) als ihren Frauen, die das göttliche Wesen entfalten wie Facetten des Kristalls die Farben des Lichts. Dem Gotte in gnädiger Erscheinung mit segnender und schenken-der Gebärde steht oft seine Schakti drohend bluttriefend zur Seite, denn nur so ist er wahrhaft ganz, sein Wesen ist das Ganze. — Sie alle werden visualisiert als Ausgeburten unserer eigenen Tiefe, als Hieroglyphen unseres Wesens. Denn in uns allen ist alles, — mindestens als Möglichkeit.
In uns ist die Anlage zu allem: wir wollen hören und gehorchen, folgen und uns leiten lassen, dienen und uns abdanken; aber wir wollen auch aufschwellen und gebieten, herrschen und Blitze schleudern; wir wollen in Gemeinschaft aufgehen und einsam sein, keines anderen bedürftig. Alles Grauen schläft in uns und alle Untat, aber auch alle Möglichkeiten der Läuterung und Verklärung. Ein unaufhaltsam schnelles Nacheinander wie ein Rasen zucken¬der Blitze, ja ein ewiges Zugleich aller dieser widersprechenden Möglichkeiten wäre die totale, ideale Erfüllung des in uns angelegten Wesens, der schakti in uns: — und es würde uns selbst zerreißen und unsere Welt, wenn es so aus unserem Innersten hervor¬bräche, über uns hinaus strömte in die Wirklichkeit und sich projizieren wollte auf die Welt. Die reale Erfüllung solches ungeheuren Spieles ist das Dasein Gottes, — nicht aber der Kreatur. Sein Abglanz liegt auf dem Gebaren des Kindes, solange es klein ist; da findet dieser Drang ein höheres Maß an Erfüllung als später, ohne daß der Mensch daran zerbricht. Da projiziert sich noch alles Innere hemmungslos nach außen, was später durch Gemeinschaft und Erziehung dann allmählich gehemmt, verlarvt und ins Unbewusste verdrängt wird. Es strömt sich aus, naiv und schrankenlos : alle Bosheit, lächelnde Fühllosigkeit, quälende Grausamkeit, alle Zärtlichkeit und hilfsbedürftiges, schmeichelndes Sich-Schmiegen Witz und Angst und furchtloses Zuschauen, — in der souveränen Subjektivität der Kinderwelt hüllt es magisch die Grenzen einer objektiven Wirklichkeit in sein dichtes, dämonisch glühendes Gewölk. Wer aber könnte alle Urbilder möglichen Gebarens, die in uns schlummern, in sich erwecken? wer dürfte sie in der Gemeinschaft der Erwachsenen, in der Lebensordnung seiner Gesellschaft realisieren? Darum erfanden die Völker in frühern Zeiten zu Spielen, in denen Drang sich ausgeben darf und doch durch Regeln gebändigt ist, die großen Feste in ihrem Gepränge und Überschwang, in ihren eigentümlichen Bräuchen. Mit der zeitweisen Aufhebung strengster Moralvorschriften, mit der Verkehrung ihrer Grenzen und Zäune in Wege und Tore, daß erlaubt, ja geboten ward, was sonst verpönt hieß, schufen sie die Ergänzungen zu dem, was die Gemeinschaft des Alltags versagen muß, soll sie nicht in Stücke gehen und alle mit ihr.
Wieviel bleibt durch die gemeinschaftliche Lebensordnung in jedem gestaut, denn jede Lebenskraft (schakti) in jedem könnte sich maßlos ausleben, wollte sie ihrem Wesen genügen, das Allheit ist. Auch der Narr will einmal König sein, und auch die gesalbte Majestät verlangt es, einmal den Narren zu spielen. Harun al Raschid und sein Vezir mischen sich verkleidet unter das Volk, unter Lastträger, Fischer und Negersklaven, es verlangt sie, das Gemeine und Vermischte zu kosten, das dem Beherrscher der Gläubigen auf seinem Throne nicht nahe kommen darf. Die Dauphine Marie Antoinette fährt aus der hoheitlichen Abgeschlossenheit des Parkes von Versailles verlarvt zum Karneval nach Paris. Auch dem keuschesten Gemüt haucht in einer lauen Nacht ein glühender Atem Wünsche und Bilder ein, vor deren Zuchtlosigkeit es in Grauen erstarrt; von einem Fremdesten fühlt es sich ganz beschmutzt, — aber es quoll wie aus seinem eigensten Inneren herauf. So will es die unerbittliche Schakti in uns, deren Wesen ist, sich grenzenlos zu allen Lebensgestalten und Gebärden des Verhaltens auszugebären.
Das faßt uns vor jenen Holzschnitten und Stichen Hans Bal-dung Griens und des Hausbuch-Meisters, die den greisen Aristote-les zeigen: Die Buhlerin Phyllis reitet auf ihm, nackt auf dem nack-ten, mit der Peitsche streicht sie seine verblühten Lenden und reißt ihn am Zaum in seinem Munde, — diesem Munde, der, als er jung war, dem göttlichen Platon Rede stand und dessen Worten nachmals der welterobernde Alexander ehrfürchtig lauschte. Der große Weise, dieses erzieherische Musterexemplar des auf zwei Beinen aufrecht schreitenden Homo sapiens, — da rutscht er auf allen Vieren einher; ein Etwas in ihm verlangt danach, alledem abzu-danken, wodurch er sich selbst vor der Welt und dem eigenen Auge groß und vorbildlich gemacht hat. Etwas in ihm, das er nie hatte aufkommen lassen, das ihm nie bewußt ward, — «Eros, unbesiegter im Kampf», nennen es die thebanischen Mädchen bei Sophokles, — das verkrüppelt in ihm geblieben war und darum bös geworden, vom Antlitz zur Fratze, vom Reinen zum Schmutz verwandelt, — einmal stieg es denn doch herauf und ergriff die Herrschaft und nahm dämonisch grausame Rache an ihm.
Oder was war es mit Nebukadnezar, dem großen Könige, der da sprach, «das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum könig-lichen Hause durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit» — es war wohl noch etwas anderes in dem gewaltigen König als Macht und Herrlichkeit und der Trieb, diese beiden grenzenlos auszuleben. Ungefähr das Gegenteil war auch in ihm, aber es kam nicht zu Wort unter der ehernen Notwendigkeit seines Loses, immer ein großer König zu sein, immer größer als alle Könige ringsum. Indem er aber so große Reden führte, «fiel eine Stimme vom Himmel» — und fiel ihm ins Wort: «dein Königreich soll dir genommen werden; und man wird dich von den Menschen ver-stoßen und sollst bei den Tieren bleiben, so auf dem Felde gehen; Gras wird man dich essen lassen wie Ochsen, bis daß über dir sieben Zeiten um sind ...» Und so geschah es ihm, er «ward verstoßen von den Menschen hinweg, und er aß Gras wie Ochsen, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und ward naß, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlersfedern und seine Nägel wie Vogelsklauen wurden». Sieben Jahre lang vergaß Nebukadnezar seiner Herrlichkeit und lebte wie ein Tier auf der Weide. Eine Stimme, die stärker war als alle seine Macht und Größe, zwang ihn dazu. Es heißt nicht, daß er dabei unglücklich war. Er galt bloß für verrückt. Darum ward er von den Menschen ausgewiesen zu den Tieren, die lebten wie er. Es scheint nicht einmal, daß ihm dieser Zustand schlecht bekam, denn er erzählt, «nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf gen Himmel und kam wieder zur Vernunft ... zur selbigen Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinen königlichen Ehren, zu meiner Herrlichkeit und zu meiner Gestalt. Und meine Räte und Gewaltigen suchten mich, und ward wieder in mein Königreich gesetzt, und ich überkam noch größere Herrlichkeit».
Verwandelt und erfrischt, ein Größerer noch, kehrt der König aus seinem Rückschreiten ins Tier zur höchsten Würde zurück. In der Abdankung aller Königs- und Menschenwürde lag die Möglich-keit verborgen, mit beiden in einem umfassenderen Sinne neu belehnt zu werden. Als er zum Tier ward, verschwand Nebukadnezar für die Menschen, ihnen war es, als wäre er gestorben. Er war weniger als sein Schatten; kein Schatten seiner Hoheit lag mehr auf ihm, seine «Gestalt» sogar schien von ihm genommen wie sein Dia¬dem. Sein Gang ins Tier und wieder hervor war wirklich wie ein Gang ins Schattenreich und über die Schwelle der Proserpina, wie der antike Adept in den Mysterien der Isis ihn wandelt, und wie ein Eingeweihter kam er auch als ein Verwandelter zurück. Ihn trug ein neues Wissen und ein neues Gleichgewicht.
Ehe er ein Tier ward, hatte Nebukadnezar das herrscherliche Ich, als das er sich bewußt war, zur allbeherrschenden Funktion in sich gesteigert; er konnte sich in seinem Lebenslose des orienta¬lischen Despoten eines großen Reiches wohl nur behaupten, wenn er Herrlichkeit und Macht über die große Babel mit umklammerndem Griff in seinen Händen preßte; diese Gebärde, immer sich steigernd, war es, aus der er lebte. In diesem Krampfe, ihm nahe¬gelegt von seiner Situation wie seiner Natur, lag die Drohung, das innere Gleichgewicht zu verlieren und nur mehr dieses Eine, dieses herrscherliche Ich zu sein und nicht alles, was die Schakti in uns als unbewußte Fülle aller Möglichkeiten in sich trägt. Und eine völlig mißachtete, nie gelebte Seite seines Wesens, die im Unbewussten abgesunken blieb, mußte einmal, das Gleichgewicht der Ganzheit wiederherzustellen, so völlig und rücksichtslos die Herrschaft über Nebukadnezar an sich reißen, wie vordem die herrscherliche Idee. Darum ward er wie ein Tier.
Aber er erkannte die Gewalt, die ihn niederwarf und so verwandelte; er nannte sie Gott: «nach dieser Zeit hob ich, Nebukad-nezar, meine Augen auf gen Himmel und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, so ewiglich lebt, des Gewalt ewig ist und des Reich für und für währet; gegen welchen alle, so auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht's wie er will, mit beiden: mit den Kräften im Himmel und mit denen, so auf Erden wohnen; und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen: ,was machst du ?'» — Er nannte den Regenten in uns, der solches alles an uns wirken kann, den «König des Himmels» und schloß die Erzählung seiner wunderbaren Wandlung, die im Buche Daniel aufgezeichnet steht, mit den Worten, «darum lobe ich, Nebukadnezar, und ehre und preise den König des Himmels; denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen».
Was Nebukadnezar am Himmel des Makrokosmos fand, das fühlt der Adept des Tantra-Yoga sich leiblich innewohnen in der Tiefe seines Mikrokosmos und nennt es, wie der König von Babel, «Gott». Ihm weiht er sich in innerer Verehrung und ruft es auf in einer der zahllosen Möglichkeiten, in denen es Gestalt annehmen kann. Damit will er es sich bewußt machen, denn nur als ein Ge-staltiges kann etwas uns ins Bewußtsein treten, für unser Bewusstsein dasein. Die göttliche Erscheinungsform des Unbewußten, die er heraufruft, schmückt er mit allem Reiz, aller Hoheit und allen Kräften; so verehrt er sie geziemend samt der allgestaltig-allgewaltigen formlosen Macht, die sich in ihr verleibt. Damit strömt er zugleich alle Möglichkeiten, Reiz, Hoheit und Größe als die Dämonie seines eigenen Wesens aus sich zu gebären und nach ihren Gestalten im Raume zu greifen und sie dämonisch an sich zu rei¬ßen, aus sich empor und formt sie zu Schmuck und Ausdruck der göttlichen Gestalt. Anstatt nach außen in die Welt, projiziert er auf die innere Gottheit alle unbewußten Möglichkeiten seiner Lebenskraft, die seine menschliche Lebenssituation ja nur ganz schattenhaft, nur in Bruchteilen ihm auszuleben erlaubt. Denn diese Möglichkeiten sind unendlich in ihrer Dimension, unersättlich in ihrem Drang, gemessen an der schmalen Situation der meisten Menschenleben. Er projiziert sie alle auf das Götterbild als dessen Reiz und Größe, — so zerreißen sie ihn nicht in ihrem Ausbruch, so verkehren sie sich nicht in ein Böses, Teuflisches, wenn sie verdrängt gehalten werden. Aus der Gefahr, ins Unbewußte abgedrängt zu bleiben, ungelebt zur bösen Fratze zu verkümmern, werden sie erlöst, heraufgeholt und umgeformt zur Substanz und zum Geschmeide der innerlich sichtbaren Gottheit des Herzens. Auf ihr Bild werden sie alle projiziert und abgeladen in der Haltung gläubiger Hingabe (bhakti), die dem Ich der Person dabei abdankt und zur Gottheit spricht: «Du bist mein wahres Wesen, — nicht ich. Nicht ich bin's, Du bist es, der diesen Kosmos meiner Per¬son und Welt wirkt. Alles ist Dein.»
In dieser Haltung dankt der Fromme seinem bewußten Ich ab und gibt sich gläubig ganz dem Unbewußten in ihm selbst anheim, dem Regenten in uns. So vermeidet er das Heer der Gefahren, das in uns selbst, in uns allein lauert, — die Legionen der Hölle, die aus uns brechen können, deren spielende Gewalt aus dem Bilde des Aristoteles und Nebukadnezar auf allen Vieren mit einer kleinen sinnfälligen Geste zu uns spricht.
Die zahllosen Erscheinungsformen des Göttlichen als Götter und Göttinnen, hoheitsvoll und in Jugendreiz, majestätisch-gelassen oder grimmig drohend, und alle Heere des Dämonischen, — alle tun als Vorbilder von außen dem inneren Reichtum der Lebenskraft, der Schakti, Genüge. Sie entsprechen den zahllosen Grundgebärden und elementaren Möglichkeiten des Unbewußten im Frommen, sich zu dieser oder jener Haltung auszugebären. Diese Möglichkeiten sind im einzelnen menschlichen Typus in verschiedener Stärke angelegt, keimhaft ungleich ausgeprägt. Wir haben den Samen zu allem in uns, aber nicht alles wird keimen und aufschießen, viele Früchte, die unser Garten tragen könnte, werden niemals reif. Aber was unter allem keimhaft in uns Angelegten so geartet ist, daß es wirklich keimen kann, — was an uns keine vage, sondern aktuelle Möglichkeit uns zu gebaren, ist, das bildet eigentlich den Typus an uns, der anderem widerstrebt oder wahlverwandt ist. Typus, Temperament und Lebensalter, dazu Gewöhnung halten uns spontan in der Nähe der einen oder anderen Aus¬prägung des Göttlichen oder Dämonischen; die in uns keimbereiten Möglichkeiten sind dem einen oder anderen Vorbild aus Mythos und Geschichte wahlverwandt.
Darum gehört es zur Weisheit des geistlichen Lehrers, der den formbegierigen Drang der unbewußten Lebenskräfte in uns lenken will, daß er ihnen dämonische Vorbilder verbiete und andere ihnen fernhalte, die ihnen nicht gemäß sind, ein wahlverwandtes aber darbiete in Observanz und Kult, auf daß sie sich darauf fixieren und sich darein verwandeln. Manchem weiblichen Gemüt innerhalb der katholischen Christenheit ist die heilige Anna im geheimen nahe, und wenn ihr Vorbild dem formbegierigen Drange des Unbewußten geboten wird, kann er seine Entsprechung innen hervorbringen, daß sie den Menschen forme und leite; der Fromme kann von ihr lernen, wie das Kind von der Jamburi, und die gestaltträchtigen Urwasser des Unbewußten kosmogonisch zu ihrem Wesen ausgebären. Anderen bietet die heilige Agnes oder die heilige Magdalena ein Gleiches; der Jugend reicht man gern den hei-ligen Aloysius als Vorbild. Franziskus und Ignatius, der Bräutigam der Armut und der Soldat Christi, schließen einander aus als Leit-bilder zur Selbstverwandlung und Auskristallisation der aus sich selbst strömenden, mit sich selbst übersättigten Schakti; so schließen einander Vischnu und Schiva aus als zwei verschiedene höchste Aspekte des göttlichen Allwesens, und, auf mittlerer Ebene göttlicher Gestalt, der elefantenköpfige reisbäuchige Ganescha, der Gott bäuerlicher Wohlfahrt, und sein Geschwister, der geschmeidige Knabe Kriegsgott, der sieben Tage nach seiner Geburt die Welt von einem Dämon befreite, welcher alle Götter aus ihren Ämtern gestürzt und tyrannisches Wirrsal über die Welt gebracht hatte. Wie Sâvitri das Ideal aufopfernder Gattenliebe darstellt, der Liebe, die dem Tode trotzt, wie Yamuna höchste Liebe zwischen Geschwistern verkörpert und Jamburi die Kraft, allem gewachsen zu sein, so verkörpern alle Urbilder des Unbewußten in Mythos und Kult eine spezifische Haltung und Gebärde des Menschen in idealer Reinheit. Hier findet sich in sinnbildlichen Gestalten alles Lautere und alles Dämonische zusammen: alles Grauen und aller Unflat, aber auch alle erzengelgleiche Gewalt des Hohen, die den Schlüssel zum Abgrund und die große Kette in Händen führt, mit denen sie Satan bändigt.
In den Buddha's und Bodhisattva's stellt sich die durch-schauende Erkenntnis dar als eine höchste Möglichkeit der Schakti in uns, wenn sie ihr Aggregat von verwölkender Leidenschaft und animalischer Dumpfheit ganz geläutert hat und das naturhafte Walten ihrer eigenen Wut zu überwinden vermag, indem sie, rast¬los sich ausgebärend, sich als ihre gestaltige Welt nach außen projiziert; — in dieser Erkenntnis stellt sich das Wunder ihrer Umkehr in sich selber dar, den eigenen Drang zu stillen, der mit Projektion ihrer formbegierigen Kräfte als Maya grenzenlos spielt und den Prozeß ihrer Welt im Schwunge hält. In ihnen verkörpert sich das erhabene Erbarmen, das alle Welt von sich als Welt, als ständig aufschießendem Produkt dieser weltschaffenden Potenz er¬lösen will, — das Erbarmen, das die Welt vom Banne ihrer selbst befreien will, in dem sie sich mit Lust und Qual herumwirft wie ein Träumer in Schlafes Bann, den lockende und fürchterliche Ge¬sichte in atemberaubender Fülle bedrängen.
Alle Figuren, die in Kult und Mythos leben, sind solche leib-haften Ideen; als Varianten von Urbildern, die in uns schlummern, können sie je nach unserer Anlage und Schicksalssituation uns Vorbilder werden zum Guten und Schlimmen. Aber wir können nicht frei wählen: Etwa Indisches für uns und Christliches für den Osten, — da liegt die Klippe für alle Mission und Aneignung, — denn unser westliches Unbewußtes enthält dasselbe Urbild wie das östliche in einer anderen Variante ausgeformt. Wir sind kleine Blüten am alten Baum des Westens, in unserem Unbewußten drängt sein Saft zum Licht, — was er in sinnbildlichen Varianten keimhaft in sich trägt und ausgebären kann, ist seine besondere Art. Das bezeichnet unsere Ferne schon zu den mythischen Gestalten der Griechen, bei aller werbenden Liebe, aller sich schmiegenden Nähe des Humanismus zu der Welt der Alten. Im griechischen wie im deutschen Mythos gibt es den zauberkundigen Schmied, den wunderbaren Techniker: Dädalus hier, Wieland bei uns. Das alte Wunder, daß der Mensch erfand, aus starrem Fels das flüssige Metall zu schmelzen und es in alle Gestalt zu gießen, schuf einen neuen Weltstand. Etwas völlig Dämonisches war da am Werke: das Härteste ward bezwungen durch die Glut, ward wie Wasser und ließ sich doch ballen. Der Stein, Waffe und Werkzeug einer Weltzeit, gab aus dem eigenen Schoße seinen vielgestaltigen Über¬winder frei. Das Wunder dieser prometheischen Tat senkte sich ins Unbewußte der Menschen: in der Gestalt des mythischen Schmiedes, des Magiers der Erze, — davon hat sein Beruf noch heute einen magischen Schimmer (in England der Schmied von Gretna Green, vor dem man Ehen schließt). Aber wie verschieden ist diese Hieroglyphe vom kollektiven Unbewußten griechischer und deutscher Überlieferung gestaltet. Der mythische Schmied löst die Menschen aus dem Gefängnis des Steinzeitalters, so löst er sich selbst aus der Haft des Königs, der ihn fronden läßt. Er gewinnt die unendliche Weite einer neuen Menschenzeit; auf den Flügeln, die er sich schuf, entfliegt er himmelauf. Wie tragisch ist die neue Freiheit bei den Griechen: die Flügel, die Ikarus und Dadalus erlösen, bringen Ikarus den frühen Tod. Der vogelgleich Ätherische, Euphorions Bruder im Geiste, hob sich, vom Geist des neuen Weltalters getragen, zu stürmisch der Sonne entgegen und fand den Tod im Meer. Der Vater zahlte für seine titanische Erfinderkraft mit dem schwersten Opfer: sein anderes Ich, den Sohn, seine wiedergeborene Zukunft, mußte er dafür drangeben. Das Erschauern des Griechen vor dem Maßlosen der neuen Möglichkeit, vor dem Titanischen der Naturbezwingung und Verstörung stei¬nern alter Ordnung fand in dieser Buße den Ausgleich mit den Mächten, die der technische Magier vergewaltigt hatte.
Daneben Dädalus' dunkler Bruder Wieland, der dumpfe Rächer seiner Gefangenschaft, dem der König die Sehnen seiner Füße zerschneiden ließ, daß ihm der Wundermann nicht auskäme; — auch seine glückhafte Flucht muß schuldloses Leben mit dem Tode bezahlen. Aber nicht das Pathos eines Fluges in die Sonne vergoldet das Dunkel. Die abgeschlagenen Häupter der beiden Königsknaben, die sich verlangend über Wielands Schatz beugen, die Schändung der Königstochter, die mit dem zerbrochenen Goldreif seiner Geliebten zum Schmiede kam und die er betrunken machte, sie zu schänden, — diese maßlose Rache, die den König in seinem Liebsten trifft, seinem zweiten Leben, seiner Zukunft, die aus Hirnschalen, Augen und Zähnen der Knaben Schmuck und Gerät gestaltet und dem König einen Bastard vermacht, webt beklem¬mend und boshaft um die dämonische Gestalt des magischen Erfinders. Wie das kollektive Unbewußte beider Kulturen durch ganz verschiedenes Kolorit sich eigene Varianten derselben Urfigur sti¬lisiert, sie über die Zeiten erinnert in Dichtungen und Überlieferung, das spiegelt den tiefen Unterschied zwischen den Hellenen und der Nacht des Nordens.
Im Mythos vieler Kulturen gibt es die Gestalt des wunderbaren Sängers und Musikanten, der zauberische Kräfte hat. In ihm hat die magische Gewalt der Musik, die wie nichts anderes unmittelbar ins Unbewußte greift und es erregt und sänftigen kann, ihren sinn¬bildlichen Niederschlag im Zeichenschatz des kollektiven Unbewussten gefunden. In Indien ist es Krischna, der menschgewordene Allgott Vischnu, der mit einem Bruchteil seines unendlichen We¬sens in die Welt hinabgestiegen ist, um sie von der Tyrannei der Dämonen zu befreien, die sich in menschliche Gewaltherrscher verlarvt haben. Wie Zeus als Bringer eines neuen Weltstandes geweissagt, wie Zeus schon im Mutterleibe verfolgt, aber wunderbar geborgen, wächst er unerkannt bei Hirten und Herden auf, bis die Stunde reif ist zur weltordnenden Heilstat. Als Knabe bezwingt er inzwischen Dämonen der Wildnis, die das Idyll der Hirten verstö¬ren und dem Jugendlichen den Garaus machen sollen, ehe er her¬angewachsen ist. Halb Knabe noch und schon Mann ist er die ver¬zaubernde Lieblichkeit selbst; Hirtenfrauen und -mädchen vergöttern ihn. Im Spiel und Tanz der mondhellen Nächte gibt er ihnen einen Vorgeschmack der himmlischen Freude, mit ihm in seinem Paradiese vereint zu sein. Er singt und tanzt mit ihnen und führt den herbstlichen Reigen an; mit dem Pfeil seiner Blicke ihr Herz versehrend, weiht er sie in die Geheimnisse des Eros ein, — des Eros, der dem Leben huldigt und der mit Gott vereint. Dazu bläst er die Flöte, — ein Rattenfänger der Frauenherzen; verführerisch in seinem Schmelz. Alle Herzen fliegen ihm zu und hangen an ihm in schmerzhafter Süße. Ein Rattenfänger, — aber wie verschieden von seinem dunklen Bruder der Hamelner Stadtsage, dieser deutschen Variante des magischen Musikanten.
Die Dämonie der Musik, — bei uns Deutschen ist's ein herge-laufener Pfeifer, der zum schlechten fahrenden Volk gehört, eine dunkle bedenkliche Erscheinung von anrüchiger Herkunft. Aber ebendarum ist er im Bunde mit den Mächten, die der ehrenhafte Bürger, der wohlbehauste selbstgerechte Besitzende hinter Mauern und Türmen übermächtig um sich fühlt und nicht zu bannen ver¬mag. Er ist der wahlverwandte Meister des Unheimlichen, er befreit die Stadt von der eklen Rattenplage, in der sie umzukommen droht. Diese Ratten, — das unreine, bösartige und gefährliche Tier, gemein wie kein anderes, aber dabei der Hausgenosse des Menschen, sich mästend von seinem Unrat und Wegwurf, — welch geniales Symbol des Unbewußten. Der unheimliche Musikant be¬freit die Stadt von ihrer selbstverschuldeten Plage, von dieser lebendig gewordenen, wimmelnden, um sich beißenden Gewalt ihres eigenen Unrats, von den Dämonen ihres eigenen Schmutzes in jedem Betracht. Aber was hilft's? — daß sie diesen Schmutz aus ihrer Ehrbarkeit und wohlverschanzten Selbstgerechtigkeit hervorbringt und immer neu in sich häufen muß, — von diesem ihrem Wesen kann er sie nicht erlösen. Den Augiasstall der Seele räumt uns kein Hergelaufener aus, und wär' es Herakles; den Schmutz der Seele auszukehren, müssen wir schon selbst Hand anlegen, — und der schwärzeste Schmutz in ihr ist der Undank. Daher die Strafe an der undankbaren Stadt, die den hergelaufenen Pfeifer, den rechtlosen Vaganten um den ausbedungenen Lohn meint prellen zu dürfen, ihr wird das Leben in die Zukunft, — Hoffnung und Unschuld, die auch am gemeinen Menschen wunderbar vorhanden sind, die Verheißung der lebendigen Ewigkeit werden ihr genommen: der Pfeifer lockt die Kinder, und sie müssen mit ihm ziehen wie die Ratten. Ein grauenhaftes Strafgericht, so erbarmungslos wie gerecht, — ein Pfeil, der unerbittlich ins Schwarze trifft. Und welch ein unheimliches Unbewußtes, das solche Pfeile sich selbst ins Schwarze schießt. Wie fern ist das dem Volk, bei dem der zauberische Musikant mit seinem Sang und Saitenspiel alle Natur aus dem Banne ihrer dumpfen Schwere, ihrer Angst und Wut erlöst, zu Orpheus' ätherischer Weise heben sich die in Wildnis durcheinandergeworfenen Felsblöcke auf, ihr Rhythmus setzt sie in Gang, ihre Harmonie fügt sie zu Mauern und Stiegen, zu Palast und Tor, Burg und Tempel (denn «Harmonie» meint «ebenmäßige Fügung») . Und alle Tiere vergessen ihrer angeborenen Natur, das Reißende und das Verängstete in ihnen löst sich, sie scharen sich um den Sanger, dessen Harmonien das Widerstreitende sänftigend zueinanderfügen, auf dessen heiligen Namen das alte Griechenland seine geheimen Lehren taufte, wie der Mensch sich wandle zum Vollendeten und das Ewige in sich ge¬wönne. Die dämonischen Kräfte, die sich selbst zerreißen, rasen verzweifelt ob ihrer Ohnmacht. Wenn sie den Magier seelenführender Musik, die das Dämonische bändigt, schließlich anfallen und zerreißen, müssen sie sich taub machen mit wahnwitzigem Gebrüll und Lärmen, daß sie die himmlische Stimme und sein Spiel nicht vernehmen; sonst wären sie gezwungen, ihrem Wesen abzudanken und friedfertig zu sein und voll innerer Harmonie wie sein Gesang.
Der Gläubige lebt aus den Urbildern, die Ritus und Mythos ihm im Schatze der ihnen jeweils eigenen Varianten als Leitbilder be¬reithalten. Wen keine Glaubensgemeinschaft mehr umfängt, die noch Ritus und Mythos besitzt, dem treten leitend die Dichter zur Seite. Der seltene wahre Dichter ist wie Priester und Guru Schatz-walter der Urbilder des kollektiven Unbewußten seiner Kultur. Nicht Erfinden, aber Wiederfinden und Beleben ist sein Amt. Ihn scheidet vom weltweiten Schriftsteller, daß er den zeitlosen Genien dient und ihr Bild über die Zeiten für die seine erneuert. Der Schriftsteller greift von der Straße auf, was seine Zeit und nur sie bewegt; so gehen seine Gebilde mit ihr dahin in die Totenkammer des schlechthin Gewesenen, fristen ein Scheindasein im Wachs-figurenkabinett der Literaturgeschichte. Schrifttum, das nicht zu den Urbildern, geprägt von kollektiver Erfahrung, hinabreicht, hat seinen Welthorizont im Sozialen und stirbt an seinem Wandel ab; mit ihm wird es belanglos. Notwendigerweise ist es offen oder geheim ironisch und untragisch, denn daß das Soziale die alles um¬fassende Sphäre sei der Kräfte, die über uns bestimmen, die we¬sentlich über unser Schicksal entscheiden, — das ist von der Ebene unseres tieferen Selbst, vom zeit- und todlosen Unbewußten her, eine große Ironie, ein gewaltiger Humbug. Der Gläubige weiß es anders, — so auch, wer auf den Regenten innen zu lauschen weiß. Daher der ironische Charakter der «Madame Bovary» und des gan¬zen sozialen Romans im 19. Jahrhundert, daher die reine Dreidimensionalität des sozialen und psychologischen Romans über¬haupt. Sein Pathos kann nur darin liegen, daß er kritisch ist und kämpferisch für eine bessere soziale Wirklichkeit, z. B. bei Zola. Balzac bleibt dreidimensional, das ist seine Größe und Grenze, und eben diese Grenze wird so fühlbar, wenn der Gigant in ihm, im Wunsche sie zu überschreiten, an sie stößt. Sein Versuch, die vierte Dimension, das Reich der Geister, Engel und Dämonen einzubeziehene (in «Séraphita» und «La Recherche de l'Absolu»), ist schon unangenehm in der Naivität, mit der zum Stoff gewählt ist, was nur Raum und Stil des Geschehens sein darf. Es gibt kein Ding, das diese Dimension enthielte, daß man nur nach ihm zu langen brauchte, sie ist an keinen Gegenstand gebunden, kann sich aber an jedem als Stil enthüllen, — etwa in Goethes Märchen von der «Neuen Melusine» oder in seiner «Novelle».
Christus und Buddha sind als Urbilder ins westliche und öst-liche Unbewußte eingegangen; ihr geschichtliches Leben hatte solche Gewalt, daß sie als eine Variante, Neuprägung und Ent-wicklung sich auf ein schon vorhandenes Bild im Unbewußten legten. Es bezeichnet ihren geschichtlichen Rang, daß sie in ältere, schon bereite Urbildformen eingehen konnten, die sie ersetzten und zu sich verwandelten —: Christus in die altorientalische Gestalt
des sterbenden, geopferten und wiederauferstehenden Jahresgottes, Buddha in den altindischen Sonnengott. Weil sie aus eigener Kraft so hohen Rang besassen, daß keine geringeren Formen als diese hohen alten ihnen Genüge taten, in ihrer Schale sie über die Zeiten zu bewahren, haben sie die weltgeschichtliche Funktion, das Unbewußte zeitlos weit zu inspirieren, die Funktion, mit ihrem äußeren Bild ihr inneres in uns anzurühren wie mit magisch leben-spendendem Finger und aus dem Schlafe der Tiefe zu wecken, daß es uns leite und zu sich verwandle. Durch ihre Verschmelzung mit den älteren Urbildern vollzog das Unbewußte die feierliche Auf¬fahrt ihrer geschichtlichen Erscheinung in die Ewigkeit der Sinnbilder, es versetzte sie unter die Gestirne am inneren Nachthimmel der Seelen.
Die gelehrte Frage, ob Christus oder Buddha geschichtliche Gestalten waren oder «nur» Abspaltungen eines mythischen Figurkomplexes in die historische Ebene, verliert unter dieser Perspek-tive ihr Relief; daß diese beiden von der Historie überlieferten Gestalten so allgewaltig mythisch werden konnten, zeugt für ihre geschichtliche Realität. Mit Erfundenem und Gespinsten läßt sich das Unbewußte nicht speisen; formgierig bemächtigte es sich ihrer Erscheinung als einer seltenen Möglichkeit, ein Urbild in sich um-und auszuprägen, Unendliches von Wirkungen und Kräften hängte sich an ihre Gestalt, ausgehend und in sie strömend, um sie kreisend. Darum sind sie allein ja lebendig, unsterblich, indes die Men¬schen der Jahrtausende von ihnen zu uns fast alle ganz verschollen sind und kaum ein Name weitertönt. Dank dieser höchsten Lebendigkeit, die das Unbewußte ihm zuerkannte, heißt Jesus Gottes Sohn, wie Herakles den Griechen um der gleichen Kraft willen zum Sohne des Zeus ward und Krischna den Indern zu einem menschgewordenen Stück des Allgotts. Diesen Christus in uns, und nur in uns, in keinem Himmel über Himmeln, zu verehren, uns mit ihm zu durchdringen, indem wir seine ungeheure Möglichkeit als unsere persönlichste, in uns angelegte Wirklichkeit ausbilden durch Erweckung seiner inneren Gegenwart, das wäre wirklich «Nachfolge Christi», das wäre — in Vertrauen auf die Gnade, das heißt: im Glauben daran, daß er wirklich in uns schlummert und in uns aufstehen kann — ein christlicher bhakti-yoga.
In der vollen Entfaltung seiner Lehre zum «Großen Fahrzeug» (Mahâyäna) geht der Buddhismus soweit, die geschichtliche Wirklichkeit seines Gründers zu leugnen. Es hat nie einen Buddha ge-geben, freilich auch nie einen Orden, niemals einen Buddhismus, — so sprechen die Mönche, die sein Gewand tragen, in seinen Klöstern leben und Buddhabilder den Frommen zur Verehrung in ihren Mauern bereithalten. An solche Dinge glauben Weltkinder. — Damit wird der mönchische Adept des buddhistischen Yoga im Paradoxon gelehrt, sich von allem Raum-Zeitlichen, Benennbaren und Gestalthaften zu lösen, das er außer sich wähnen mag und woran er haftet, wenn seine Schakti sich noch in Ehrfurcht auf einen gewesenen Buddha projiziert. Gäbe es einen Buddha als letzte Realität, geschichtlich einmal auf Erden weilend oder ewig in irgendeinem Überhimmel, auf den der gläubige Laie hofft, — dann wäre auch das Ich eine letzte Realität. Es gilt aber gerade zu durchschauen, daß es nur eine rein phänomenale Ausgeburt des ungreifbaren Namenlosen ist, ein Phantasma, rein bedingt durch den Drang, mit dem es an sich selber haftet; — das gilt es zu erfahren, zu vollziehen.
Für das tiefere Unbewußte existiert nichts real Geschehenes, keine Geschichte, nur Sinnbilder, die es aus allem Geschehenden bewahrt; es erinnert keine einzelne Welle, aber alle Figur, die Wellen haben können. Der Buddhismus spricht aus der Ebene dieses Unbewußten, wenn er lehrhaft betont, nie sei ein Buddha gewesen. Der Adept seines Yoga gibt sich verehrend einem reinen Sinnbild hin, in dem Wissen: der persönlich-geschichtliche Ursprung dieses Bildes sei in seiner Realität so wesenlos wie das eigene Ich, das nur bedingt ist durch die eigene Unvollkommenheit. Aber dieses Sinn¬bild einziger Vollkommenheit, der Buddha, dient ihm dazu, die ver¬borgene Buddhaschaft in sich, die einzige Wirklichkeit zu wecken. Die Form alles Bewahrens ist für das Unbewußte das mythische Sinnbild. Darum lehrt es, Buddha werden, obwohl es keinen geschichtlichen Buddha, nichts Geschichtliches anerkennt. An aller Individuation, die es durchläuft und als wechselndes Phänomen an sich hervorbringt, — welkende Blüte an immergrünem Laube, — bewahrt es nur, was über das ephemer Geschichtliche ins zeitlos Sinnbildliche, ihm Gemäße, hineinragt. Darum ist der Weg des buddhistischen Yogin ganz voll sinnbildlicher Taten: Opfer ohne Maß wollen als sinnbildliche Gesten des Nicht-Haftens an irgend etwas vollbracht werden. Der Werdende Buddha (Bodhisattva) soll lernen, in sich selbst und in jeder Situation, in die er sich auf¬opfernd sich verflicht, zu stehen wie das tiefe Unbewußte in uns steht: nicht an uns haftend, nicht gebannt durch seine eigene Geste an Ich und Welt; — zu wesen wie das Unbewußte: zeit- und todlos, unanrührbar. Wir sind nichts Einfaches, und die Zweiheit «Leib—Seele» drückt unser Wesen nicht aus. Wie vielfältig sich die Alten das Wesen des Menschen dachten, lehrt ein antiker Vers, der davon handelt, wie es sich im Tode scheidet,
«Terra tegit carnem, tumulum circumvolat umbra, orcus habet manes, spiritus astra petit.» «Erde bedeckt das Fleisch, den Hügel umschwebet der Schatten, Seele sinkt unterweltwärts, sternenauf hebt sich der Geist.» Die Vorstellung, daß die Seele als Lebensprinzip etwas einfaches sei, ist eine späte und schon wieder vergangene Meinung; die alten Ägypter und viele «Naturvölker» haben es anders ge-wußt, ein besonders vielgliedriges und beziehungsreiches Bild hat das alte China entwickelt. «Der Mensch besteht aus den wirkenden Kräften Himmels und der Erde», heißt es im Buche Li-Ki, «er besteht aus der Vereinigung eines Kwei und eines Schen.» Kwei und Schen sind die zahllosen lebendigfeinsten Teilchen der unendlichen Kräfte der Erde und des Himmels, des Yin und des Yang; «der Odem ist die gesammelte Äußerung des Schen, und die ,Leibes seele' ist die gesammelte Äußerung des Kwei. Die Vereinigung von Kwei und Schen ist die höchste der Lehren. Alle lebenden Wesen müssen sterben; gestorben müssen sie zur Erde heimkeh¬ren, das nennt man Kwei. Knochen und Fleisch verfaulen unten im Grunde, geheimnisvoll werden sie Erde der Felder; aber der Odem hebt sich auf und steigt in die Höhe und wird zu himmlisch strah-lendem Licht (ming) ». Entsteht der Mensch, so entwickelt sich zuerst die «Leibesseele», das Prinzip vegetativer Lebenskraft, die Erscheinungsform von Kwei und Yin, danach entfaltet sich der Anteil des himmlischen Yang, das ist die «Geistseele»; sie wird auch dem Odem gleichgesetzt. In der Berührung mit der äußeren Welt bildet sich die «feinste Kraft», ihr Wachsen kräftigt Leibes-und Geistseele, wie deren Wachstum wieder stärkend auf die «feinste Kraft» zurückwirkt. Und so entwickelt sich schließlich Schen im Menschen, dem Odem und der Geistseele verwandt, das Himmlisch-Geistige, das in sich großzuziehen das Ziel aller ethi-schen und asketischen Erziehung ist. Wer zur Vollendung, zur Ver¬klärung strebt, trachtet, ein reiner Schen zu werden: Kraft vom Himmel, Licht von seinem Lichte («ming» — das Zeichen dafür ist Sonne und Mond beieinander als Inbegriff alles Strahlenden) — diese Läuterung und Erhebung ist der chinesische Gang zur Un-sterblichkeit, der Weg zu göttlichem Sein.
In der Durchdringung von Kwei und Sehen, d. i. von Yin und Yang ist der Mensch ein kleiner Kosmos, denn «das ganze Yin und das ganze Yang heißen Tao», d. i. die im großen Lebensrhyth¬mus der Gezeiten kreisende Welt. Die Leibesseele aber, ein Stück Yin im Menschen, verläßt den Leib niemals, darum wohnt sie mit ihm im Grabe; «sie verläßt das Edelste am stofflichen Teil des Menschen» und ihr wird das Grab mit peinlicher Sorgfalt und ehr-fürchtiger Pflege zur Wohnung bestellt. «Nach dem Tode steigen Leib und Leibesseele in die Erde hinab», — aber mit dem unaufhaltsamen Zerfall des Leibes zerfällt mählich auch die Leibesseele: «Leib und Leibesseele lösen sich auf und schwinden dahin, Geist und Odem behält die Kraft zu fühlen und sich zu bewegen und vergeht nicht.»
Der altchinesische Mensch ist sich einer Vielheit von Lebens-kräften in sich bewußt; seine Weltsicht der kosmischen Kräfte des Männlich-Himmlischen und des Weiblich-Erdhaften, deren Ineinanderspiel die Welt immer neu gestaltig wirkt, gibt ihm den Rahmen und die Anschauungen, zu fassen, was er in sich erfühlt als Spiel und Bestand von Kräften. Uns ist sein schließliches System ein Gleichnis und Hinweis, denn unser Forschen und Fragen, unser vorgebliches Wissen setzt an anderen Punkten ein, an überlieferten und gewonnenen: daß sie so zweifelhaft und vordergründlich sind wie die altchinesischen, kann uns noch nicht deutlich sein. Doch wohnt diesen chinesischen Vorstellungen abseits von ihrer Verknüpfung mit dem kosmischen Dualismus des Tao in Yang und Yin ein ursprünglicher Zauber, eine angeborene Kraft ein: diese Leibesseele, als erstes im Leibe entstehend, an ihn gebunden und mit ihm zergehend, ein Geheimes, das den Toten, wie er da ruht, nicht ganz tot sein läßt, — das rührt nicht bloß an alte, verschüttete Vorstellungen in uns, die Frühere vor uns dachten, und die wir in uns tragen wie Erinnerung als Erbgut unseres Leibes, — das bringt uns ein unmittelbares Empfinden herauf, das wir empfunden haben, immer wenn wir einen gestorben sahen, ob wir es uns eingestehen mögen oder nicht. Und jene «feinste Kraft», Auslese und Essenz der Leibes- und Geistseele («tsing», d. i. eigentlich feinster, «auserlesener» Reis, entsprechend unserem Auszugsmehl) — ein Lauteres, dessen posthumer Name «Himmelslicht» ist, schließt das Höchste in sich, was der Mensch im Westen wie im Osten an die Vorstellung der Seele als Trägerin alles ewigen Schicksals, aller hohen Hoffnungen geknüpft hat.
In seinen tiefgreifenden Bemerkungen «über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen» erörtert Schopen-hauer die antike Lehre vom Daimon, der über das bewußte Ich gesetzt, sein Leben schicksalhaft zu lenken berufen ist; er zitiert Menander, «ein Dämon steht zur Seite jedem Menschen, von der Geburt an ist er ihm ein Führer, ein guter, durchs Geheimnis seines Lebens.»
Wie dieser Dämon und die Seele sich in der Totenwelt zusam-menfinden, um gemeinsam den Gang durch ein neues Leben anzutreten, lehrt Platon in seiner Schilderung des Jenseits, «wenn aber alle Seelen sich ihre Leben erwählt haben, treten sie in der Reihenfolge, nach der sie ihre Lebenslose an sich genommen haben, vor die Parze hin. Diese aber gibt jedem den Dämon, den er sich erwählt hat, als Wächter mit auf den Weg für sein Leben und als den Erfüller der von ihm erwählten Schicksalslose; — nicht erwählt der Dämon euch, aber ihr werdet ihn an euch nehmen.» Diese Lehre von einer Instanz in uns, die mächtiger ist als das Ich und als Regent seinen Gang führt, auch gegen seinen Willen, nach der Notwendigkeit eines vorgewählten Schicksals, blitzt in Senecas Wort auf, «den Willigen führt sein Schicksal, den Widerstrebenden schleift es» — fata volentem ducunt, trahunt nolentem. Der Sternenglaube der Spätantike setzt diesen Dämon, der unseres Schicksals Schlüssel hält und es besser kennt als wir selbst mit unserem bewußten Willen, oben in die Sterne, aus deren Stand der Astrolog unser Schicksal, unser Wesen liest. Schopenhauer bemerkt dazu, «überaus tiefsinnig hat denselben Gedanken Theophrastus Para¬celsus gefaßt, da er sagt, ,damit aber das Fatum wohl erkannt werde, ist es also, daß jeglicher Mensch einen Geist hat, der außerhalb ihm wohnt und setzt seinen Stuhl in die oberen Sterne'».
Es steht uns nicht frei, die großen Zeichen anderer Zeiten und Räume uns anzueignen als unser Eigentum und von uns unmittel¬bar durch sie zu sprechen. Sie sind eine Bilderschrift, die uns aufruft, ein Wirkliches, das immer war, in uns wie je, zu fassen und in neuen Bildern und Begriffen aus ihm zu leben, wenn die Bilderschrift der eignen Herkunft uns blind geworden ist oder so gleich¬nishaft wie jene anderer versinkender Geschichtsräume. Können wir unser geistiges Auge nicht zu Sternen heben, in die unser Regent seinen Stuhl gesetzt hat, so erfahren wir ihn mit Stimmen und Zeichen in unserem Inneren, wie es Sokrates geschah, — und ist die räumliche Angabe hier mehr als ein bildhaftes Element, eine metaphorische Veranschaulichung? wie steht in einem tiefern Betracht Außen zu Innen, Makrokosmos zu Mikrokosmos?
Es ist das Verdienst der neueren Tiefenpsychologie, daß sie in einer Form, die unserer Stunde gemäß ist, das Zeitlose in uns aufgräbt, daß wir es fassen und aus ihm leben können. Nicht als ob sie, und in ihr die Analytische Psychologie, mehr wäre als eine sinn¬bildlich-anschauliche Art, sich über unser Wesen zu verständigen, aus unserer Zeit und Not geboren und mit ihr zerrinnend, aber uns darum verständlich wie keine andere Hieroglyphenschrift; — ge¬rade weil sie das ist: die uns mögliche Form, uns gültig zu klären, wie wir uns geschehen, setzt sie uns in Beziehung zu derselben Wirklichkeit, von der die nachgedunkelte Bilderschrift aller Zeiten in ihren verschiedenen Hieroglyphenreihen zeugt. Sie ist unsere Form, das ungreifbare Wirkliche in uns als ein Benanntes und Gestaltiges zu greifen, ist die besondere Form der Maya, in der das Wirkliche der Seele für uns in unserem geschichtlichen Augenblick Erscheinung werden kann. Alle wesenhafte Lehre ist immer nur Pfeil und Bogen nach dem Wirklichen, das unfaßbar die Sphäre des Geistes und der Sprache übersteigt, aber der Pfeil kann sie berühren und unser Begreifen fliegt auf ihm. Jede Zeit hat andere Pfeile, — manchmal nur einen einzigen.
Die Tiefenpsychologie zerstörte den primitiven Dualismus Leib — Seele, diese vermeintliche schlichte Zweiheit; bei ihr war zweierlei verkannt, — als wäre das Seelische eine Einheit und als wäre der Leib nicht ein Stück der Seele. Die dunkle Flut des Unbewuß-ten, auf der das kleine Schiff des Bewußtseins schwimmt, — eher ein Keim in seinem Fruchtwasser, von ihm gewiegt, von ihm ge-nährt, — ist leibhaft greifbar als die vielfältige Organ- und Zellenwelt unseres Leibes. Mit ihren Leistungen, spontanem Ja und Nein, die Befehl und Verbot des Ich überspringen und seiner Ansprüche spotten in der Betätigung von Fehlleistungen und Versagen, lebt sich nach indischem Empfinden etwas Ungeheures aus. Die Inder nennen es «alle Götter». Denn nach indischer Auffassung sitzen an unserem Leibe alle Götter der Welt als die Kräfte, die sie im Makrokosmos sind. Durch das Zeremonial des Handauflegens (nyâsa) unter innerer Sammlung auf die Wesenheiten der Götter und mit Flüstern der magischen Silben, die sie im Reiche des
Schalls verkörpern, ruft der Adept des Tantra-Yoga sie an sich auf und erweckt sich damit zum Bewußtsein, Inbegriff aller göttlichen Màyà zu sein, die alle Gestalt in Mikro- und Makrokosmos als Spiel der aus ihr differenzierten göttlichen Kräfte entfaltet. So sind die Götter nicht nur am Leibe des Menschen, und sind dieser ganze Leib selbst als Aggregat vielfältiger Kräfte und Funktionen, sie sind auch an allen anderen Leibern, — das ist ein Aspekt der Ein¬heit der Welt, die aus einem fließend lebendigen Stoff, der Schakti des Gottes, vielfältig gestaltet ist.
Die indische Elefantenmedizin (Hastyàyurveda, «das Wissen vom langen Leben der Elefanten») lehrt die Verteilung der viel-fältigen stofflichen Kräfte der Götter (devaguna) am Leibe des Elefanten (III 8) gelegentlich der Lehre vom Embryo, an dem sie sich entfalten: «Brahma ist im Haupte, Indra im Halse, Vischnu im Rumpfe befindlich. Im Nabel (dem Zentrum der Leibeswärme) der Feuergott, der Sonnengott in beiden Augen, Mitra in den Hinterbeinen des Elefanten.» Zwei Aspekte des Weltschöpfers (Dhàtar und Vidhàtar) sind in den beiden Bauchseiten, «im Zeu-gungsliede ist der ,Herr der Ausgeburten' (Prajàpati), in den Eingeweiden (den schlangengleich sich windenden Därmen) sind die Schlangengötter, die das Joch aller Welten tragen. Denn in den Elefanten weilt das alterslose unvergängliche, allem zugrund ein¬wohnende Wesen (pradhàna-àtman). In den Vorderfüßen sind die beiden reitenden Zwillingsgötter» — sie entsprechen den beiden Armen am Menschen, von denen der hantierende Priester im alten Ritual der Veden sagt, «mit den beiden Armen der beiden reitenden Zwillingsgötter greife ich.» — In den Ohren wohnen die Göttinnen der Raumrichtungen, die Walterinnen des Elementes Raum, das in der Muschel des Ohrs sich als Schall einfängt. Der Regen¬gott Parjanya wohnt im Herzen der Elefanten, denn sie sind mythische Geschwister der Regenwolken, ihre Nähe zieht magisch das Wasser ihrer himmlischen Urheimat an. Alle Götter an unserem Leibe, — das bedeutet: Der Leib ist rings besetzt, erfüllt mit Kräften, kraftartigen Individualitäten, die uns nicht untertan sind, sondern die ein eigenwilliges Leben zu führen vermögen. Sonst würde es ja nicht des langen und schwierigen Trainings im Yoga, hoher Willensanspannung und Zähigkeit und ehrfürchtigen Umganges mit diesen Göttern in uns (durch pûjà und nyâsa) bedürfen, um Herr im Hause unseres Leibes zu werden und ihn mählich zu den Betätigungen und Vorgängen zu erziehen, die der Yoga mit seinen Zielsetzungen von ihm fordert. Sie führen ihr Leben unabhängig von uns, werden krank und versagen, ohne uns zu fragen. Wir sind abhängig von ihnen in Furcht und Erwartung, abhängig von zwei Gebärden an ihnen, die in Indien wie in der ganzen Welt die wesentlichsten Gebärden aller Götter sind: die wunschverleihende, gabengewährende (varada) und die Gebärde «fürchte dich nicht!» (abhayada). Sie fehlen kaum an einem indischen Götterbild.
Alles in uns, — wir sind, nach des Dichters Wort «dei gorghi d'ogni abisso, degli astri d'ogni ciel», «aus den Strudeln aller Ab-gründe, von den Sternen aller Himmel», — alle Götter in uns, — wir sind erfüllt von Einem, das mächtiger, unheimlicher und größer ist als wir selbst. Man kann nur suchen, sich gut mit ihm zu stellen, indem man ihm tägliche Aufmerksamkeit entgegenbringt in kultisch verehrendem Umgange. Auf die Regelmäßigkeit des Umgangs kommt es an, sonst entschlüpft das Mächtige uns, vielgestaltig, dunkel, geschmeidig. Es entzieht sich, überrascht und plagt uns mit unerwünschter An- und Abwesenheit, Verlarvung und Drohung. Gegen unsere Bedürfnisse bleibt es aus, wird uns beziehungsfremd, feindlich und koboldhaft, läßt sich nicht mehr ansprechen und erbitten. Durch den täglichen und ehrfürchtigen Umgang mit ihm (dazu gehört sein Wecken vermittelst nyäsa) versichert man sich seiner als nahe und geneigt.
Auf die richtige Form des Umgangs kommt ebensoviel an, denn es ist das Mächtige und Vielgesichtige, Vielgliedrige. In seinem Wald von Händen hält es alles zugleich: alle Waffen des Schutzes und der Rache, unserer Erhaltung wie Vernichtung, Geräte, Schmuck und Blumen — Sinnbilder für alles. Und viele Gesichter zeigt es zugleich, nach allen Seiten blickt es zumal. Wenn sein uns zugekehrtes Gesicht uns lächelt, trägt ein anderes, das es uns gnädig abgewendet vorenthält, die grauenvollen Züge, die uns versteinen. In allen Gebärden spielt es zugleich, in liebender Fürsorge, schreckender Gewalt und weltüberhobenem Gleichmut; das Weibliche und das Männliche, das Lockende und das Mütterliche, das strahlend Heldische und das Hohnlachen der Vernichtung blitzen an ihm auf, darüber die göttliche Ruhe des Jenseits. Alle Tiergestalten in ihrer sprechend sinnbildlichen Gewalt des Dumpfen und Weichen, des Grausamen und Warmen, Reißenden und Sanften sind seine spielenden Facetten.
Der richtige Umgang mit diesem Göttlichen und völlig Dämonischen in uns, mit Erscheinungformen zahllos wie alles Leben, — denn wir sind ja das Leben selbst mit unserem Leibe, — kann nur auf einer langen Tradition beruhen, die vielfältige, bedenkliche Erfahrungen wechselnder Geschlechter gesiebt hat und aus ihr das immer Bewährte zum Kanon formte. Solcher Umgang mit dem Göttlichen ist der Umgang mit unserer Totalität in ihren wesen-haften Facetten, mit dem Unbewußten, dem Leibe, der Welt in der die Götter hausen wie überall in der Welt. Wer sie nicht mehr in Wind und Fels, in Quell und Sternen verehrt, auch nicht an einer himmlischen oder überhimmlischen Stätte, sondern da, wo er sie einzig unmittelbar erfährt, am eigenen Leibe, dem kann sein Leib zur Welt werden, dem wird wie dem Yogin die Wirklichkeit seines Leibes zur Wirklichkeit schlechthin. Er entdeckt, daß sie alles enthält und daß aller Gehalt außen nur Spiegelreflex der Ausstrahlung seines Wesens innen ist, Projektion der Kraft, die ihn innen immer¬während aufbaut, — dem wird, was ihm geschieht, zum Geschehenden schlechthin.
Der tantrische Yogakult, der mit dem eigenen Unbewußten um-geht, dem Göttlichen, das in uns steckt, ist seine Beschwörung, Erweckung und zeremonielle Verehrung. Was im alten Kult der Veden zwischen den Feueraltären des Opferbezirks unsichtbar zwar, doch außen vor sich geht: daß die Götter kommen auf ihren Wagen und nur der Priester sieht die Himmlischen leibhaft in innerer Visualisierung, getragen von den Strophen, die sie herbei-zwingen in den Kultbezirk und ihre Herrlichkeit ehrfürchtig malen und ihr Sitzen auf der Streu von heiligem Gras zu gastlicher Be-wirtung, — dergleichen geschieht hier im Innenraum des Leibes, im inneren Blickfeld, in das die Gestalt des Göttlichen aus seiner — unserer — ungreifbaren Tiefe heraufsteigt.
Alle Götter in unserem Leibe, — nichts anderes meint das visuelle Schema des Kundalini-Yoga, dessen Adept die weltentf altende, welttragende Lebensschlange des Mikrokosmos aus ihrem Schlummer der Tiefe den ganzen Leib hinauf in ihren überweltlichen Gegenpol führt. Auf ihrem Gang nach oben quert sie die Lotoszentren des Leibes, in denen alle Elemente, der Baustoff aller Gestalt und Gebärde der formgelüstigen Lebenskraft, versammelt sind; und in denselben Zentren werden die Erscheinungsformen des Göttlichen samt den Facetten ihrer Schakti's erschaut und verehrt.
Daß alle Götter und Dämonen in uns sind und aus uns kommen, wenn sie uns wie von außen gegenübertreten, ist ein offenbares Geheimnis des Buddhismus in seiner entfalteten Form des «Großen Fahrzeugs» und wird auch im Vedanta gelehrt, der den Tantra's als philosophische Doktrin unterbaut ist. Kaum irgendwo aber wird es anschaulicher und wirksamer ausgesprochen, ja zelebriert, als im tibetischen Totenbuche «Bardo Tödol». Denn daß dem so sei, erfährt nach der Lehre dieses buddhistischen Rituals ein jeder, auch wenn er es bei Lebzeiten nicht geahnt hat oder nicht hat glauben mögen, in dem «Zwischenzustande» (bardo), der seinem Tode folgt und der neuen Verleibung seines Aggregats psychischer Kräfte und Bereitschaften voraufgeht.
Der Guru des Gestorbenen oder ein Lama, der ihm nahestand, spricht zu ihm und berät ihn während der Dauer des Zwischenzustandes, der ihn mit ungewohnten Schrecken und Gesichten be-fängt —: «du siehst deine Angehörigen und sprichst zu ihnen, erhältst aber keine Antwort. Wenn du dann deine Familie weinen siehst, denkst du, ,ach ich bin tot! was soll ich tun?' und fühlst große Not, wie ein Fisch, der aus dem Wasser auf rotglühende Asche geworfen ist. Solche Not wirst du jetzt leiden, aber Leiden wird dir nichts helfen. Auch wenn du an deinen Verwandten in Liebe hängst, wird es dir nichts helfen. Darum häng nicht an ihnen. Bete zum Allerbarmenden Herrn (Buddha), sei ohne Kummer, Schrecken und Angst.» Solcher Zuspruch geleitet den Verstorbenen auf seiner ganzen Wanderung durch das Zwischenreich und sucht ihn auf jedem neuen Stück seines Wegs der drohenden Wiedergeburt in oberen oder unteren Welten zu entreißen. Nur wer das Ziel des Yoga bei Lebzeiten erreichte, zu erfahren, daß alle Gestalt von Welt und Ich nur Ausgeburt des gestaltlos Ungreifbaren ist, Maya, in die unser Wesen sich verlarvt, bedarf nicht der Deutungen und Hinweise, die hier am Toten ein Letztes versuchen, ihn vor dem Drange seiner eigenen Dämonie, vor der Befangenheit in sich selbst zu be-wahren. Da leuchtet jedem, wenn er den Leib verlassen muß, das reine Licht der Wirklichkeit auf, gestaltlos leere, allerfüllende Helle, — aber nur wer schon als Yogin im Leben von ihm erleuch-tet ward, schrickt nicht geblendet vor ihm zurück. Der in sich selbst Befangene begreift es nicht und kann es nicht ertragen und wandelt weiter den Weg seiner Bereitschaften zu Gebärde und Gestalt.
Die äußere Welt verblaßt um ihn, den ätherleichten, «... wenn du vom Wind des karman, der immer weht, getrieben wirst, wird dein Geist, der keinen Gegenstand findet, darauf zu rasten, wie eine Feder vor dem Winde hingetrieben sein, ... rastlos und willenlos wirst du wandern. Zu allen, die um dich weinen, wirst du spre¬chen, ,weine nicht, ich bin da ...' Aber sie hören dich nicht, und du wirst sagen, ,ich bin tot' und wirst dich sehr elend fühlen. Gib aber diesem Dichelend-Fühlen nicht nach. — Ein grauer zwielichthafter Schein wird um dich sein bei Tag und Nacht, zu aller Zeit. In diesem Zwischenzustand wirst du ein oder zwei, drei, vier und fünf, sechs oder sieben Wochen sein, bis zum neunundvierzig¬sten Tag. Das karman bestimmt, — wie lange es währt, ist nicht ausgemacht. Der schneidende Wind des karman, schrecklich und schwer zu leiden, wird dich von rückwärts treiben mit schauerli¬chen Böen. Fürchte dich nicht, — es ist ein Wahn, der aus dir sel¬ber kommt. Dichte schreckende Finsternis wird dich ständig von vorn befallen und aus ihr werden drohende Rufe schallen, ,schlag zu! töte!', die dir Angst einjagen, — fürchte dich nicht! — Bei Menschen mit viel schlimmem karman werden reißende Dämonen, Ausgeburten ihres karman, vielerlei Waffen schwingen und schreien, ,schlag zu! töte !' und einen grausigen Lärm machen. Sie werden sich auf einen stürzen, wie wetteifernd, wer von ihnen zuerst zupackt. Auch Phantasmata, als wäre man von vielerlei reißenden Tieren gehetzt, werden auftauchen. Schnee, Regen und Dunkel, schneidende Windstöße und Halluzinationen, als verfolge einen viel Volks, werden kommen, dazu ein Dröhnen, als fielen Berge nieder, als walle das Meer in zorniger Springflut über ... Wenn dieses Dröhnen schallt, flieht man entsetzt von ihm nach dieser und jener Seite und achtet nicht, wohin man flieht. Aber der Weg wird gesperrt sein durch drei schauerliche Abgründe, — einen weißen, einen schwarzen, einen roten. Sie werden schreckenerregend und tief sein, und es wird einem sein, als stürzte man in sie hinab. Aber es sind keine wirklichen Abgründe, — es sind Zorn, Verlangen und Stumpfheit.»
Wenn die gewohnte Welt, die durch die Sinne auf den Lebenden eindringt, sich aufgelöst hat im gestaltlosen Grau des Zwischen¬reichs, das den vom Apparat der Sinne seines Leibes Abgelösten umfängt, dann treten der Drang und die Gewalten seines Inneren als Räume und Gestalten wie von außen vor ihn hin. Er halluzi¬niert das eigene Innere als seine Sphäre um sich, wie ein Träumender, dem die Tagwelt entfiel, Spannungen und Dränge als Landschaften und Gestalten in sich halluziniert, die sein Traum-Ich umfangen, lockern und beklemmen. Wie ein Träumender ist der Abgeschiedene ganz bei sich allein, — aber wie man zu einem Träumenden sprechen kann und er vernimmt's im Traum, verwebt's darein, so spricht der seelenführende Lama zum Abgeschiedenen. Jetzt kommt heraus was in ihm war an Drängen und Bereitschaften zum Guten und Schlimmsten, — Gestalten der Heiligen, Götter und Dämonen; er muß sie anschauen, die Geister seines Herzens und Hirns, und kann ihnen nicht standhalten, den einen in blendendem Licht, den anderen in jagendem Schrecken. Aber die Stimme des Guru lehrt ihn beten, «möchte ich was immer erscheint durchschauen als spiegelnde Reflexe meiner eigenen geistigen Natur, . .. möchte ich die Scharen friedvoller und zornvoller Gestalten nicht fürchten, — sie sind Visionen meiner selbst.»
Im Tode, in dem das Bewußtsein schwindet, wird unser Unbewusstes frei, — nun bricht es allbeherrschend aus. Und alle Triebe und Bereitschaften, die unsere Lebenswelt bestimmten, wie sie jeden individuell umfängt mit ihrer besonderen Gewichtsvertei-lung und einer eigenen Fülle innerer Beziehungen, alle Wertungen, die wir den Dingen beilegen, alles Kolorit, mit dem wir sie anglühen in Liebe und Abwehr, an ihnen hangend und sie fliehend, — all das projiziert sich, wie es das ganze Leben lang geschah, nach außen. Aber da ist keine gestaltige Körperwelt mehr, Entsprechung unseres eigenen Körpers, die davon übermalt würde und aus neutralem Grau mit lockender und drohender Tönung überschminkt, — da ist nur das gestaltlose Grau des Zwischenreichs. Die Urbilder der heiligen, verführerischen und furchterregenden Gestalten, die wir im Leben auf Menschen projizierten, wenn wir sie verehrten, begehrten oder haßten, treffen jetzt auf kein gestaltiges Gegenüber einer unseren Körper umgebenden Körperwelt; sie fallen auf die graue Nebelwand des Zwischenreichs als glühende Fata Morgana unseres Inneren: da schaut es uns tausendfältig an, in unerträglicher Hoheit uns blendend, in rasender Dämonie uns scheuchend, — wie hielten wir ihm stand? Aber die Stimme des Lama tönt dazu, «diese Gottgestalten in höchster Vollkommenheit kommen aus deinem eigenen Herzen. Sie sind die Ausgeburt deiner eigenen reinen Liebe und leuchten. Erkenne sie! — diese Sphären kommen nicht von außen irgendwoher ... sie kommen aus dir und strahlen dich an. Auch ihre Gott-heiten kommen nicht von außen irgendwoher, — von Ewigkeit an sind sie in dir als Möglichkeiten deines eigenen Gemütes. Erkenne, daß dies ihr Wesen ist.»
Und wenn vom achten Tag an nach dem Tode den milden Aus-geburten des Herzens die grauenstarrenden des Hirnes folgen, flammenlodernd, alle Waffen der Vernichtung schwingend, Schädelschalen voll Menschenblut zum Trunke an die Lippe führend, tönt die Stimme des Guru, «fürchte dich nicht! wisse, das ist eine Ver¬leiblichung deines eigenen Gemütes. Entsetze dich nicht, denn es ist deine eigene Schutzgottheit» ... erkenne: was dich als Teufel schreckt, hat auch einen erhabenen, buddhagleichen Aspekt, — «glaube an den! erkenne ihn, und du wirst erlöst. Nenne ihn bei diesem Namen und halte dich davon durchdrungen, daß dieses das göttliche Wesen ist, das dir Schutz verleiht. Tauche in es hinein! schmilz hinein, bis du eines mit ihm bist (in samddhi), und du wirst deine verborgene Buddhaschaft erwecken.»
Nur wer, schon im Leibe lebend, als ein Yogin der Buddha-schaft zustrebte und diese Projektionen seiner Tiefe in ihrem We-sen durchschaut hat: daß sie es sind und nur sie, die allem außen das Kolorit verleihen, Wert und Gewicht ihm geben und ein Unbestimmtes als seine bestimmte Welt ihm schenken, die lockt und schreckt, — nur ein Yogin ist diesem allmächtig ausbrechenden Mayäspiel seiner Schakti gewachsen. Darum ist das «Bardo Tödol» nicht nur ein Ritual für den Dahingegangenen, ihn zu lehren und zu leiten, sondern auch eine Yogalehre für den Lebenden, daß er sich an Hand seiner Schilderungen beizeiten mit den gestaltigen Ausgeburten seiner Tiefe vertraut mache in innerer Schau und Verehrung und furchtlos sie wiedererkenne, wenn sie ihm im Zwi¬schenreiche begegnen. Wer schon bei Lebzeiten durch seinen Guru eingeweiht ist, kann ihrem Schrecken nachmals gewachsen sein und das reine Licht der Erkenntnis, das alles dies als Mäya hinter sich läßt, in sich verwirklichen.
Das «Bardo Todol» lehrt den buddhistischen Yogin die dämo-nischen Gewalten seines Inneren als seine eigenen Schutzgotthei-ten verehren; dann braucht er keine Furcht vor ihnen zu haben, wenn er ihnen im Zwischenreich begegnet, er hat sie schon immer in Scheu verehrt. Wir müssen beizeiten lernen, mit den Nachtseiten unseres Wesens umzugehen, — nicht um mit ihnen dämonisch in die Welt zu wirken oder bei uns geheim zu spielen — das wäre schwarze Magie oder Teufelsbuhlerei —, aber wir müssen sie ehrfürchtig anerkennen als die dunklen gefährlichen Mächte, die in uns sind. Sie haben Gewalt und Hoheit, denn sie sind Formen unserer formgelüstigen Schakti, der göttlichen Lebenskraft in uns, so gut wie unsere gepriesenen engelgleichen Möglichkeiten, rein und schön zu sein. Wer die Augen vor ihnen schließt und ihnen die Anerkenntnis ihrer mächtigen Allgegenwart weigert, dem wird sie einmal von ihnen fürchterlich bewiesen; aber wer sie in Scheu verehrt, ohne sie für sich entfesseln zu wollen, mit dem leben sie Wand an Wand als seine Schutzgottheiten. Denn ihre teuflisch bleckende Gewalt ist nur der Nachtaspekt ihres Wesens, wenn wir sie vor unserem Bewußtsein nicht gelten lassen wollen; er ist die treffende Hieroglyphe unseres Unbewussten, in dessen Nacht sie abgedrängt sind, daß wir Grauen und Scham vor ihnen empfinden, anstatt uns zu ihnen zu bekennen. Es gilt die Ganzheit unseres Wesens anzunehmen und zu ehren, aus der wir nichts entfernen können, so wenig einer von seinem Leibe, was er schamhaft an ihm verbirgt, abtun und wegwerfen könnte, ohne davon ein völliges Monstrum zu werden.
Dieser Umgang freilich mit der Ganzheit unseres Wesens, die uns unbewußt zu bleiben droht und dann dämonisch uns verstört, fordert ein reines Herz. Wer diesen Umgang sucht, vom Wirbelstaub der Leidenschaft verwölkt, von bestialischer Dumpfheit getrübt, verfällt den Gewalten, die er beschwor, auf daß sie seinen Begierden dienten. Das ist der Sinn der Höllenfurcht, die aus den Geschichten dämonischer Zauberer spricht : den Doktor Faustus der alten Sage und den Doktor Kenodoxus von Paris (im Jesuiten-drama des Barock) holt der Teufel, den sie riefen. Er diente ihnen, bis sie ihm ganz verfallen waren; er weiß im vornhinein: er ist der Stärkere, — wie könnte der Mensch der allgestaltigen Macht, die ihn mit Lockungen und Schrecken versucht, auf die Länge gewachsen sein! Das Unbewußte, das man weckt, um sich seiner zu bewussten Zwecken zu bedienen, anstatt es scheu zu verehren, ist gerade soviel mächtiger gegenüber dem bewußten Ich, wie der Leib diesem Ich an Macht überlegen ist, — als Leib des Unbewußten zwingt er das wache Ich, das wirken möchte, sich abzudanken in Schlaf, wann es ihm gefällt.
Indem das «Bardo Tödol» die gewollte Verschmelzung des Adepten mit den teuflischsten Ausgeburten seiner eigenen Tiefe zur Rettung vor ihnen und vor der Flucht in drohende Wieder-geburt fordert, heißt es ihn, in die eigene Hölle fahren. Der Weg zu vollkommenerer Sphäre geht, wie bei Dante, nur durch sie. Diese schauerliche Niederfahrt in die eigene Schicksalstiefe liegt Ödipus im Sinn, wenn er nach jenem fluchbeladenen schicksals¬vollen Kinde forscht, das sein Vater frühestem Tode weihte, — das er selbst war, ohne es zu wissen: da will er ganz werden und wird es auch; das ist sein vorbildlich tragischer Gang. Ihm ahnt, daß er auch noch ein anderes ist als der Retter Thebens, Held und König, Gemahl dieser Frau und Vater dieser Kinder. Er fühlt ein anderes, das all dies auslöscht, ein Fürchterliches in sich, aber wie es beschaffen ist und heißen müßte, bleibt ihm ungreifbar, — wie sollte er's erinnern, da er sich selber unbewußt den Vater erschlug, die Mutter zur Frau nahm, diese Kinder in ihr zeugte. «Das Ganze vollendet sich nun!» — das ist sein ungeheurer Laut, als er sein eigenes Dunkel aufgegraben hat, das als Sphinx tödlich bleiern über ihm und seinem Reiche hing, nicht zu bannen, wie er vormals die andere Sphinx bezwang, die dunkle Schuld des Vaters, die Laios nicht bannen konnte. Nun ist er ganz geworden, ist das eine und das andere: Heilbringer und unheilbringender Verbrecher, sein Lichtes und sein Dunkles fließen mächtig in eins. Nun braucht er keine Augen mehr wie andere Menschen, — Augen, die gegeben sind, immer eines vom anderen zu sondern und zwischen mehrerem einen Weg zu weisen; in seiner Ganzheit ist eines das andere, der Rettende ist das Opfer, seine Größe ist sein Fluch, seine Unschuld seine Schuld. Da wirft er seine Augen weg, — er könnte wie der rasend gewordene Ajas des Sophokles, sein tragischer Bruder, rufen, der den selbstgewählten Tod grüßt mit dem Laut, «Dunkel: du mein Licht!»
Ein Gleiches meint die christliche Gebärde: Jesu Ablehnung der Pharisäer, seine Hinwendung zu den sozial und moralisch Bemakelten, sein Hinweis auf das Kind als Vorbild, nicht weil es rein und unschuldig ist, aber noch unbefangen aus seiner Ganzheit lebt. Er zwingt die Jünger, stehenzubleiben vorm Hundeaas, seinem Gestank stillzuhalten und sein Schönes, die weißen Zähne, inmitten seiner Fäulnis zu sehen, es als einen Bestandteil des Schönen der Welt zu sehen, anstatt es als ekel zu verwerfen mit dem Gewimmel seiner Fliegen und Verwesung. Das ist die Gebärde Sankt Julians, die Flaubert der Legende nacherzählt: der Fährmann bettet den aussätzigen Wanderer an seine Brust, — da ist der ansteckende Abscheu der begnadende Heiland. Indem einer verschlingt, was ihm das Widerwärtigste ist, und sich von ihm verschlingen läßt, kann er in den Besitz einer Ganzheit gelangen, in der das Widerwärtigste samt allem wovor man floh, wonach man langte, sich auflöst. Diese Gegensätze alle bedürfen einander und verlangen danach, aneinander in der Ganzheit, die sie bilden wollen, zu verschwinden. Dieses Untertauchen im Anderen, vor dem einer immer Abscheu empfand und das er doch als ihm zu eigen annehmen muß, ist wie das Bad der Sträflinge im Zuchthaus, in das ihr Schmutz zusammenkam, auf daß nach ihnen Oskar Wilde, «the king of life», sei¬nen Leib darein tauche und das Werk seines Lebens, das er als den eigentlichen Gegenstand seines Künstlertums empfand, aus Gegensätzen zur Ganzheit brächte.
Als gleichnishafter Ritus für diese Aufgabe, ganz zu werden, ließe sich eine Messe denken, deren Kelch nicht mit dem Blute Gottes gefüllt wäre, mit dem Lebenssafte des Lammes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, aber mit allen Lästerungen des Heiligen und Reinen, allem Unflat des Priesters und der Gemeinde, — und indem der Priester all dies Uneingestandene, offenbar Gewordene als ungeheuerlichen Trank sich selbst und der Gemeinde darbringt, geschähe das Wunder der Wandlung: aus dem Grauenvollen, Unsäglichen würde das Lauterste, der Trank der Götter, der entsühnt und ein todloses Dasein schenkt. Solch ein Dasein meint das «Bardo Tödol» mit der verborgenen Buddhaschaft des Adepten, die im Durchgang durch die eigene Höllenwelt sich offenbart: eine übergegensätzliche Ganzheit, unanfechtbar von Widersprüchen und Abgespaltenem. Dieses Durchdringen zur Herrlichkeit des Ganzseins ist in vielen Legenden der Werdenden Buddhas (bodhisattva) dargestellt, die alle Opfer und Schrecken auf sich nehmen, weil sie begreifen, daß ihr Ich, das aufgelöst sein will, sich mindestens so sehr durch Abwehren und Abspalten aller Dinge, die ihm widerstreben, täglich neu kristallisiert, wie durch Gebärden des Zugriffs und umklammernden Bewahrens. Der Erleuchtete (buddha) aber ist «ohne Brache, ohne Ödland» in sich (a-khila) und darum «ganz» (a-khila meint auch «restlos» oder «ganz») , er hat kein Ich als Fruchtland ausgegrenzt aus der Wildnis seines und alles Wesens und es wohl verwahrt gegen was ringsum in ihm als dunkle Wüste liegt, unbeachtet und drohend: so kann ihn kein Schrecken aus der eigenen Wüste mehr anspringen, kein Tier oder Dämon aus dem Dschungel des ihm unbewußten Teiles seiner Ganzheit sich er¬heben.
Alle Götter und Gewalten in uns, — da schwillt der Leib zum Kosmos, aber auch der Ernst, die Drohung dieser Situation, wenn wir ihren Ernst nicht würdigen, wird offenbar. Von diesem Göttlichen in uns gilt nicht, wie sonst wohl einer fragend von einem Gott gehöhnt hat, er schliefe wohl oder sei verreist; — wenn es zu schlafen scheint oder fern zu sein, dann ist es schon erzürnt, weil wir die Beziehung zu ihm verloren haben und es nicht zu halten vermochten. Dann sind wir schon nicht mehr im Stande seiner Gnade: es ist schon auf dem Wege, sich in einen gefährlichen Teufel zu verkehren, der sich bösartig gegen uns gebaren muß, wie alle Dummheit und Verzweiflung. Jeder hat das Göttliche in der Gestalt, in der er es verdient, die er in sich selber aufzunähren und zu halten vermag in täglicher Hingabe. Wir nähren den Gott in uns mit unseres Herzens Blut, wie auf Bildwerken der Azteken der Priester das Blut aus seiner Zunge dem Gotte darbringt. Novalis notierte sich: «Jedes Wort ist eine Beschwörung; ein welcher Geist ruft, ein solcher erscheint.» Der aufgeklärte Gottesleugner, für den es alles das nicht gibt, hat nichts Göttliches mehr in seinem Herzen, — das ist seine Gnadenlosigkeit. Dafür plagen ihn die Teufel seines Hirns: «Zufall» oder «Macht der Verhältnisse» und «Unausweichlichkeit der Kausalität» oder «Schuld der anderen» — denn außer sich muß er alle Dämonie suchen, die er in sich nicht finden und auflösen will. «Wo keine Götter sind, da sind» — nach einem Wort Novalis' — «Gespenster.» Sie entziehen sich, als rechte Gespenster, jedem wirklichen Zugriff mit ihrer Fähigkeit, in im¬mer anderer, unerwarteter Gestalt zu geistern; wer ihre Dämonie nicht in sich selbst beschwören und in das Höhere, das sich in ihr verlarvt, verwandeln kann, lebt ohnmächtig in ihrer Sklaverei, — er ist sein eigener böser und dummer Teufel.
Der Tantra-Yoga lehrt, wie man in Achtung und Verehrung immer auf gutem Fuße mit dem Unbewußten bleibt; es wird zum Ausgleich heraufgerufen, ja Kern des tantrischen Yoga ist, sich immer wieder ganz in ihm zu ertränken. In der zum Steigen her-aufbeschworenen dunklen Flut verschmilzt das bewußte Ich mit der glitzernden Welle, die sie als Gottesgestalt aufwirft. So lebt der Adept weiter, immer wieder unbeschwert, unabgespalten von seiner Tiefe, in voller Kommunion mit ihr. «Wie alle strömenden Flüsse» nach einem Wort der Upanischad «im Meer zur Ruhe eingehen, Namen und Gestalt verlierend, so gelangt der Wissende, von Namen und Gestalt befreit, zum göttlichen Wesen, das höher als das höchste ist», — so kehrt der Yogin mit täglicher Einschmelzung seines sich greifbaren Teils, mit Gestalt und Namen, mit vor-stellendem und denkend-benennendem Bewußtsein, in seine gött-liche Gegenseite heim. Daraus zieht er die Kraft, Allem gewachsen zu sein. IV.
Es ist schon öfter versucht worden, die indischen Yogalehren in unserer Sprache wiederzugeben und an solche Nachzeichnungen ihrer Umrisse hat sich allerlei Deutung gehängt, aber es wurde dabei nicht völlig klar, auf welche Art oder Sphäre von Wirklichkeit sich Yogaerfahrungen beziehen. Erst die Psychologie des Unbewussten ist in die Sphäre vorgedrungen, in der Yogaerfahrungen zu Hause sind. Neben ihr stehen erhellend die Versuche eines Einsamen, die über den Kreis psychopathologischer Fachwissenschaft hinaus wenig bekannt geworden sind: im Jahre 1912 veröffentlichte der kgl. Hochschulprofessor für Experimentalchemie am Lyzeum zu Freising in Bayern, Dr. Ludwig Staudenmaier, sein Buch «Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft». Er war sich der Bedenken, die seine Ergebnisse im Kreise strenger Wissenschaft fin¬den würden, bewußt; darum unterbreitete er eine erste Ausarbeitung einer Autorität positivistischer Forschung, dem Chemiker Wilhelm Ostwald, dessen «umfassende wissenschaftliche Kenntnisse auf den einschlägigen Grenzgebieten genügend Garantie bieten mußten», ob Staudenmaier «den Schritt der Veröffentlichung wagen dürfe». Als Antwort nahm Ostwald seine Abhandlung in die «Annalen der Naturphilosophie» auf (sie steht dort im Jahrgang 1910). Die Psychiatrie wertet sein Buch wohl nur als die bemerkenswerte Selbstschilderung eines schizophren Erkrankten.
Staudenmaiers äußerer Lebensgang ist farblos und ereignisarm, desto bemerkenswerter ist, was ihm innerlich widerfuhr; dies Widerspiel von Außen und Innen entspricht recht den Proportio-nen im asketischen Lebensgange eines Yogin oder Heiligen. Im Vorwort seines Buchs erzählt er, er habe 1884 ein bayrisches humanistisches Gymnasium absolviert, danach vier Jahre lang ein Lyzeum besucht, eine «Spezialhochschule für das philosophische und katholisch-theologische Studium», die den Theologiestudenten die akademische Bildung vermittelt, wenn sie aus irgendwelchen Gründen eine Universität nicht besuchen wollen. Hier trieb er ein Jahr Philosophie und drei Jahre Theologie. Aber nach einem Jahr praktischen Dienstes wandte sich Staudenmaier von dem geistlichen Berufe ab und begann ein neues Studium, ging nach München und trieb «ausschließlich Naturwissenschaften, namentlich Zoologie, später Chemie». Er berichtet weiter, «nach Ablegung der bei¬den naturwissenschaftlichen Staatsexamina für beschreibende Naturwissenschaften und Chemie, sowie des chemischen Doktor-examens an der Universität München, war ich anderthalb Jahre Assistent an einem dortigen naturwissenschaftlichen Universitätsinstitut, bis ich im Jahre 1896 zum Professor der Experimentalchemie am kg1. Lyzeum in Freising ernannt wurde, an welchem ich seit bald 16 Jahren tätig bin».
So führte sein Weg aus der Stille eines klerikalen Lyzeums über angespannte knappe Studien- und Assistentenjahre wieder in die Stille eines Lyzeums zurück. Er war eine junggesellige Natur, saß hinter seinen chemischen Experimenten wie «ein alter Student» und lebte auch so, anspruchslos und ohne sich als Professor zu zelebrieren. Der illusionäre Glanz einer gelehrten Laufbahn mit dem Theater der Berufungen, Fakultätsbeherrschung und Insti-tutsregiment lagen ihm fern auf seinem toten Gleis in Freising, wie sie seinem Bewußtsein fernlagen. Eros und Kratos, die beiden Gebärden der Schakti, die die Welt bewegen, Liebe und Machtwille oder Geltungstrieb haben sein äußeres, sein bewußtes Leben nicht besessen.
Was ihn zur Begründung der «Magie als experimenteller Naturwissenschaft» brachte, war was man einen Zufall nennt. Ein Bekannter befragte ihn über den Charakter jener phosphoreszierenden Gestaltserscheinungen, wie sie in spiritistischen Sitzungen bemerkt werden, «ob sie sich nicht zum Teil physikalisch oder che-misch erklären ließen». Derselbe Bekannte regte den skeptischen Professor an, Schreibversuche zu machen, wie sie unter Spiritisten üblich sind, — Versuche, bei denen man die Hand mit dem Stift lose über ein Blatt Papier hält und mit ausgehängtem Willen zu wartet, was an Schrift oder Zeichen entstehen wird. Nach anfänglichen Hemmungen und ergebnislosen Versuchen und wiederholter Ermunterung von seiten des Bekannten, fortzufahren, kam bei Staudenmaier der erwartete Prozeß in Gang: zunächst beschrieb der Stift die «sonderbarsten Windungen und Schnörkel», bald aber fing er an, Schrift zu schreiben und antwortete mit ihr auf innerlich gestellte Fragen. Es war, als spräche bald dieser, bald jener Geist durch diese Schrift, die immer leichter floß. Staudenmaier bezweifelte, ob es sich wirklich um einen Geist handle, da er «auch bei den Antworten selber mitdenken mußte». Er bemerkt dazu, «im übrigen hatte ich ganz unbedingt den Eindruck, als ob ein mir völlig fremdes Wesen dabei im Spiele sei. Aus dem Vorherwissen dessen, was geschrieben wurde, entwickelte sich mit der Zeit ein ,inneres' Vorherhören desselben.» Damit schieden Stift und Papier aus dem Umgang mit den inneren Stimmen aus, nachdem sie noch für eine Zeit des Übergangs als anregende Requisiten zur Einleitung des Prozesses zuhand gewesen waren. «Ich war, wie die Spiritisten sich ausdrücken, zu einem ,hörenden Medium' geworden.» Die Zahl der Stimmen, die sich meldeten, war unergründlich, sie meldeten sich «schließlich zu oft und ohne genügenden Grund, auch gegen meinen Willen», — sie waren «vielfach böswillig, raffiniert, spöttisch, zänkisch, ärgerlich usw. Es ging dann tagelang ganz gegen meinen Willen ein unerträgliches und widerliches Streiten fort. Vielfach erwiesen sich auch die Angaben der sich meldenden Wesen direkt als erlogen.»
Zu diesen «akustischen Halluzinationen, wie sie der Psychiater nennen würde, traten auch andere, namentlich optische, auf. Im ganzen Auftreten und Handeln der sich meldenden Wesen war zweifellos ein gewisses Maß von selbständiger Intelligenz vorhanden, anderseits war ihr Benehmen so sonderbar, so einseitig befangen, ihre ganze Gesinnung gegen mich häufig so vollständig von meiner mir fühlbaren Nervenstimmung abhängig, daß offenbar der größte Teil der Ursachen der magischen Phänomene in mir selber liegen mußte. Nach naiv-mittelalterlichen Begriffen war ich besessen. Allmählich hoben sich einzelne Halluzinationen immer bestimmter heraus und kehrten öfters wieder, schließlich bildeten sich förmliche Personifikationen, indem die wichtigeren Gesichtsbilder mit den entsprechenden Gehörsvorstellungen in regelmäßige Verbindung traten, so daß die auftretenden Gestalten mit mir zu sprechen begannen, mir Ratschläge erteilten, meine Handlungen kritisierten usw.»
Es spalten sich in Staudenmaier mehrere Wesen ab, die ein eigenwilliges Dasein bekunden. Besonders bemerkbar machen sich zunächst drei, denen er ihrer Eigenart und Erscheinung entspre¬chend die Namen «Hoheit», das «Kind» und der «Rundkopf» gibt. Es lohnt sich, diese Gestalten so genau nachzuzeichnen wie die Erfahrungen einer Yogaübung, zumal Staudenmaiers Buch nur wenigen zuhand sein kann. «Bei Besichtigung von militärischen Übungen» ergab sich für Staudenmaier die Gelegenheit, «eine fürstliche Persönlichkeit aus unmittelbarer Nähe wiederholt zu sehen und sprechen zu hören. — Einige Zeit später hatte ich ein-mal ganz deutlich die Halluzination, als ob ich dieselbe wieder sprechen hörte». Diese Halluzination entwickelt sich zum Gefühl der Nähe dieser Persönlichkeit, «... die Personifikationen anderweitiger fürstlicher oder regierender Persönlichkeiten traten in analoger Weise auf» — die Gestalt verlarvt sich bald in die Figur des Deutschen Kaisers, dann wieder Napoleons; — «allmählich beschlich mich dabei gleichzeitig ein eigentümliches, erhebendes Gefühl, Herrscher und Gebieter eines großen Volkes zu sein, es hob und erweiterte sich deutlich meine Brust fast ohne Mitwirkung meinerseits, meine ganze Körperhaltung wurde auffallend stramm und militärisch, — ein Beweis, daß die betreffende Personifikation alsdann einen bedeutenden Einfluß auf mich erlangte ... Aus der Summe der auftretenden hoheitlichen Personifikationen entwik¬kelte sich allmählich der Begriff ,Hoheit'. Hoheit interessiert sich sehr für militärische Schauspiele, vornehmes Leben, vornehmes Auftreten, für Ordnung und Eleganz in meiner Wohnung, für noble Kleidung, gute aufrechte, militärische Körperhaltung, für Turnen, Jagd und sonstigen Sport und sucht dementsprechend meine Lebensweise zu beeinflussen, beratend, mahnend, gebietend, drohend. Sie ist dagegen ein Feind von Kindern, von niedlichen Dingen, von Scherz und Heiterkeit, ... ist namentlich ein Feind von Witzblättern mit karikaturenhaften Abbildungen, ... außer¬dem bin ich ihr körperlich etwas zu klein.»
Diese glänzende Karikatur eines Landesfürsten um 1900 aus der totalen Ironie und Unbestechlichkeit des Unbewußten gegen-über der ganzen sozialen Sphäre «sucht alle meine Handlungen und Pläne in hoheitlichem Sinne zu beeinflussen und auszulegen, meine ganze Lebensweise und Denkart vornehm zu gestalten. Und wenn sie wirklich nicht Deutscher Kaiser sein und sich als solcher im Ernste fühlen kann, so will sie wenigstens oft an ihn denken und mich zum Gleichen veranlassen, und wenn ich zur Wirklichkeit zurückkehre, soll ich mich wenigstens richtig als Professor fühlen, mich meiner errungenen Stellung freuen, standesgemäß leben, essen und trinken und nicht wie ein alter Student immer weiter grübeln und studieren, um vor lauter Studium den Lebensgenuß gänzlich zu versäumen.»
«Eine weitere wichtige Rolle spielt die Personifikation ,Kind' : ,ich bin ein Kind. Du bist der Papa. Du mußt mit mir spielen.' Kin-dergedichte werden daher gesummt, ... wunderbar zarte Kindlich-keit und kindlich-naives Benehmen, wie es selbst das echteste Kind nicht so ergreifend und rührend darbieten könnte ... Beim Spaziergang in der Stadt soll ich an Schaufenstern mit Kinder-spielzeug stehenbleiben, dasselbe eingehend besichtigen, mir kau-fen, soll Kindern beim Spiel zusehen, mich nach Kinderart auf dem Boden herumbalgen, — also durchaus unhoheitlich benehmen. Wenn ich auf Betreiben des ,Kindes' oder ,der Kinder' (zuweilen tritt Spaltung in mehrere verwandte Personifikationen ein) glegentlich in München in einem Kaufhaus in der Kinderspielwaren¬abteilung Umschau halte, ist diese Personifikation ganz außer sich vor Wonne, und entzückt erfolgt oft mit kindlicher Stimme der Ausruf : ,Ach wie schön, das ist der Himmel !' Für später wird die Einrichtung eines Kinderzimmers gewünscht.»
Die Personifikation «Rundkopf» bezog ihren Namen und ihren visuellen Teil von einem eher läppischen Gegenstand, einem kleinen Gummiball, der das fidele Gesicht eines Bierstudenten trug, und wenn man ihn drückte, streckte er die Zunge heraus. Ein Hausierer hatte ihn Staudenmaiers Mutter in einem Biergarten aufgedrängt, «sie brachte ihn mit nach Hause und wir spielten gelegentlich mit ihm. Einige Jahre später schien dieser Kopf, aber jetzt von menschlicher Größe, in meiner Nähe zu sein, während gleichzeitig eine der Figur entsprechende innere Stimme zu mir sagte, ,heute bin ich gut aufgelegt. Sei doch nicht so langweilig. Denke an mich. Ich kann auch etwas. Mich freuen lustige Sachen', — es folgten verschiedene scherzhafte Bemerkungen sowie Kunststücke. Er stellte mit einem Male die Haare steif in die Höhe, schnitt Grimassen, streckte die Zunge ähnlich wie der Gummiball heraus usw. — Dieser Rundkopf dringt darauf, die Münchener Fliegenden Blätter, überhaupt Witzblätter zu lesen und die betreffenden Abbildungen eingehend zu betrachten, in unterhaltende Gesellschaft zu gehen, gemütlich Bier zu trinken usw.... Bald aber vernahm ich anderweitige innere Stimmen, welche sich ärgerlich über das ,plumpe, geschmacklose und bäuerliche Gebaren' dieser Personifikation äußerten und dieselbe schnell aus dem Geleise brachten, so daß sich ihre heiteren Züge verzerrten und der Scherz vorüber war. Innerlich hörte ich dann noch sagen, ,so sollte man einen nicht behandeln. Ich habe euch aufheitern wollen.' — Später nahm ich am ,Rundkopf' allerdings auch schlimme, zum Teil sogar sehr schlimme Eigenschaften wahr. Nach gewissen Richtungen hin schien er vollkommen verwahrlost zu sein und arge moralische Defekte zu besitzen. Dann vergaß ich denselben wieder längere Zeit, bis mir eines Tages auffiel, daß in mir eine fremde Macht bestrebt war, die Zunge seitlich hin und her zu bewegen oder auch vorzustrecken. Es stellte sich heraus, daß der ,Rundkopf' Übungen machte, ,seine Zunge größer und gelenkiger und allseitiger beweglich zu machen, als es beim Gummiball der Fall war. Obwohl ich die Zunge als die meinige in Anspruch nahm, versuchte er seit dieser Zeit noch öfters Übungen mit derselben auszuführen ... Inzwischen hatte übrigens der Rundkopf einmal wirklich Gutes ge¬stiftet. Als ich nämlich in sehr aufgeregter und ärgerlicher Stim¬mung über andere Personifikationen nachts im Bette lag, tauchte im größten Ärger, durch ihn veranlaßt, mit einem Male in schwarzer Zeichnung die optische Halluzination eines Gockels auf, der einen Ölzweig des Friedens im Schnabel hielt und unmittelbar darauf ein Ei legte. Ich mußte lachen, und die ganze Situation war jetzt vollständig verändert» — augenscheinlich erinnerte hier Staudenmaier unbewußt einen der derben schwarzweißen Holzschnitte aus Kortums «Jobsiade» : Hieronymus Jobs, der «vollkommen verwahrloste» Bummelstudent bereichert als Dorfschulmeister die Fibel um das Bild eines Gockels samt Ei im Nest und erregt durch diese paradoxe Zusammenstellung Kopfschütteln im Dorfe.
Eigentlich war es Staudenmaiers ungelebtes Leben, das da in Gestalt dieser Personifikationen aus ihm aufstieg, es waren die natürlichen Gehalte, die nie verwirklichten, ja unbewußt gebliebenen Möglichkeiten eines Manneslebens überhaupt, die sich hier eine verspätete, eigenwillige Form innerer Wirklichkeit erzwangen, nachdem der äußere Lebensgang sie nicht zu Worte hatte kommen lassen. Imposanz und respektheischende Geste, das Jupiterhafte des Hausherrn und Familienhauptes, des geehrten Bonzen und Institutsgewaltigen, — das war nie in ihm aufgekommen, hatte sich nie in ihm ausgelebt in seiner junggeselligen schmalen Existenz klerikaler Vergangenheit und klerikaler Umgebung in diesem Kleinstadtlyzeum, dieser schlichteren Lehr- und Lernzelle am Leibe einer großen Hierarchie, in diesem abgedämpften, auf Ein-ordnung und Selbstbescheidung gestellten Bezirk fernab der großen Welt. Aber er war doch in ihm, dieser Zug zu Repräsentanz und hoheitlicher Allüre, den er zeitlebens nicht an sich bemerkt hatte, wie alles in uns allen ist als Möglichkeit.
Er war in ihm, wie die Anlage zur Vaterschaft in jedem Manne ist, die sich auch nicht an ihm entfaltet hatte und nun in jenem inneren «Kind» die Stimme führte. Als er sich einmal eine winzige Puppe kaufte, als Objekt der Fixierung zu optisch-halluzinatorischen Versuchen, rief das «Kind» begeistert aus, «das ist der Anfang vom Kinderzimmer. Schließlich mußt du auch wirkliche Kinder zum Muster nehmen ...» — und schon war es nicht mehr ein einziges Kind, es war ein Chor der Ungeborenen, der aus ihm sprach, — «dann wollen Wir dir zeigen, was wir sind und was wir können», — da sprachen alle Kinder und Enkel aus ihm, die zu haben und zu lieben seine Möglichkeit gewesen wäre, wie jedes Mannes in Tier- und Menschenwelt; — aber er war sich dieser Möglichkeit nie bewußt geworden, er hatte an ihr vorübergelebt. Mit verheißendem Jubel riefen diese «Kinder» — eine lächerliche kleine Puppe genügte, sie zu wecken, zu begeistern —, sie riefen wie jener Chor der Ungeborenen im Märchen der «Frau ohne Schatten» (Hofmannsthal)
«Wäre denn je ein Fest, wären nicht insgeheim, wir die Geladenen, wir auch die Wirte» — er aber hatte dieses Fest des Lebens nie gefeiert, die Gäste nie geladen und ward nie von ihnen bewirtet. Die banale Fröhlichkeit, die feierabends entspannt, die Mög-lichkeit gemütlich zu verwahrlosen wie der Kandidat Jobs in Trunk und etwas Hurerei, der fidele Bierstudent voll Ulk und Albernheit und plattem Behagen an sich selbst, der niemals in ihm aufgekommen war, nicht in der Sphäre klerikaler Erziehung, nicht in der Anspannung des darauf gesetzten Studiums zweier Naturwissenschaften, — das alles hob seinen Rundkopf aus der Tiefe des Unbewussten, in der zu schlummern es verurteilt worden war, — zu schlummern wie jene Ungeborenen im Teiche, aus dem der Storch die kleinen Kinder holt, die leben sollen.
Aber noch mehr drängte nach oben als nur die ungelebten Möglichkeiten der Staudenmaierschen Person, — die Hölle selbst und ihr himmlischer Widerpart, die friedvollen und die dräuenden Gewalten des «Bardo Tödol» in den Varianten des christlichen Un-bewußtseins. Da war eine Gestalt in ihm, die Staudenmaier als Gott-Vater erkannte, «eine Personifikation des Göttlichen und Erhabenen, darstellend einen ehrwürdigen Greis mit voller, kräftiger Stimme und wallendem Barte, welcher ein natürlicher Gegner der diabolischen Personifikationen ist und mich für Tugend und hohe Ziele zu begeistern sucht». Dazu zwei «meist gehörnt auftretende Personifikationen», die «eine große Rolle spielen, — ,Bockfuß' und ,Pferdefuß', gegen welche ich sehr vorsichtig sein muß, da sie sich immer wieder, namentlich, wenn ich mich zu sehr überanstrenge, in gefährlicher Weise zu entwickeln drohen». — Aber der Teufel begegnete ihm auch sonst als Ausgeburt des eigenen Innern, «manchmal schienen alle Teufel los zu sein. Teufelsfratzen sah ich wiederholt mit voller Klarheit und Schärfe. Einmal hatte ich, als ich im Bette lag, ganz deutlich das Gefühl, daß mir jemand eine
Kette um den Hals schlinge. Gleich darauf nahm ich einen sehr übeln Schwefelwasserstoffgeruch wahr und eine unheimliche in-nere Stimme sagte zu mir: ,Jetzt bist du mein Gefangener. Ich werde dich nicht mehr loslassen. Ich bin der Teufel.'» So erfuhr er am eigenen Leibe, was dem heiligen Antonius und anderen Büßern dämonisch begegnete, was die Welt des Tantra-Yoga wimmelnd erfüllt und den Gegenstand seiner Kunst im Lamaismus bildet. Auch die Versucherin, das Phantom Helenas — nach Mephistos Wort «in jedem Weibe» — fehlte dabei nicht: «unter den optischen Halluzinationen ist die bemerkenswerteste: einmal hatte ich einige Tage den Besuch einer hübschen, jungen Dame. Dieselbe machte einen gewissen Eindruck auf mich, der jedoch schnell wieder verschwand, nachdem sie fort war. Ein paar Tage später lag ich nachts in meinem Bette, auf die linke Körper-seite geneigt und dabei gelegentlich mit den inneren, sich meldenden Stimmen redend. Als ich mich jetzt auf die andere Seite drehte, sah ich zu meiner größten Überraschung rechts neben mir den Kopf des betreffenden Mädchens aus dem Bette herausragen, wie wenn es neben mir liegen würde. Er war magisch verklärt, von entzückender Schönheit, ätherisch durchsichtig und in dem fast dunkeln Zimmer — auf der Straße brannte in einiger Entfernung eine elektrische Bogenlampe — sanft leuchtend. Im ersten Moment war ich über das Wunderbare völlig verblüfft, im nächsten aber war mir bereits klar, um was es sich handelte, um so mehr, als mir gleich¬zeitig eine rauhe, unheimliche Stimme innerlich spöttisch zuflüsterte. Ich wandte mich daher entrüstet und ohne mich um das Phantom zu kümmern, mit einem kräftigen Schimpfwort wieder auf die linke Seite. Später sagte mir eine freundliche Stimme: ,das Fräulein ist schon wieder fort.' Ich sah nach, und als nichts mehr vorhanden war, schlief ich ein. Daß ich damals völlig wach war, kann ich auf das bestimmteste versichern, ebenso, daß ich vorher nicht an die betreffende Person gedacht hatte.»
Staudenmaiers resolutes Verhalten in dieser Versuchung würde manchem Heiligen einige Ehre machen; aber wodurch er sie bestand, die junggesellige Trockenheit seiner Natur war es wohl wiederum, die ihn aus der Bahn des Klerikalen, die ihn zur Heiligkeit hätte führen können, zum Professor der Experimentalchemie hatte werden lassen. Es hatte sich in ihm so viel gestaut im Unbewussten, daß er Gesichte hatte wie irgendein Heiliger und Yogin, aber es fehlte innen das Ventil der Glut und Gläubigkeit, durch das der Drang gestauter, mit sich übersättigter Lebenskräfte hätte aufschießen mögen, um durch Andacht und Verehrung verwandelt zu werden in die kristallene Gestalt des Göttlichen. Der Lamaismus kennt diese «junge Dame» auch, die in gleißender Nacktheit den Trank der Lust kredenzt; aber er hat ihre lockende Dämonie gebrochen und sie durch kultische Beachtung umgeformt zur freundlichen «Fee aller Buddhas» (sarva-Buddha-Dâkini). Sie ist die Schutzgottheit der Saskya-Sekte der rotbemützten Lamas und gehört ins Gefolge der Schakti, wenn sie sich demanten mit einem Eberkopf darstellt (Vajra-vârâhI), als Ausgeburt der demantenen Sphäre überweltlicher Wirklichkeit.
Auch in der Landschaft draußen begegnete Staudenmaier dem Teufel in vielerlei Gestalt: «damit ich mich von meiner Nervosität erhole, hatte mir der Arzt über meine Experimente lächelnd, ge-raten, die ganze Magie ,an den Nagel zu hängen' und möglichst wenig zu studieren, dafür aber fleißig Spaziergänge zu machen und namentlich auch auf die Jagd zu gehen. In letzterer Beziehung kam ich seinem Wunsche nach.» — Was freute ihn am Jagen mehr als am ziellosen Schlendern? Bezeichnenderweise ging er «allerdings nur auf Raubzeug aus. Auf dieses aber bald in der mir eigenen Art immerhin mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit. Speziell spielte die Jagd auf Elstern und Raben eine Rolle.» Staudenmaier sagt nicht, daß ihm der Sinn seiner kleinen Leidenschaft, gerade Raben und Elstern, dieses «Raubzeug» abzuschießen, klar war, — aber das ist ja eine Tiergestalt des Teufels in christlichen Geschichten und Bildern. Auf Hieronymus Boschs «Geburt Christi» (Köln; Abb. 12, S. 208) sitzt eine große schwarz-weiße Elster rechts über dem Elternpaar des göttlichen Kindes; von links schiebt der Ochs den Kopf zum Bilde herein und der Esel schnuppert in die Krippe, mitten drängt sich das rohe Gesicht eines glückwünschenden Hirten vor —; da sind sie ja alle vereint, die Darsteller des großen Spiels: die Eltern beide, die dumpfe Natur, der plumpe Hirt vertritt die Welt, die der Geburt des Erlösers zujauchzt wie seinem Einzug in Jerusalem und die ihn dafür kreuzigen wird, daß er gekommen ist, — Gott liegt in der Krippe und der Teufel ist auch dabei, denn ihn geht die Geschichte ja vor allen an. So hockt er als schwarzweiß gefleckte Elster auf dem Strohdach des Stalles von Bethlehem in Piero della Francescas «Geburt Christi» (London) ; so innig dabei, aus der Hölle zur Stelle, wie die Engel vom Himmel mit ihrem Lobgesang und Lautenspiel. Auch der Louvre hat eine italienische Geburt Christi mit dem Teufel als Elster im Mauer-werk der Ruine des Stalles von Bethlehem.
Aber der Teufel, der dunkle Aspekt unserer allgewaltigen Schakti, kann sich ja in alles verwandeln; — Staudenmaier erfuhr es: «statt der Elstern sah ich häufig da und dort auf Bäumen und Gesträuchern in schattenhaften, aber ganz deutlichen Umrissen Spottgestalten sitzen, dickbäuchige Kerle mit krummen, dünnen Beinen, langen, dicken Nasen» — wer kennt sie nicht vom Höllen-breughel her? — «oder langrüsselige Elefanten, die mich anglotz-ten. Auf dem Boden schien es manchmal von Eidechsen, Fröschen und Kröten zu wimmeln. Bisweilen waren sie phantastisch groß. Jeder Strauch, jeder Zweig nahm abenteuerliche, mich ärgernde Formen an. Ein andermal schien auf jedem Baum, auf jedem Strauch eine Mädchengestalt zu sitzen, jedes Schilfrohr sich mit einer solchen umgeben zu wollen. Auf den vorüberziehenden Wol-ken sah ich Mädchengestalten, verführerisch lächelnd oder auch spöttelnd, und wenn der Wind die Zweige bewegte, winkten mir Mädchengestalten zu. Wer die Geschichte der Heiligen der ver-schiedenen Religionen kennt, weiß, daß dieselben ähnliches gelitten.»
Und wer das «Bardo Tödol» innehat, weiß, daß Staudenmaier nach diesen Ausgeburten seines zur Hölle gestauten Dranges ihm unbewußter Lebenskräfte nicht mehr viel Neues begegnen konnte, als er das Zwischenreich betrat, und daß er dort keiner Stimme bedurfte, die ihm sagte, «fürchte dich nicht: wisse, das ist Verleiblichung deines eigenen Gemütes», — Staudenmaier schritt unverschreckt von seinen «Illusionen und Halluzinationen» den Forschungsweg seiner experimentellen Magie.
Die Inder haben vom Unbewußten mehr in Erfahrung ge¬bracht als der Westen bislang, wohl mehr als andere irgendwo, — darin liegt ihr Spezifikum, wie das unsere in der beispiellosen Entwicklung der rationalen Naturerfassung und ihrer Ausmünzung zur Vergewaltigung der Schöpfung, zum Triumph des Hirns und seiner Dämonen, — aber Staudenmaier kam auf seinem Wege den Indern nahe. Er störte das Unbewusste auf, daß es mächtig emporquoll, — aber nicht um es zu ehren als sein übermenschlich-ewiges Teil, sondern um es auszuholen und seinen Kindern verächtliche Namen zu geben. Von seinem positivistisch-wissenschaftlichen Denken her nannte er in Kritik am materialistisch gläubigen Okkultismus «Illusion» und «Halluzination», was bei Tag und Nacht Gewalt über ihn hatte. Er verwarf als bloßen Schein, was doch ein greifbares Teil seiner eigenen wirklichen Ganzheit war und seine Wirklichkeit voll Eigenwillen bekundete. Dass er Teile seines Selbst, die neben seinem Ich personhaften Kontur angenommen hatten, nicht höher werten und als Ausgeburten seiner Shakti begreifen konnte, als Aspekte der Lebenskraft, aus deren Tiefe sie aufwuchsen wie sein bewußtes Ich, — das vergalt ihm seine Tiefe, verteufelt wie sie war.
Aber die Technik und die spezifische Wirklichkeit von Yogaphänomenen rückte Staudenmaier ins Licht. Mit der Hand fing es an, die ohne sein Zutun schrieb; er bemerkte einen eigentümlichen vermehrten Kraftzustrom, der unwillkürlich den Fingern zuwuchs und die unwillkürliche Handlung wirkte. Ein Gleiches bemerkte er am Auge, wenn er es zu willkürlichen Halluzinationen bestimmter Bilder zwang. Er fand, daß man den Energiestrom, der zum unwillkürlichen Schreiben drängt, willkürlich steigern könne, um mit ihm «motorische Halluzinationen» frei im Raum zu wirken: «wenn mit zunehmender Übung der Energiestrom gegen die Fingerspitzen stärker geworden ist und eine merkbare Energiemenge bereits über die Peripherie derselben hinausgeht, wird man den Bleistift immer weniger durch unmittelbare Berührung als vermittelst der ausströmenden Energie zu halten versuchen, bis man imstande ist, ihn aus größerer oder geringerer Entfernung zu dirigieren und mit ihm zu schreiben.» — Ein anderes Tor, Energie nach außen zu projizieren, fand er im Auge; so kam er zu den «optischen Halluzinationen» —: «es handelt sich zunächst um ein rein halluzinatorisches Kopieren einer optischen Vorlage, wobei man das bei starkem und anhaltendem Fixieren noch einige Zeit nach dem Schließen der Augen andauernde optische ,Nachklingen' als Unterstützungsmittel verwendet. Mit der Zeit wird es gelingen, eine Halluzination des betreffenden Gegenstandes bei geschlossenen Augen ganz klar vor sich zu sehen. Hauptsache ist dabei, die ungewohnte, entgegengesetzt verlaufende Erregung im optischen Apparat einzuüben und die Vorstellung wirklich sehen zu lernen, d. h. zur Halluzination auszubilden ... Ist einmal der prinzipielle Fortschritt, nämlich das wirkliche Sehen der optischen Vorstellung erreicht, dann wird es bald leicht, sich ganz in das vorschwebende optische Bild zu vertiefen und dasselbe unter Aufwendung von Muskelenergie zu verstärken. Besonders veranlagte Naturen können dann auch zur Gewinnung noch größerer Energiemengen merkliche Hemmungen der Atmung und Herztätigkeit eintreten lassen, die bekanntlich von den großen spiritistischen Medien, von indischen Yogis usw. vielfach bis zum Extrem getrieben worden sind.»
Hier scheint wirklich das technische Prinzip der Visualisierung von Schaubildern im Yoga und die ihnen eigene Wirklichkeit erfaßt zu sein. Aber auch die zauberische Möglichkeit des Yogin, solche ihm geläufige Schaubilder als leibhaftige Gestalten vor andere hin zu projizieren, was in den wunderbaren Berichten von Yogin eine so große Rolle spielt, — «wenn einmal die Halluzination real sichtbar zu werden beginnt, kann man einen verdunkelten Raum aufsuchen und die Augen offen halten ... Will man von dem Bilde eine photographische Aufnahme machen, dann projiziert man dasselbe natürlich möglichst genau auf eine gleichzeitig vorgelegte photographische Platte. — Um etwaigen Einwendungen von vornherein entgegenzutreten, betone ich, daß der Magier das von ihm erzeugte reale optische Bild nicht im gewöhnlichen Sinne sieht, da von demselben im Gegensatz zu den realen Bildern der Außenwelt keine Strahlen in seine Augen gelangen, solche vielmehr von denselben ausgehen. Er nimmt nur die Erregung seines optischen Apparates wahr, er fühlt die Ein-stellung der Augenmuskulatur auf die betreffende Entfernung, so daß der Effekt für ihn der gleiche ist. Ein fremder Beobachter kann dagegen das Bild unter den gleichen Bedingungen wahrnehmen, unter welchen man ein von einer gewöhnlichen Konvexlinse entworfenes Bild wahrnimmt, d. h. innerhalb des von ihm ausgehenden Strahlenkegels. Allseitig wahrnehmbar wird das Bild (oder auch das Phantom der Spiritisten) erst, wenn es in einem (spiriti¬stischen) Zirkel die Teilnehmer ringsum, jeder von seinem Stand¬punkte aus, in einheitlichem (vom führenden Medium dirigierten) Sinne nach außen projizieren.»
Das Grundprinzip des Hathayoga, die freie und gesteigerte Energie des Körpers, begriffen als pneumatische Kraft im ganzen Organismus, durch Muskelkontraktion, Stauung und Leitung be-liebig verwandeln zu können in Halluzinationen aller Art, vor-nehmlich optische und akustische, aber auch in die Motorik des Kundalini-Yoga, hat Staudenmaier aus den eigenen Versuchen abgeleitet: «bei magischen Versuchen handelt es sich vielfach darum, auf den verschiedenen Nervenbahnen die spezifische Energie des jeweiligen Systems in entgegengesetzter Richtung zu treiben als dem normalen Betriebe entspricht. Beim Sehen, Hören, Riechen, Fühlen usw. gelangt die spezifische Erregung von den peripheren Organen, vom Auge, Ohr usw. zentripetal zu den obersten Zentren im Gehirn und schließlich zum Bewußtsein. Bei der Erzeugung von optischen, akustischen und sonstigen Halluzinationen muß man die spezifische Energie von den obersten Zentren im Gehirn in umgekehrter Richtung nach der Peripherie, also zentrifugal befördern lernen. Es handelt sich häufig darum, die betreffende Ener¬gieform über den Körper hinauszutreiben, z. B. motorische Energie über die Fingerspitzen, die Hände usw., während beim normalen Betriebe Energie in merklichen Mengen den Körper nicht verläßt. Man muß nach dem Gesetze der Umwandlung der Nervenenergie» — das ist ja der Präna des Yoga, der in der Suschumnä, der Ader des Rückgrats läuft — «größere Energiemengen, namentlich solche der Muskeln von einem System in ein anderes übertreiben und dortselbst transformieren lernen. — Bei allen Magiern der Vorzeit spielt das Gesetz der Umwandlung der Nervenenergie eine außerordentlich wichtige Rolle. Mittel der verschiedensten Art, meist unangenehme, wie Hungern, Frieren, Nachtwachen, Anhal-ten des Atems, anstrengende Körperstellungen, z. B. stundenlanges Knien, selbst körperliche Mißhandlungen werden angewendet, um eben Nervenenergie um jeden Preis zu gewinnen. Wir brauchen aber trotzdem die indischen Yogis, die mohammedanischen Büßer nicht zu bemitleiden, da sie dabei im allgemeinen wohl mehr Lust als Schmerz empfanden, wenn wir auch ihre Methoden vielfach als pervers bezeichnen müssen. Eine wissenschaftliche Magie wird die Nervenenergie hauptsächlich von da her zu bekommen suchen, wo sie in größter Menge vorhanden und am bequemsten zu erhalten ist, d. h. von den Muskeln.»— Auch wenn er im technischen Detail der Energiegewinnung ein wenig von den Yogin abrückt und — gut westlich — die Muskeln preist: dieser Chemieprofessor ver¬stand sich auf die leib-seelische Alchimie des Yoga, wie sie von Übungen des «tapas«, der Energiespeicherung mittels freiwilliger leiblicher Qual, aufsteigt zu den höheren Formen, wie kein anderer unter uns vor ihm.
Freilich, die eigenwilligen Ausgeburten seiner Schakti stauten die flüssig gewordene, verwandlungsgierige Energie seines Mikro-kosmos und verwandelten sie zu sich, wie es ihrer Dämonie beliebte. Die Halluzination seines bewußten Ich blieb ihm zwar gehorsam: er konnte in seinem Garten spazieren und vor ihm spazierten drei Gestalten im gleichen Takt, drei Staudenmaier ganz wie er; hielt er an, standen sie schon; hob er den Arm, so hoben sie die ihren: da schnellten vier Arme ideal im Takt, es war eine einzige Gebärde; — aber die Ego's im Leibe, die «Personifikationen» trieben mit der Energie des Ganzen finstere Alchimie. Der «Rundkopf» hatte sich der Zunge Staudenmaiers bemächtigt, er reklamierte sie als die seine, trieb zusätzliche Energie hinein und wollte sie sich vergrößern, «Bockfuß» und «Pferdefuß» trieben ihre schmutzigen Teuf e-leien im Dickdarm und Enddarm, sie waren die Dämonen der Verdauungsstörungen, unter denen Staudenmaier jahrzehntelang litt. «So liegen, z. T. nach eigenen Mitteilungen der Personifikationen, die peripheren spezifischen Endnerven für die hoheitlichen und vornehmen Gefühle in der Pylorusgegend, diejenigen für die religiösen und erhabenen in der oberen Dünndarmgegend» — und tiefer dann die teuflischen. Kein Wunder, wenn das Zentrum hoheitlicher Gefühle sich am Magenpförtner manifestierte; es macht das Wesen aller Hoheit aus, daß sie sich erfolgreich weigert, das Leben, wie es auf uns zukommt im Durcheinander seines Erhabenen und Gemeinen, wahllos in sich aufzunehmen und zu verdauen.
So war Staudenmaier im Begriff, die indische Erfahrung « alle Götter an unserem Leibe» an sich selbst zu entdecken, und auch der Sinn ihrer Standorte blitzte dabei auf. Aber was die Reihe der Handauflegungen (nyasa) und die Kosmologie des Kundalini Yoga für die innere Erfahrung des Tantrayogin heiligt, ordnet und durch kultische Übung als ausgewogenen Kosmos erhält, war bei Staudenmaier ein greuliches Gegen- und Durcheinander: aus boshaften Kompetenzkonflikten der Kobolde erhob sich die Forde-rung nach genauer Abgrenzung ihrer Bereiche. Aber das Wunder der mythischen Tat, das Chaos seiner Leibeswelt voll widerstrei-tender Kräfte zum Kosmos zu schlichten, zur willigen Zusammenarbeit aller in ihren Provinzen, blieb Staudenmaier versagt. Der Zustand, den er schildert, ist dem indischen Mythos wohlbekannt: die Willkür der ungebändigten Kräfte, das im Weltlauf periodisch einbrechende Chaos, das die Ordnung zerreißt, in der jede Kraft als göttliche Personifikation an ihrem ihr angemessenen Orte be-scheiden wirkt. Im Mythos der Veden wie des Hinduismus begibt sich immer wieder die kosmogonische göttliche Tat, diese Ordnung herzustellen gegen die Willkür dämonischer Gewalt, die ihre Kraft, ihre Mäyâ willkürlich und grenzenlos spielen läßt, alle Fülle an sich reißt und aus sich tobt und damit den Leib der Welt verstört. In solcher weltordnenden Tat schnitt Indra vorzeitlich den Bergen die Flügel ab, mit denen sie frei dahinflogen wie Wolkenbänke, die sich auf den Gipfeln türmen, — das war ein furchtbares Durch-einander, von dem die Erde schütterte. Aber mit dem Gewicht der flügellosen Berge festigte Indra die schwankende Fläche wie mit Schwersteinen. Er zerschlug den großen Wurm, der auf dem Gebirge lag, die Wolke, die alles Wasser in sich geschluckt hatte und nicht hergeben wollte, mit dem Blitzkeil, da zerbarst die Stauung der allnährenden Lebenskräfte, sie strömten lebenspendend die Bahnen, die Indra ihnen zog: der Kreislauf des Lebens konnte wieder durch den Weltleib strömen, der in völliger Kreislaufstörung zu sterben drohte. Aber solch einen göttlichen Heilbringer, der wie Zeus eine neue Zeit als ihr Herrscher heldisch heraufführt, wie ihn die mythische Geschichte des indischen Weltleibes in Indra und nach ihm in den Avatâra's Vischnus immer wieder feiert, brachte Staudenmaiers Mikrokosmos nicht hervor, — genug, wenn es ihm gelang, sich gegen die zerreißende Willkür seiner Dämonen zu behaupten.
Staudenmaier ist am 20. August 1933 in Rom gestorben, wo er die letzte Zeit seines Lebens verbrachte, — im Hospital der Barmherzigen Brüder auf der Tiberinsel. «Er war», wie ein Freund von ihm, der in Freising sein Kollege war, berichtet, «einige Wochen vorher dorthin aufgenommen worden, ganz erschöpft und zum Skelett abgemagert. Unter der guten Pflege erholte er sich bald wieder gut; aber als er die Kräfte wieder kommen fühlte, ließ er sich nicht mehr halten und kehrte in seine Wohnung zurück. Dort erlitt er mehrere Ohnmachtsanfälle und mußte deshalb wieder ins Spital zurückverbracht werden und starb dort unter urämi¬schen Erscheinungen. Wahrscheinlich hat er zu Hause wieder angefangen mit seinen Exerzitien. Den Anlaß zu seinem Zusammenbruch hat neben der jahrzehntelang fortgesetzten Überanstren¬gung bei unregelmäßiger, einseitiger und meist recht mangelhafter Ernährung die Alteration über den Sturz des amerikanischen Dollars gegeben. Er hatte seine Ersparnisse diesmal in dieser Währung angelegt ...» — Staudenmaier schied als ungebrochener Kämpfer gegen die Dämonen aus seinem Mikrokosmos, den sie mit Anarchie bedrohten; die letzte Karte, die er zweieinhalb Jahre vor seinem Ende an unseren Gewährsmann schrieb, zeugt davon, so wie der Wille seiner letzten Wochen, zu seinen «Exerzitien», seinen magischen Experimenten zurückzukehren. Am B. Februar 1931 schrieb er aus Rom an seinen Freund in Freising: «... alle Deine Glückwünsche zu meinem 66. Geburtstag nehme ich höflichst dan¬kend für empfangen an. Fräulein D. habe ich geschrieben, daß man zu diesem Alter nicht mehr gratulieren soll, sondern kondolieren, weil man immer näher dem Grab kommt. Natürlich bitte ich mich dabei gründlichst auszunehmen! — Da jetzt bald mein Geburtstag rankommt, an welchem Du mir sonst geschrieben hast und ich Deinen Neujahrsbrief noch nicht beantwortet habe, immer in der Hoffnung, möglichst bald mit meinen Experimenten fertig zu weden und Dir etwas Besseres schreiben zu können, so muß ich mich jetzt wenigstens mit einer Postkarte beeilen. Ich arbeite auf Leben und Tod weiter, allein es geht furchtbar langsam und zähe. Obwohl alle vier widerspenstigen Zentren teils unter sich, teils von mir in ihren Personifikationen genug Prügel bekommen haben, fallen sie immer wieder in ihren alten Fehler zurück, so daß es wirklich eine Lammsgeduld erfordert, auszuhalten, — diesen Monat sind es eben 30 Jahre, daß ich mit dem Studium des Spiritismus begonnen habe, allein das übrige hat im 14. Lebensjahr schon im Knabenseminar begonnen.»
Staudenmaier blieb sich in allem treu bis ans Ende; er lebte in Rom wie ein tibetischer Yogin in seiner Hochgebirgsklause, « . .. bei uns ist es etwas stile zingaresco» ... «ich bin beinahe aus¬gezogen, da das Wetter seit gestern hundekalt ist und im ganzen Hause keine Heizung ist. Gestern waren noch, als die Sonne schon drauf zu scheinen begonnen hatte, im südlichen Parterre kleine Eiszapfen zu sehen und der Boden war von verspritztem Wasser geeist ... Eine deutsche Familie, die hier wohnt, eine Frau mit jungen Töchtern, ist nach drei Monaten schon wieder ausgezogen. Sie hat sich immer gewundert, daß wir es hier so lange aushalten.
Sie waren immer krank, bald die eine, bald die andere. Uns beiden hat es bis jetzt nichts gemacht, da ich gegen voriges Jahr große Fortschritte gemacht habe.» Diese Fortschritte beziehen sich augenscheinlich auf seine Alchimie der Leibeskräfte, speziell auf die Umwandlung von Muskelenergie in Körperwärme, die es er-möglicht, äußere Kälte zu kompensieren. Auch in diesem Kunst-stück war Staudenmaier den Eingeweihten Tibets gewachsen, die in Felshöhlen bei karger Nahrung dem Hochgebirgswinter trotzen, ohne zu erfrieren, und, wie Alexandra David-Neel auf ihrem «Voyage d'une Parisienne à Lhassa» (Paris 1927) beobachten konnte, imstand sind, Tücher, die in eisiges Wasser der Bäche getaucht ihnen aufgelegt werden, mit durch Yoga gesteigerter Hitze des eigenen Leibes zu trocknen, daß ihre Nässe verdampft. Er war in dieser physiologischen Form des Yoga, die «Glut glüht», — die «tapas» (tibetisch «tumo»), d. i. Energie als Glut in sich transformiert und speichert, — so gut zu Haus wie im Umgang mit Göttern und Teufeln; — wahrhaftig, wie sein Freund ihn nennt: «ein höchst originaler, vielfach verkannter und doch sehr bedeutender Pfadfinder».
Wir sind lauter Staudenmaier, — immer in Gefahr einer solchen Kreislaufstörung unseres Mikrokosmos, einer Verkehrung der göttlichen Gestaltmöglichkeiten unserer Schakti in dämonische, die ein Chaos aus uns machen, aus uns strömen. Staudenmaier riss diese Gefahr so weit, daß er den tibetischen Adepten des Tantra-Yoga glich, die sich in der Teufels- und Dämonenwelt des Lamaismus als ihrer wahren Wirklichkeit bewegen. Was ihm unwillkürlich zustieß und ihn dann in Bann schlug, wollen diese an sich vollbringen durch bewußte Abkehr von der naturhaften Haltung, mit der die Schakti in Bindung an die äußere Welt sich auf sie projiziert und sie mit lockenden und bösen Farben anglüht. Sie wecken in sich ein schlummerndes Heer von Personifikationen nach den Vorbildern, die das Pantheon des Lamaismus an Heiligen und Fratzen ihnen bereitstellt, ihr Yoga halluziniert sie systematisch nach den kirchlichen Malereien, deren farbig-linearer Stil ganz auf reproduzierende Halluzination gemünzt ist; sie nähren sie mit der Hingabe ihres Wesens und ziehen sie in sich auf. Sie ringen um ihre Gegenwart, die wie bei Staudenmaier ein Innen und ein Außen dämonisch spielend in sich verschmilzt, und dieses Ringen birgt in sich die ständige Versuchung, von der Übermacht der Personifikationen verschlungen zu werden, in Wahnsinn zu stürzen oder aber im Bunde mit ihnen sich dämonischer Magier zu wähnen. Das Ziel des gefahrvollen Weges aber ist, sie zu durchschauen als Ausgeburt des eigenen Inneren und in durchschauender Erkennt¬nis und überlegener Beschwörung den ganz realen Teufelsspuk des eigenen Wesens, die Dämonie der Schakti zu zerschmelzen in die buddhagleiche Haltung.
Es ist das Wesen der Schakti, überzufließen und sich auszugebären zur Gestaltenfülle: so entfaltet sich der überweltlich ruhende Gott des indischen Mythos mit seiner Schakti zur Maya der Welt, — der Eine, alle Gegensätze in sich aufgehoben beschließend, stülpt sie aus zur Fülle der Gegensätze im Spiel der Welt. So treibt die unbewußte Tiefe spontan alltäglich das Ich aus sich her-vor, so treibt der Pflanzenkeim den Blütenkelch aus sich auf, um Samen aus ihm zu stäuben und in ihn zu schlucken zur Frucht. Wer die Dränge nicht aus sich hervorläßt, hat das Welttheater, die ewige Kosmogonie in sich, im eigenen Leibe drin, wie Staudenmaier die Anarchie seiner Teilwesen, und in Halluzinationen bricht sie nach außen. Freilich wer diese Dränge aus sich strahlt und dabei nicht gewahr wird, daß sie, alles Kolorit, alles Gewicht, alle Wirklichkeit der Welt, mit der sie auf uns wirkt, ein von uns selbst Gewirktes sind, wie das Netz, das die Spinne aus sich spinnt, und nun sitzt sie darin als in ihrer Welt, — der ist ganz Samsära: befangen in sich selbst, in seinem dämonischen Innen als einem Außen, das ihn anstrahlt, schreckt und fasziniert, — der lebt seiner eigenen Maya, befangen von der Befangenheit in seine Shakti.
Weil einer Eitelkeit hat, existieren andere Menschen als Spiegel seines Verhaltens, weil er an Dingen hängt, sind andere Gegen-stand seiner Ausbeutung, seines Neides, sind Rivalen und Gefahr, weil sie nehmen können, woran er hängt. Jede Beziehung, die sie zu ihm haben können, entspringt einer spontanen Affekteinstellung in ihm selbst, durch sie erst erhalten die Anderen ihr Kolorit in Zu- und Abneigung, ein eigenes Gewicht und Dasein, das auf ihn wirkt; sonst sind sie eigentlich gar nicht vorhanden, werden nicht wirklich wahrgenommen, berühren ihn nicht. Aus der schattenhaft fahlen Möglichkeit, zu existieren, werden sie erst wirklich durch das Maß von Affekt, das als naturhafter Drang auf sie strömt und sich an sie heftet. Wie Odysseus die Schatten des Hades mit Blut tränken muß, daß sie ihre Schemenhaftigkeit so weit verlieren, um als Menschen wie einst zu ihm zu reden, so tränken wir die schattenhaft unwirkliche Welt ringsum mit Blut, daß sie uns etwas besage, — aber es ist unser eigenes Herzblut, unsere Lebenskraft und Schakti, die wir in sie strömen : da ist sie auf einmal voll des Lockenden und Schreckenden, voll schmeichelnden und schneiden¬den Konturs, glühend und dunkelnd von allen Farben. Sie spiegelt all unsere innersten Möglichkeiten zu agieren und zu reagieren, wir füllen ihre matte Spiegelfläche mit unserem Strahl und nennen, was sie spiegelt, unsere Welt. Eine Welt an sich gibt es nicht; keine Wissenschaft, solang sie rein ist, vermißt sich zu sagen, was die Welt sei; — vermeint sie, es zu können, ist sie schon von Schakti koloriert. Gemessen am weltbildenden Anteil der Schakti am Welt¬gewebe, das einen jeden befängt, besagen die Bezüge, die der forschende Geist als objektiv darin existierende auffindet, nicht viel, so beachtenswert sie sind. Ein Blitz aus Wolken kann uns zu Asche brennen oder Giftgase und andere Dünstungen der Dämonen unse¬res Hirns uns wegraffen: die Preisgegebenheit der Kreatur ist Grundmotiv im Spiel des Lebens; aber das Kolorit, mit dem sie auf uns wirkt, wirken wir allein. Weil alle mögliche Dämonie der Welt uns innen ist, ist sie so außen, wie sie uns innen ist. Wir selbst sind die Unendlichkeit in unserer Tiefe, darin liegen Ironie und Hoheit unseres Daseins, — die Drohung seiner Hölle und die Verheißung des Himmels. Daraus schöpft der Adept des Tantra-Yoga die Ehrfurcht vor sich selbst, daß Gott und Welt in ihm gelegen ist, und in der Hingabe an das Göttliche schöpft er die Allmacht über sich selbst.
Das Leben selbst hält jedem die Einweihung in diese Anschauung bereit: was einmal in glühenden Farben leuchtete, Gegenstand des Verlangens und der Liebe, liegt nachmals glanzlos da und wie erkaltete Schlacke. Wie hing einer an Menschen und Dingen einst, sieht sie wieder und begreift sein Ich von einst wie ein fremdes. Dinge und Menschen haben sich kaum gewandelt, es muß ihm wohl selbst geschehen sein, wenn er auch immer wieder enttäuscht, ja erbittert feststellt, wie wenig er sich in dem wandeln kann, worin er es gern möchte. Aber er ist doch weitergewandelt auf einem allgemeinsten geheimen Wandlungsgange der Lebensstationen. Das Licht, das er einst über vieles ausgoß, wie ein Kind über sein Spielzeug, daß es darunter vor seinem Auge leuchtete, hat sich mit ihm verwandelt, fällt in andere Richtung, hat einen anderen Schein, — so liegt das Frühere kalt, grau und mißschaffen. Das erlebte der werdende Buddha als Prinz, nachdem ihm die Boten des Todes begegnet waren : die schönen Frauen seines Harems, die den Heimgekehrten erfreuen wollten mit Lautenspiel und dem Wohllaut ihrer Kehlen, dem Schimmer ihrer Glieder im Tanz, der Woge des Gefühls in alledem, — sie sagten ihm nichts mehr damit, und als sie enttäuscht von seiner Gleichgültigkeit zu wirrem Haufen übereinander in dumpfen Schlaf gesunken waren, dünkten sie ihn ein Haufen Leichen, und dieser Leichenhaufen dünkte ihn das Antlitz der Wirklichkeit. Dieses verwandelte Licht, mit dem er die schönen Frauen jählings anstrahlte, wies ihm den Weg unter den Baum der Erleuchtung.
Es handelt sich darum, den rechten Umgang mit sich selbst zu finden, mit dem Gotte Nebukadnezars innen, — mit sich und mit Gott, das ist ein und dasselbe. Die Betrachtung indischer Obser-vanzen und der Übungen des Tantra-Yoga kann uns die Notwendigkeit nahebringen, auf ein Gleiches für uns zu sinnen. Viele dieser Übungen knüpfen an die Visualisierung eines kreisförmigen Diagramms (mandala oder yantra) an. Die Spinne in ihrem Netz ist dem Inder ein Gleichnis für das Göttliche, das die Welt nach Stoff und Gestalt (Substanz und Figur) aus sich hervorbringt. Dieses Göttliche aber — Brahma — ist in uns als unsere Tiefe. Wir sitzen alle im Netze unserer Welt und wirken es mit den Projektionen unserer Schakti als Maya, die uns befängt. Diese naturhafte Befangenheit zu überwinden, lernt der Yogin ein dem Spinnweb entspre¬chendes Gebilde in innerer Visualisierung aus sich zu entwickeln, um sich als quellende Mitte zu breiten: eine figurerfüllte Ringzeichnung der Welt (mandala) oder ein zeichenbesetztes Diagramm von Linien, in denen die Welt oder die göttlichen Kräfte dargestellt sind, die sich zum Makrokosmos und Mikrokosmos entfalten. Er entfaltet es aus sich in innerer Schau und hält es fest als seine Wirklichkeit und nimmt es wieder schrittweis in sich zurück. So lernt er Entstehen und Vergehen der Welt als einen Vorgang be¬greifen, dessen Quell und Mitte er selbst ist. Das lehrt ihn die Freiheit, auch die Welt, wie sie naturhaft aus ihm quillt und ihn befangen hält, mit unbefangenem Auge zu betrachten: als Gebilde der geheimnisvollen Willkür seiner Tiefe, der Dränge und Triebe seiner Dämonie. Er lernt seine Schakti, die sich in stündlicher Kosmogonie ausgebiert, durchschauen und das Spiel ihrer Projek-tionen als das nehmen, was die Welt für Gott ist: — Maya, die er innerlich durchwaltet, ohne daß sie ihn berührt.
Der spirituelle Name Maya
Maya ist ein spiritueller Name für Aspirantinnen mit dem Durga, dem Shakti oder einem abstraktem Mantra. Maya heißt Kunst, außerordentliches Vermögen, Wunderkraft, Kunstgriff. Maya ist auch ein Beiname von Durga. Maya ist der Name für die Illusion dieser Welt. In der Vedanta gilt die Welt als Kraft von Brahman. Alle Erscheinungen in dieser Welt sind vergänglich und es gibt den Rat, der spirituellen Meister, das Leben nur als eine Illusion bzw. einen Traum zu sehen.
Wenn du Maya heißt, dann sieh hinter allem das Wirken von Brahman. Sei dir bewusst, dass was auch immer so fest aussieht, nicht so fest ist. Mache dir bewusst, dass hinter allem diese eine göttliche, kosmische Mutter ist. Maya, die göttliche Mutter, die großartige und außergewöhnliche Kunst göttliches Spiel, die Kraft der Illusion.
{{#ev:youtube|Xgeo1B7vQKo}
Siehe auch
- Mayashta
- Mayashtaka
- Mayi
- Mayin
- Annamaya
- Anandamaya
- Brahmamaya
- Tamomaya
- Mama
- Tvaya
- Infinitiv
- Illusion
- Täuschung
- Jnana Yoga
- Vedanta
- Vedanta Schulen
- Wer bin ich
- Erkenntnis
- Satchidananda
- Glückseligkeit
- Selbstverwirklichung
- Moksha
- Samadhi
- Surya Siddhanta
- Sanskrit Kurs Lektion 18
- Sanskrit Kurs Lektion 48
- Sanskrit Kurs Lektion 70
Literatur
- Swami Sivananda: Göttliche Erkenntnis
- Swami Sivananda: Inspirierende Geschichten
- Swami Sivananda, Die Kraft der Gedanken (2012)
- Swami Sivananda: Sadhana - Ein Lehrbuch mit Techniken zur spirituellen Vollkommenheit
- Swami Sivananda: Licht, Kraft und Weisheit
- Swami Sivananda: Japa Yoga
- Swami Sivananda: Die Wissenschaft des Pranayama
- Swami Sivananda: Die Überwindung der Furcht
- Swami Sivananda: Vedanta für Anfänger
- Swami Sivananda: Japa Yoga
- Swami Sivananda: Göttliches Elixier
- Swami Sivananda: Götter und Göttinnen im Hinduismus
- Swami Sivananda, Parabeln
- Swami Sivananda: Feste und Fastentage im Hinduismus, Yoga Vidya Verlag
- Heinrich Zimmer: "Weisheit Indiens. Märchen und Sinnbilder" 1938, L.C. Wittich Verlag, Darmstadt.
- Indische Sphären von Heinrich Zimmer, Rascher Verlag Zürich und Stuttgart, 1963, 2. Auflage
- Naturheilpraxis
Weblinks
- Swami Sivananda
- Artikel von Swami Sivananda
- Swami Sivanandas Integraler Yoga
- Der ganzheitliche Yoga in der Tradition von Swami Sivananda
- Die sechs Yoga-Wege
- Meditation & Yoga
- Einführung in Vedanta
- Swami Sivananda: Was ist Jnana Yoga?
- Swami Sivananda, Göttliche Erkenntnis: Vedanta
- Swami Sivananda, Sadhana: Vedanta Sadhana
- Internetseiten der Divine Life Society
- Internetseiten von Yoga Vidya
- Über Shankara
- Maya - die Kraft der Täuschung
Seminar
Jnana Yoga, Philosophie
Der RSS-Feed von https://www.yoga-vidya.de/seminare/interessengebiet/jnana-yoga-philosophie/?type=2365 konnte nicht geladen werden: Fehler beim Parsen von XML für RSS
Indische Meister
Der RSS-Feed von https://www.yoga-vidya.de/seminare/interessengebiet/indische-meister/?type=2365 konnte nicht geladen werden: Fehler beim Parsen von XML für RSS
Indische Schriften
Der RSS-Feed von https://www.yoga-vidya.de/seminare/interessengebiet/indische-schriften/?type=2365 konnte nicht geladen werden: Fehler beim Parsen von XML für RSS
Meditation
Der RSS-Feed von https://www.yoga-vidya.de/seminare/interessengebiet/meditation/?type=2365 konnte nicht geladen werden: Fehler beim Parsen von XML für RSS
Multimedia
Jnana Yoga und Vedanta - Einführung
<html5media>https://sukadev.podspot.de/files/01-jnana-yoga-vedanta-einfuehrung.mp3</html5media>
Vedanta - Grundbegriffe
<html5media>https://sukadev.podspot.de/files/02-vedanta-grundbegriffe-konzepte.mp3</html5media>
Shankaracharya – Leben und Werk des großen Vedanta Meisters
<html5media>https://sukadev.podspot.de/files/11-shankaracharya-leben-und-werk.mp3</html5media>
Vedanta Tiefenentspannung: Wer bin ich?
<html5media>https://daricha.podspot.de/files/85_Jnana_Yoga_Tiefenentspannung.mp3</html5media>
Satchidananda – deine Wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit
<html5media>https://sukadev.podspot.de/files/20-satchidananda-sein-wissen-glueckseligkeit.mp3</html5media>
Zusammenfassung Deutsch Sanskrit - Sanskrit Deutsch
Maya , Sanskrit मया mayā, f.
- Sanskrit Maya - Deutsch Wunderkraft, oder werk, Kunst; List, Trug, Täuschung, Gaukelei, Blendwerk