Stressmanagement - Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress
Die vorliegende Diplomarbeit Stressmanagement - Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress von Elke Krauss wurde im Rahmen des Pädagogikstudiengangs an der Universität Augsburg verfasst und beschäftigt sich mit der Progressiven Muskelentspannung, dem Autogene Training und dem Yoga in der Erwachsenenbildung. Inhaltlich werden die Themengebiete Gesundheit und Stress jeweils beleuchtet und Stressmanagment anhand zusammengetragener Entspannungsverfahren erläutert.
Einleitung
„In der Ruhe liegt die Kraft“ Diese 2500 Jahre alte, bekannte Weisheit des berühmten und einflussreichen chinesischen Philosophen K`ung-fu-tzu ist nach wie vor gültig und, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland des 21. Jahrhunderts, von besonderer Aktualität. „Arbeits-Stress“ etwa hat sich in den Industriestaaten laut einer repräsentativen Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der UNO zu einer „Jahrhundert-Epidemie“ entwickelt. Gesundheitsexperten gehen bereits 1970 davon aus, dass mehr als die Hälfte aller Krankheiten stressbedingt sind (vgl. Zimbardo 19956, S. 580). Bis 1995 ist diese Zahl weiter angestiegen: zwei Drittel aller Krankheiten sind inzwischen auf Stress zurückzuführen, und die Kosten für stressbedingte Krankheitsschäden verschlingen jährlich mindestens zehn Prozent des Bruttosozialproduktes (in Deutschland etwa 60 Milliarden DM) (vgl. Huber 1995, S. 21). Stress stellt kein neues Phänomen dar, allerdings sind sich Gesundheitswissenschaftler einig, dass der Stresspegel heute höher ist als je zuvor. Die Mehrzahl der Menschen leidet unter Erschöpfung und die wenigsten können den alltäglichen Dauerstress in Beruf, Familie und Freizeit bewältigen. In dieser hektischen, technologisierten, durch Konkurrenzkampf bestimmten, konsum- und leistungsorientierten Gesellschaft begegnen heute immer mehr Menschen durch die Kraft der Entspannung unzähligen Stressoren. Zunehmend wird erkannt, dass umfassendes Stressmanagement vom persönlichen Lebensstil jedes Einzelnen abhängt und die Forderung nach einer „Kultur der Entspannung“ (Vaitl; Petermann 20002, S. 21) wird laut. In den letzten Jahrzehnten haben sich verschiedene Entspannungstechniken (meist beeinflusst durch fernöstliche Methoden) in der westlichen Welt stark verbreitet. Die Palette der Angebote in diesem Bereich ist vielfältig. Unter Rubriken wie Reiki, Die fünf Tibeter, Feldenkrais, Tai Chi, Qi Gong, Meditation, Yoga, Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung (um nur einige zu nennen) sind mittlerweile eine fast unüberschaubare Menge an Kursen, Büchern und Videos auf dem Markt.
Allzu leicht sind viele Menschen versucht, diese Techniken als Humbug oder Spinnerei abzutun. Auch der in der Alltagssprache dafür gern verwendete Begriff „Esoterik“ , unter dem fast alle unorthodoxen Techniken zusammengefasst werden, die sich mit Körper, Seele und Geist auseinandersetzen, ist für die Mehrzahl der Menschen in der westlichen Welt negativ besetzt, oder hat zumindest einen unangenehmen Beigeschmack. Für meine Begriffe erstaunlich, da sich viele dieser Methoden beispielsweise in Kursangeboten der
Volkshochschulen, Krankenkassen und Fitnessstudios, in den psychiatrischen und therapeutischen Einrichtungen, in Rehabilitationszentren, teilweise sogar in den Schulen und Sonderschulen etabliert haben. Insofern scheint es von Bedeutung zu sein, zwischen Mythen und Fakten in diesem Bereich zu unterscheiden. Der Gedanke, über ausgewählte Entspannungsverfahren aufzuklären, ist einer der Gründe, warum ich diese Thematik im Rahmen einer Diplomarbeit wissenschaftlich beleuchte. Vergegenwärtigt man sich, dass beispielsweise schon vor sechs Jahren laut Unverzagt (1997) allein in Deutschland rund drei Millionen Menschen den Yoga praktizieren und damit neben einer Vielzahl von Vorteilen auf körperlicher, geistiger und seelischen Ebene auch besser mit Stress umgehen können, so fällt es schwer zu verstehen, dass sich die wissenschaftliche Forschung bisher kaum mit diesem Thema beschäftigt hat. Sachliche Aufklärung sowie fundierte empirische Studien wären hier von großem Nutzen, um Vorurteile, Irrtümer, falsche Anwendungen sowie übertriebene Erwartungen und Ängste bezüglich verschiedener Entspannungsverfahren innerhalb der Bevölkerung vorbeugen zu können. Mit dieser Arbeit möchte ich daher einen Schritt in diese Richtung machen und diskutiere, eingebettet in dem großen Rahmen Stressmanagement, folgende drei Entspannungsverfahren: die Progressive Muskelentspannung, das Autogene Training und den Yoga. Sie werden in dieser Arbeit als eine mögliche Bewältigungsmaßnahme von Stress dargestellt und in einen pädagogischen Zusammenhang gebracht. Dabei konzentriere ich mich auf den Bereich der Erwachsenbildung. Dass ich genau diese drei Entspannungsmethoden auswähle, ist einerseits mit persönlichem Interesse daran begründet und hängt andererseits mit dem Bekanntheitsgrad, der Verbreitung und damit einhergehend der wissenschaftlichen Erforschung dieser Methoden zusammen. Auf alle anderen Entspannungsverfahren einzugehen, würde zudem den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen. Innerhalb der pädagogischen Diskussion von Entspannungsverfahren setze ich den Schwerpunkt auf die Erwachsenenbildung aus folgenden Gründen. Erstens besteht auch hier die Notwendigkeit der thematischen Eingrenzung. Zweitens habe ich vor, in diesem Bereich tätig zu sein, weshalb es mir aus pragmatischen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint, mich im Laufe der Anfertigung der vorliegenden Arbeit mit theoretischen Aspekten der Erwachsenenbildung auseinander zu setzen.
Ein weiterer Grund, das Thema Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress im Rahmen dieser Diplomarbeit zu behandeln, ist subjektiver Art, nämlich der persönliche Bezug zu Entspannungsverfahren. Neben verschiedenen Methoden, wie Tai Chi, Qi Gong oder Meditation, die ich mir in Kursen an der Volkshochschule, der Universität und Meditationszentren angeeignet habe, erlernte ich vor drei Jahren auch das Autogene Training. Ich habe im Jahr 2000 zwei Kurse, einen Grund- und einen Aufbaukurs, an der Volkshochschule besucht, mit dem vorrangigen Grund vorbeugend ein Verfahren zu erlernen, um die anstehenden Diplom-Prüfungen zu bewältigen. Seither praktiziere ich es täglich. Des Weiteren lerne und praktiziere ich seit zwei Jahren den Yoga und interessiere mich ferner grundsätzlich für das Thema Gesundheit, vor allem für die Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und Seele, die ich als Einheit sehe. Zudem hatte ich bisher schon mehrfach die Gelegenheit, als „Entspannungslehrerin“ mit verschiedenen Zielgruppen zu arbeiten. Beispielsweise habe ich eine Klasse mit arbeitslosen ausländischen Mitbürgern zwischen 25 und 50 Jahren am BBZ im Fach Entspannung unterrichtet. Um Theorie und Praxis noch besser miteinander verbinden zu können, erscheint es mir sinnvoll meine theoretischen Kenntnisse zum Thema Stress und Entspannung im Zuge der Erstellung dieser Diplomarbeit zu vertiefen. Schließlich habe ich vor, nach Abschluss des Diplom-Pädagogik Studiums auf diesem Gebiet weitere praktische Erfahrungen zu sammeln. Anfangs als Dozentin für Entspannung und nachdem ich eine entsprechende Zusatzausbildung absolviert habe, auch als Yogalehrerin. Mit der Offenlegung des persönlichen Hintergrundes, weise ich darauf hin, dass ich eine gewisse praktische und theoretische Erfahrung diese Thematik betreffend aufweise, sie aber trotzdem aus einem neutralen, offenen und kritischen Blickwinkel heraus betrachte.
Das erste Ziel dieser Arbeit besteht in der Untersuchung der verschiedenen Aspekte des Stressgeschehens, der Auswirkung von Stress auf die Gesundheit und schließlich der ausgewählten Entspannungsverfahren als eine mögliche Maßnahme der Stressbewältigung. Dafür trage ich aus der Literatur die bisherigen Erkenntnisse zu dieser Thematik zusammen. Das zweite Ziel dieser Arbeit besteht in der pädagogischen Diskussion der ausgewählten Entspannungsverfahren. Die Frage, in welcher Form und mit welchen Zielen die vorgestellten Entspannungsverfahren speziell in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden können, gilt es zu beantworten. Die vorliegende Arbeit richtet sich an alle, sowohl Laien als auch Experten, die sich mit dem Thema Stressmanagement beschäftigen und daran interessiert sind, ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet zu vertiefen und zu erweitern.
Gesundheit
Die Begriffe Gesundheit und Krankheit sind eng verknüpft mit den Begriffen Entspannung und Stress. Stress ist wie eingangs schon erwähnt, gegenwärtig ein entscheidender Faktor, der zur Entstehung vieler Krankheiten beitragen kann. In diesem Kapitel setzte ich mich deshalb zunächst mit dem Gesundheits- und Krankheitsbegriff auseinander. Des Weiteren untersuche ich den Wandel im Gesundheits- und Krankheitsverständnis, und erörtere die aktuelle Situation diese Thematik betreffend. Schließlich stelle ich ein Gesundheitsmodell, das Modell der Salutogenese , vor.
Auseinandersetzung mit dem Gesundheitsbegriff
Auf den ersten Blick scheinen die Begriffe Gesundheit und Krankheit eindeutig definiert. Gesundheit lässt sich mit Wohlbefinden und Abwesenheit von Symptomen beschreiben. Mit Krankheit hingegen werden Beschwerden, Schmerzen und Einschränkungen verbunden. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Bereich die Begriffe Gesundheit und Krankheit unterschiedlich definiert sein können. Für manche ist Gesundheit gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Glück, andere verstehen darunter das Freisein von körperlichen Beschwerden und wieder andere verstehen darunter die Fähigkeit des Organismus, mit Belastungen fertig zu werden. Diese subjektiven Vorstellungen entwickeln sich in der Sozialisation jedes einzelnen und in einem spezifischen gesellschaftlichen Kontext. Die Wahrnehmung körperlicher Beeinträchtigungen wird durch die soziale und individuelle Einschätzung beeinflusst. Dieser Einschätzungsprozess ist zwar auch abhängig von der Schwere der Symptome, aber die Wahrnehmung von persönlichen und sozialen Ressourcen hat dennoch entscheidenden Einfluss auf die subjektive Befindlichkeit und auf das gesundheitsbezogene Verhalten einer Person (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15).
Ansätze zur Definition von Gesundheit
Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen zur Definition von Gesundheit und Krankheit, mit dem gemeinsamen Problem der klaren Grenzziehung zwischen dem, was noch als gesund, und dem, was schon als krank zu bezeichnen ist. Sie orientieren sich an unterschiedlichen Gesundheitsnormen. Die jeweiligen Definitionen haben einen Einfluss darauf, welche Mittel als angemessen und notwendig für die Wiederherstellung, für den Erhalt und die Förderung von Gesundheit angesehen werden. Zudem entscheiden sie darüber, welche Einflussmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten für die Krankheitsentstehung und Heilung einer Person zugeschrieben werden können oder sollen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15). Bereits die Wortstämme von Gesundheit und Krankheit geben entscheidende Hinweise zu möglichen Definitionsansätzen. Das deutsche Wort gesund kommt etymologisch vom germanischen „swend(i)a“ bzw. „(ga)sundia“, was so viel bedeutet wie stark, kräftig und geschwind (vgl. Haug 1991, S. 21). Das englische Wort „health“ (altenglisch: „hale“) hat ebenso wie das deutsche Wort „heil“ den Bedeutungsgehalt von ganz. Ein interessanter Hinweis der Alltagssprache scheint auch, dass im Englischen der Gegenpol zu Krankheit („dis-ease“) durch den Begriff „ease“ markiert wird, was sich annähernd mit Sorglosigkeit, Leichtigkeit und Behaglichkeit übersetzen lässt (vgl. Faltermaier 1994, S. 55).
Eine Idealnorm von Gesundheit bezeichnet einen Zustand von Vollkommenheit, den zu erreichen wünschenswert oder wertvoll ist. Mit ihrer Definition von Gesundheit als „Zustand eines vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit“ (zitiert nach Faltermaier 1994, S. 56) hat die World Health Organisation (WHO) 1948 eine Idealnorm gesetzt. Allerdings wird diese Definition hinsichtlich ihrer Realitätsferne kritisiert, da „absolute Zustände nicht zu erreichen sind“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15). Positiv zu bewerten ist meiner Meinung nach, dass diese Definition den Menschen in seiner Ganzheit anspricht, als Einheit von Körper und Psyche, aber auch als System, das nach außen offen ist, und in Interaktion mit der Umwelt Gesundheit schafft.
Die statistische Norm von Gesundheit wird durch Auftretenswahrscheinlichkeiten einer Eigenschaft des Organismus bestimmt. Was auf die Mehrzahl der Menschen zutrifft, wird als gesund definiert. Abweichungen von diesen Durchschnittswerten sind dagegen als krank zu bezeichnen. Für die Einordnung einer Person als krank oder gesund sind also die Bezugspopulation (Referenzgruppe, zum Beispiel nach Alter und Geschlecht) und die festgelegten Grenzwerte relevant (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15f.). Als system-funktionalistische Norm orientiert sich Gesundheit daran, ob eine Person in der Lage ist, die durch ihre sozialen Rollen gegebenen Aufgaben zu erfüllen. So definiert der Soziologe Talcott Parsons in den 1960ern Gesundheit als „Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist“ (Schiffer 2001, S. 39). Krankheit wird in diesem Zusammenhang als Form abweichenden Verhaltens verstanden, da die Unfähigkeit zur Rollenerfüllung das Fortbestehen eines sozialen Systems gefährdet (vgl. Faltermaier 1994, S. 29). Gesundheit als Leistung wird am unverblümtesten im Nationalsozialismus propagiert. Gesundheit wird zur Pflicht an der „Volksgemeinschaft“, Krankheit gilt als Verweigerung, und derjenige, dessen Arbeitskraft sich nicht wiederherstellen lässt, wird als unwert ausgegliedert (vgl. Schiffer 2001, S. 39).
Innerhalb des medizinischen Systems sind die Definitionen von Gesundheit in der Regel Negativbestimmungen, das heißt Gesundheit wird als Abwesenheit oder Freisein von Krankheiten beschrieben. Beim Vorhandensein von Beschwerden oder Symptomen wird eine Person als krank eingestuft. Dieses Begriffsverständnis der Experten, der Ärzte und Therapeuten trifft auf die Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sogenannter Laien, der Patienten. Diese rein biomedizinische Betrachtungsweise vernachlässigt wichtige Dimensionen des Befindens, wie z.B. Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden. Personen mit physischen Schädigungen können sich unter psychischen Gesichtspunkten als gesund bezeichnen, wenn sie sich trotz der Erkrankung beispielsweise ihre Genuss- und Leistungsfähigkeit erhalten können (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 16). Gesundheit ist also kein eindeutig definierbares Konstrukt; sie ist kaum fassbar und nur schwer zu beschreiben. Heute besteht in den Sozialwissenschaften und der Medizin Einigkeit darüber, dass Gesundheit mehrdimensional betrachtet werden muss. Neben körperlichem Wohlbefinden (z.B. positives Körpergefühl, Fehlen von Beschwerden und Krankheitsanzeichen) und psychischem Wohlbefinden (z.B. Freude, Glück, Lebenszufriedenheit) gehören auch Leistungsfähigkeit, Selbstverwirklichung und Sinnfindung dazu. Gesundheit hängt ab vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung und dem Umgang mit Belastungen, von Risiken und Gefährdungen durch die soziale und ökologische Umwelt sowie vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung, Erschließung und Inanspruchnahme von Ressourcen. Die sozialwissenschaftlichen Definitionsversuche des Phänomens Gesundheit zeichnen sich dabei durch eine Komplexität aus, die historisch betrachtet als Neu zu bezeichnen ist (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 15f.).
Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit stelle ich im folgenden eine entsprechende Konzeption von Gesundheit vor. Dabei schließe ich mich Faltermaier (1994) an, der auf Basis der einschlägigen Literatur einige Bestimmungsstücke von Gesundheit zusammengestellt hat. Gesundheit bedeutet demnach zunächst einen bestimmten körperlichen und psychischen Zustand des Individuums, der vom Subjekt erlebbar ist. Diese bestimmte Befindlichkeit (eine Art Wohlbefinden) impliziert eine relative Freiheit von Beschwerden, Beeinträchtigungen und Krankheit. Das Erleben von Gesundheit setzt in jedem Fall die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion einer Person voraus. Gesundheit bedeutet somit ein bestimmtes Verhältnis einer Person zu ihrem Körper und zu ihrer Psyche und ist insofern Teil der Identität einer Person. Gesundheit ist kein statischer Zustand, sondern in permanenter Veränderung, ist also ein Prozess, der immer wieder hergestellt werden muss, da sich das Individuum in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt ständig verändert. Daher setzt Gesundheit ein transaktionales Verständnis der Person-Umwelt-Interaktion voraus. Eine Person muss auf Anforderungen ihrer sozialen und ökologischen Umwelt reagieren und wirkt umgekehrt durch ihre Handlungen auf die Umgebung ein, gestaltet Beziehungen und die materielle Umwelt. Dadurch verändern sich die Person und ihre Umwelt.
Systemtheoretisch betrachtet ist die Person ein offenes System, das sich, wenn es gesund ist, in einem dynamischen Gleichgewicht befindet. Die Bedeutung der Gesundheit liegt darin, dass sie Voraussetzung für Lebensaktivitäten ist, auch dafür, sich im Leben zu verwirklichen: sie stellt demnach ein gewisses Potential dar, Ressourcen zu besitzen und mobilisieren zu können, um zu handeln. Gesundheit meint in diesem Sinne Handlungsfähigkeit, die gleichzeitig Leistungs- und Erlebnisfähigkeit umfasst. Was eine Person als ausreichendes Potential versteht und dann für sich als Gesundheit definiert, hängt von ihrer persönlichen Norm ab, die in vielfältiger Weise von sozialen Normen beeinflusst wird. Obwohl Gesundheit also immer eine Norm impliziert, muss ein Begriff von Gesundheit genügend offen bleiben, um auch Wachstums- und Entwicklungsprozesse einer Person erfassen zu können. Wenn Gesundheit immer im Wandel ist und immer wieder hergestellt wird, dann bedeutet das lebensgeschichtlich einen Entwicklungsprozess und in sozialer Hinsicht eine Sozialisation von Gesundheit. Gesundheit ist zwar zunächst ein Phänomen, das sich am Individuum bemerkbar macht, aber ohne den sozialen Kontext nicht verständlich ist. Wie eine Person mit ihrer sozialen Umwelt interagiert und dabei ihr dynamisches Gleichgewicht erhält ist ebenso wesentlich ein sozialer Prozess wie die Entwicklung ihres Potentials und ihrer Ressourcen. Gesundheit muss daher immer auch als soziale Kategorie verstanden werden (vgl. Faltermaier 1994, S. 57f.).
Glück und Wohlbefinden
Das Streben nach Glück und Wohlbefinden ist ein zentrales Anliegen des Menschen: „jeder Mensch möchte gern möglichst umfassend und möglichst immer glücklich sein und sich wohlfühlen“ (Abele; Becker 1991, S. 9). Da beide Begriffe eng mit dem Begriff der Gesundheit einer Person verbunden sind, schenke ich ihnen an dieser Stelle Beachtung.
Glück ist ein „komplexes Gebilde aus verschiedensten Emotionen, Einstellungen und Erfahrungen“ (Boeser; Schörner; Wolters 20022, S. 126). Das erschwert eine einheitliche wissenschaftliche Definition. Grundsätzlich wird zwischen einem aktuellem und einem habituellem Glückszustand unterschieden. Beispiele zur Komponente des aktuellen Glückserleben sind aus emotions- und gesundheitspsychologischer Sicht: Freude, sinnliche Erfahrungen und schöpferische Momente (vgl. ebd.). Aus persönlichkeitspsychologischer Sicht wird Glück als „ein harmonisches Zusammenwirken aller Gefühle einer ‚runden’ Persönlichkeit“ (ebd.) definiert. Damit ist gemeint, dass sich eine Person im Gleichgewicht befindet oder gesund ist. Nach meinem Begriff handelt es sich dabei um ein überdauerndes Gefühl, und kann insofern auch als habituelles Glück bezeichnet werden. Eine Möglichkeit diesen als „glückliche Befindlichkeit“ (ebd., S. 128) bezeichneten Zustand zu beeinflussen, ist „auf seine Gesundheit [zu] achten“ (ebd.; Anpassung: E. K.).
Wohlbefinden wird in der Fachliteratur nicht einheitlich und häufig ohne Bemühung um definitorische Präzision verwendet. In diesem Zusammenhang schlagen Abele; Becker (1991) vor, zwischen habituellem und aktuellem Wohlbefinden zu unterscheiden. Diese Einteilung wird kombiniert mit psychischem und physischem Wohlbefinden, woraus sich die in Abb.1. dargestellte Struktur des Wohlbefindens ergibt. Es handelt sich dabei um eine im thematischen Zusammenhang verkürzte Form, deren wesentliche Elemente ich nachfolgend beschreibe.

Abele; Becker (1991) definieren aktuelles Wohlbefinden als „Oberbegriff zur Charakterisierung des momentanen Erlebens einer Person, der positiv getönte Gefühle, Stimmungen und körperliche Empfindungen sowie das Fehlen von Beschwerden umfasst“ (S. 13). Bei habituellem Wohlbefinden handelt es sich um „Aussagen über das für eine Person typische Wohlbefinden, d.h. um Urteile über aggregierte emotionale Erfahrungen“ (ebd. S. 15). Durch den Begriff Urteile soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich dabei um ein Ergebnis kognitiver Prozesse handelt (vgl. ebd.). Die Gesundheitsdefinition der WHO beschreibt Gesundheit als einen Zustand des Wohlbefindens. Damit lässt sich Gesundheit zu der Kategorie des habituellen Wohlbefindens einordnen.
Psychisches Wohlbefinden ist unter anderem durch eine positive Stimmung gekennzeichnet. In Verbindung mit einem niedrigen Erregungszustand wird sie als Gelassenheit und als Entspannung (relaxation) bezeichnet (vgl. Abele; Becker 1991, S. 30f.). Physisches Wohlbefinden ist unter anderem durch positive körperliche Empfindungen gekennzeichnet, wie zB. der „Entspanntheit“ (ebd., S. 73). Anhand dieses Modells lassen sich meiner Meinung nach Entspannungsverfahren dem Begriff der Gesundheit zuordnen. Entspannungsverfahren wirken sich auf das psychische und körperliche Wohlbefinden bzw. die Gesundheit einer Person aus. Dabei tragen sie sowohl zu einem momentanen wie auch zu einem überdauernden Wohlbefinden der Person bei.
Gesundheit im Wandel der Zeit
Das Verständnis von Gesundheit und Krankheit unterliegt einem ständigem Wandel. Es ist geprägt von kulturellen und historischen Einflüssen, wie zum Beispiel Fortschritten in der Medizin, Umweltbelastungen oder Veränderungen des Lebensraumes und der Lebensweise. Bereits in der griechischen Antike beschäftigen sich Philosophen wie Plato, Aristoteles und Hippokrates mit der Gesundheit und deren Erhaltung. Gesundheit wird als das „höchste Gut“ (Haug 1991, S. 81) betrachtet. Exemplarisch beschreibe ich die Lehre von der Diaita (Regelung zur Lebensordnung) als Teil bedeutender gesundheitspädagogischer Werke und Fragmente (5./4.Jh. v.Chr.). Sie umfasst die gesamte Lebensweise des Menschen mit Regeln zur gesunden Lebensführung und basiert auf der Auffassung, jeder einzelne könne seine Gesundheit durch entsprechende Lebensführung erhalten. Die praktischen Anleitungen der sogenannten Diätik schließen alle Lebensbereiche ein und geben sehr konkrete Anweisungen zu Ernährung, Bewegung, Entspannung und Körperpflege. Insgesamt kann als Fundament dieser diätetischen Ausführungen die Erziehung zur Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung hinsichtlich psychophysischer Veränderungen betrachtet werden. Diese soll dem Einzelnen die Möglichkeit eröffnen, schon bei geringfügigen Störungen rechtzeitig eingreifen zu können, um den Schaden zu minimieren. Durch Selbstdisziplin, Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung wird der Mensch also fähig, sich seine Gesundheit zu bewahren. Der Anschein von Aufgeklärtheit und Mündigkeit wird jedoch relativiert, wenn man sich bewusst macht, dass dies ein Privileg einer kleinen männlichen Oberschicht und nicht für die breite Volksschicht gedacht war. Diese Ideen bilden dennoch die Basis der heutigen Hygiene und Medizin und stellen eine bestimmende Kraft für die Entwicklung europäischer Gesundheitsbildung dar (vgl. Haug 1991, S. 60ff.).
Eine ganz andere Sichtweise dominiert in der christlichen Gesundheitsbildung bis ins Mittelalter (ca. 6.-15.Jh.) hinein. Im Mittelpunkt steht hier das Erreichen des Seelenheils im Jenseits. Gesundheit und Krankheit werden „als göttliche Fügung verstanden, als Schicksal, gegen das der Mensch wenig machen kann, außer gottgefällig zu leben. Krankheit [wird] entsprechend als Strafe Gottes erlebt, als Buße für ein sündhaftes Leben, als Mahnung zur Rückbesinnung auf Gott“ (Faltermaier 1994, S. 69; Anpassung: E. K.). Man glaubt nicht daran, Gesundheit bzw. Krankheit beeinflussen zu können, da alles in „Gottes Hand“ liegt. Gesundheitsbildung beschränkt sich deshalb, wie es in der Regula von Benedikt von Nursia (um 430) heißt, darauf „den ohnehin schon zur Entfaltung drängenden Seelenkräften den ‚rechten Weg’ [zu] eröffnen“ (zitiert nach Haug 1991, S. 96; Anpassung: E. K.). Oder wie es Meister Eckhart (1260-1327) als „die vornehmste Aufgabe“ ansieht, die „Rückwendung der Seele zu Gott“ zu fördern, „damit der Mensch wieder zu einem Bild Gottes werde“ (ebd., S. 96). Die Bedeutung der körperlichen Gesundheit tritt also zugunsten des Strebens nach dem Seelenheil in den Hintergrund.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Geschichte der abendländischen Kultur auch „eine Geschichte der Leibfeindlichkeit“ darstellt, wobei insbesondere christliche Theoretiker predigen, dass die „Erlösung der Seele [...] nur für den zu erreichen [sei], der seinen Leib missachte“ (Kriegisch; Zittlau 19972, S. 182; Anpassung: E. K.). Der Körper einer Person mit seinen Bedürfnissen gilt als völlig unabhängig von deren Psyche.
Im Zeitalter der Aufklärung (17./18.Jh.) vollzieht sich eine Ablösung vom religiösen Weltbild und der Ständeordnung. Sie wird ausgelöst durch Fortschritte in den Naturwissenschaften und der Astronomie sowie durch aufklärerische Gedanken. Die objektive Ordnung, die noch bei dem Arzt, Naturphilosophen und Forscher Paracelsus (1493-1541) und bei Comenius (1592-1670) vorzufinden ist, weicht endgültig der subjektiven Ordnung des Individuums. „Es ist nicht mehr Gott, der Schöpfer, sondern das Individuum, das die Dinge in seiner Umgebung subjektiv ordnet“ (Haug 1991, S. 111). Gedanken wie beispielsweise von John Locke (1632-1704), der menschliche Geist sei von Geburt an eine „tabula rasa“ (leere Tafel), oder Kant (1724-1804), der Mensch könne sich aus „seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ befreien, stärken den Glauben an die Vernunft und die Allmacht der Erziehung. Damit nehmen sie aber auch das Volk selbst in die Verantwortung. Darüber hinaus hat Rousseaus Erziehungsroman „Emile“ (1762) weit über seine Epoche hinaus großen Einfluss.
„Sein Glaubensbekenntnis für die Natur’ und gegen die Unnatur’, die Kultur, gibt all denjenigen Kraft und Auftrieb, die auch Gesundheit als Folge und Konsequenz, natürlicher Erziehung und Entwicklung’ betrachten“ (Haug 1991, S. 115). Dieser Perspektivenwechsel hat entscheidenden Einfluss auf das allgemeine Gesundheitsverständnis. Gesundheit und Gesundheitsbildung wird zur Gemeinschaftsaufgabe der Gesellschaft erhoben. Die aus der Antike stammende Diätik wird von aufklärerischen Ärzten wie Hufeland, Tissot oder Triller wieder aufgegriffen und ein grundlegendes Gesundheitsprogramm erstellt (vgl. Faltermaier 1994). Osterhausen formuliert es in seinem zweibändigen Werk „Über medicinische Aufklärung“ (1798) wie folgt: „medicinische Aufklärung’ ist nichts anderes als der Ausgang eines Menschen aus seiner Unmündigkeit in Sachen, welche sein physisches Wohl betreffen’, sie ist die Verdrängung des Aberglaubens und der Vorurtheile in medicinischen Dingen und in Sachen, welche auf die Gesundheit des Menschen Einfluß haben’“ (zitiert nach Haug, 1991, S. 117). Adressat ist eine breite Bürgerschicht, die zu einer bewussteren Lebensführung und Mäßigung zum Beispiel bezüglich der Ernährung, Bekleidung, oder Konsum von Kaffee, Tabak und Alkohol, ermahnt wird. Der emanzipierte und mündige Bürger ist für seine Gesundheit, zuzüglich der „richtigen Benutzung der Ärzte“ (Faltermaier 1994, S. 71), selbst verantwortlich.
Mit Einsetzen der Industrialisierung (Mitte 19.Jh.) und ihren sozialen und wirtschaftlichen Folgen vollzieht sich ein neuerlicher Wandel. „Die Entdeckung der Zelle und der Mikroorganismen, als die damals bekannten kleinsten Grundbestandteile des Lebens, führen zu einer Revolutionierung des Gesundheitsverständnisses:
Gesundheit und Krankheit werden mehr und mehr als technisch-mechanische vom Individuum loslösbare Probleme betrachtet, die unter Anwendung von physikalisch-chemischen Verfahren beinflußt werden können“ (Haug 1991, S. 127). Aufgrund der Fortschritte in der experimentellen Forschung (z.B. Physiologie, Chemie, Pathologie) tritt die medizinische Kontrolle durch Experten, an Stelle der Selbstdiagnose, Selbstheilung und gesundheitlichen Selbstbestimmung des Laien. „Der unmündige Patient (patiens - leiden, erdulden, ertragen) ist geboren“ (ebd., S. 127). Aus dieser Entwicklung heraus entsteht das biomedizinische Krankheitsmodell (s.2.4.2).
Vom gesundheitserzieherischen Blickwinkel aus gesehen führt dies einerseits zu einer verstärkten Ausbildung naturwissenschaftlich geschulter Spezialisten und andererseits zur Hygieneerziehung, die zum Beispiel an den Schulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeführt wird (vgl. Haug 1991, S. 130f.). Dieser meistens im Rahmen der Biologie abgehaltene Hygieneunterricht vermittelt „welche biochemischen Einzelveränderungen im Körper vor sich gehen, welche Stoffe die Organe bei ihrer Tätigkeit umsetzen, welche Bakterien und Mikroorganismen bei den ‚Volksseuchen’ auftreten u.s.w.“ (ebd., S. 131). Gesundheitsbildung beschränkt sich somit weitgehend auf medizinische Sachaufklärung und nicht mehr auf die Vermittlung einer selbstverantwortlichen gesundheitsbewussten Lebensführung.
Parallel zu diesem Gesundheitsverständnis bilden sich auch alternative Positionen heraus, die dem ganzen Menschen und seinem Verhältnis zur Natur größere Bedeutung beimessen. Genannt seien hier der Theologe Sebastian Kneipp (1821-1897) als bekanntester Vertreter der Naturheilverfahren und die deutsche Jugendbewegung als Teil der pädagogischen Reformbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie haben jedoch nur punktuellen Einfluss auf die Gesundheitsbildung bzw. das Gesundheitsverständnis dieser Zeit, die gesamtgesellschaftlich gesehen durch das biomedizinische Krankheitsmodell dominiert wird (vgl. Haug 1991, S. 124ff.).
In der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) wird die Gesundheitserziehung bzw. -bildung für ideologische Zwecke missbraucht. Über das pädagogische Mittel der Massenerziehung wird die individuelle Gesundheit auf die Körperebene reduziert. Gesundheitspolitisches Ziel ist vor allem durch sportliche „Ertüchtigung“ „gesunde arische Soldaten“ und „gebärfreudige Mütter“ für die nahe Zukunft heranzuziehen. Die Ideologie der Reinheit der „Herrenrasse“ dient als machtfaktisches Instrument und zur Verfestigung des NS-Regimes. Für Behinderte und schwer chronisch kranke Menschen ist in diesem System, das vom Auslese- und Zuchtgedanken geprägt ist, kein Platz, weshalb viele in sogenannten „Euthanasieprogrammen“ von ihrem „unwerten Leben“ befreit werden (vgl. ebd., S. 151ff.). Dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte wird als bedeutsam angesehen, darf jedoch nicht verallgemeinernd für die Entwicklung des Gesundheitsverständnisses und der Gesundheitserziehung herangezogen werden, sondern muss vor dem Hintergrund eines diktatorisch-ideologischen Regimes getrennt betrachtet werden.
Nach dem zweiten Weltkrieg wird an die Entwicklungen vor 1933 anknüpft. Das medizinische Krankheitsmodell steht erneut hoch im Kurs. Die Schreckgespenster der vorangegangenen Jahrhunderte, wie Pest, Pocken, Cholera, Gelbfieber und Typhus werden in den Industrieländern weitgehend ausgerottet. Dafür bestimmen nach und nach neue Krankheiten, sogenannte Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck, Schlafstörungen, Herzkrankheiten, Magengeschwüre, Depressionen und Krebs das Alltagsleben. Sie sind das Produkt einer materialistisch eingestellten Leistungs- und Konsumgesellschaft, meist ausgelöst durch Dauerstress und eine krankmachende Lebensweise. Somit sieht sich die kurative (heilende) Medizin immer mehr chronisch-degenerativen Krankheiten gegenüber, deren Symptome sie zwar behandeln, aber in ihren Ursachen nicht besiegen kann. Im Jahre 1948 stellt sich die WHO mit ihrer positiven Definition von Gesundheit, gegen das weiterhin dominierende Krankheitsmodell. Im Anschluss daran (etwa seit 1950) beschäftigt sich vor allem die nordamerikanische wissenschaftliche Literatur verstärkt mit dem Thema Gesundheitserziehung (health education) bzw. Gesundheitsförderung (health promotion), was aber ebenso wie die WHO-Definition keinen wesentlichen Einfluss auf die Vormachtstellung der kurativen Medizin hat. Erst 1978 leitet die Konferenz der WHO von Alma Ata mit dem „Primary Health Care Konzept“ eine erste Umorientierung in der Gesundheitspolitik ein. Dieses Konzept findet später in der Ottawa-Charta von 1986 und dem „Health Promotion Ansatz“ seine Fortsetzung (vgl. Faltermaier, 1994, S. 58ff.).
Gesundheit – ein aktuelles Thema
Der Wandel im Denken über Gesundheit und Krankheit, der sich unter den Experten erst abzeichnet, hinkt den Veränderungen des Gesundheitsbewusstseins von Laien bereits hinterher. Das Wissen des Laien über Gesundheit und ihre Risikofaktoren sowie der Stellenwert der Gesundheit ist in der Gesellschaft enorm gestiegen. „Die aktuelle Karriere des Gesundheitsbegriffs verweist darauf, daß das Gesundheitsmotiv heute ein relevantes gesellschaftliches Problem geworden ist und ernst genommen wird. Die Menschen kümmern sich heute mehr um ihre Gesundheit und ihren Körper und überlassen sie nicht mehr ausschließlich den ärztlichen Experten“ (Faltermaier 1994, S. 12). Ein Beispiel dafür ist das starke Aufkommen von Selbsthilfegruppen, die nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland entstehen und seit 1970 bis heute ungebrochen boomen. Ein weiteres Beispiel ist die Renaissance alternativer Heilmethoden (z.B. Akupunktur) und die verstärkte Inanspruchnahme traditioneller Naturheilkräuter.
Nach Faltermaier (1994) spricht außerdem einiges dafür, dass sich „gegenwärtig [...] ein tiefgreifender Wandel in der Konzeption des Körpers vollzieht: Die funktionalistische Vorstellung vom Körper als Instrument und als Voraussetzung der eigenen Leistungsfähigkeit, der nicht wahrgenommen wird, solange er ‚störungsfrei läuft’ [...], wird überlagert und teilweise abgelöst von einem bewussteren Verständnis vom und Verhältnis zum Körper“ (S. 12; Auslassungen: E. K.).
Daneben hat die freie Marktwirtschaft diesen Trend zu mehr Selbstbestimmung und Körperbewusstsein schnell erkannt. In der Bundesrepublik wird mit Gesundheit geworben, der „Körper-Kult“ (Faltermaier 1994, S. 12), als übersteigerte Form dieses neuen Körperbewusstseins wird geschürt. Zahlreiche Zeitschriften, die sich mit entsprechenden Themen auseinandersetzen (beispielsweise „Fit For Fun“ oder „Men’s Health“) sind ein deutlicher Beleg dafür. Der freie Markt macht große Gewinne, zum Beispiel mit „biologisch wertvollen“ Lebensmitteln, mit Fitness- bis hin zu Selbsterfahrungskursen und besonders mit einem facettenreichen Freizeitsportangebot.
Der Kölner Wirtschaftswissenschaftler und Experte für Informationstechnologie Leo Nefiodow prophezeit, dass Gesundheit, verstanden als ein „Streben nach einer ganzheitlich verstandenen Gesundheit“ (Schwab 1997, S. 29), die entscheidende Wachstumsbranche des 21. Jahrhunderts, sein wird. Die von Dauerkrisen geplagten Gesellschaften des Westens müssten gleichsam an Leib und Seele gesunden: nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial. Dies schaffe einen ganz neuen Aspekt von Gesundheit. Das Geschäft mit der Gesundheit lasse sich somit als Motor der Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert verstehen, womit Heilung selbst zu einer ökonomischen Macht werden würde. Komplexe Beziehungsfelder (soziale, gesundheitliche und psychische) rückten in den Vordergrund. Während in der Industriegesellschaft vor allem materielle Produkte nachgefragt wurden, gehe es jetzt im wesentlichen um immaterielle Güter wie z.B. Dienstleistungen, Pflege und Betreuung. Erstmals in der Geschichte scheinen Wirtschaftswachstum und Strukturwandel nicht mehr primär von Rohstoffen, Maschinen und deren Anwendungen abhängig, sondern von „Fortschritten im Menschlichen“ (ebd.). Solche Fortschritte bedeuteten unter anderem die „Sicherung einer guten psychosomatischen Gesundheit oder eine bessere Wechselwirkung zwischen Körper, Seele und Geist“ (Schwab 1997, S. 30). Ob der Wirtschafts-Visionär tatsächlich als einer der „angesehensten Vordenker der Informationsgesellschaft“ (ebd., S. 30) gelten kann, wird die Zeit beweisen. Eine „Megabranche Gesundheit“ (ebd. S. 21) als Motor der Weltwirtschaft wäre aber nicht nur der Ökonomie hochwillkommen, sie würde zudem jedem einzelnen in diesem Jahrtausend gut tun. Für Nefiodow lassen sich durch eine Verbesserung der psychosozialen Gesundheit nicht nur destruktive und produktionshinderliche Verhaltensweisen vermeiden, sondern auch kreative und produktive Potentiale des Menschen mobilisieren. Und tatsächlich klingt sein Argument plausibel, dass durch eine „bessere Beherrschung psychischer Phänomene“ riesige Einsparungen erreicht und jene Ressourcen freigesetzt werden könnten, die zur Erschließung neuer Märkte notwendig wären. Mit nur 5% weniger „psychosoziale Destruktivität“ (ebd. 29), beispielsweise in Form von psychischen Störungen, Gewalttätigkeit oder Drogen könnten mehrere hundert Milliarden US-Dollar eingespart werden und einen Konjunkturschub auslösen, der Millionen neue Arbeitsplätze schaffen würde. Nach Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation gilt nämlich gegenwärtig bereits jeder siebte US-Amerikaner, wahrscheinlich jeder siebte Bürger der Welt als psychisch krank (vgl. Schwab 1997, S. 29f.). Im „Megamarkt Gesundheit“ haben alle entwickelten Nationen eine Chance. Sehr günstig sind die Ausgangsbedingungen aber für Europäer: in allen gesundheitsorientierten Branchen ist die europäische Wirtschaft führend, die Nachfrage liegt auf hohem Niveau und es besteht eine moderne und ausbaufähige Gesundheitsinfrastruktur (vgl. Schwab 1997, S. 21ff.).
Ein weiterer aktueller Trend die Gesundheit betreffend, fällt unter das Stichwort Wellness , von Tenzer (2003) auch als das „Widerstandsprogramm gegen den Alltagsstress“ (S. 20) bezeichnet. Es sei ein „geeignetes Mittel um sich körperlich und seelisch widerstandsfähiger“ (ebd., S. 20) zu machen. Der Begriff Wellness ist viel älter, als angesichts des Booms in diesem Bereich zu vermuten ist: „er taucht schon 1654 in einem englischen Lexikon auf und meint dort so viel wie Wohlbefinden und gute Gesundheit“ (ebd.). Populär wird der Ausdruck in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts durch den Arzt Halbert L. Dunn, der ihn zum Schlagwort einer neuen Gesundheitsbewegung macht. Er bezeichnet seine Gesundheitsphilosophie als „High Level Wellness“ (Tenzer 2003, S. 22) und meint damit einen eigenverantwortlichen Lebensstil, der die Gesundheit optimal fördern soll. Der Wellnessbegriff schlägt seit 1970 in Deutschland Wurzeln. Laut einer repräsentativen Befragung von Frauen, kennen gegenwärtig 82% den Begriff (vgl. Tenzer 2003, S. 22). Dies ist nicht weiter verwunderlich, da Wellness ein Modethema für Frauenzeitschriften und Werbestrategien ist. Die Umsätze in dieser Branche steigen, da Wellnessangebote, wie z.B. der Yoga, verstärkt wahrgenommen werden.
„Der moderne Kopfmensch besinnt sich nun auf dieses alte Wissen, denn er hat Nachholbedarf. Sein verspannter Muskelapparat erinnert ihn täglich daran, dass ihm Bewegung fehlt, Stress nagt an den Nerven, Fehlhaltungen schmerzen, Speckröllchen wachsen. Wellness ist gefragt, weil vielen Menschen Körpergefühl und Sinnlichkeit abhanden gekommen sind“ (ebd., S. 20). Wellness steht laut einer Studie der Heidelberger Gesellschaft für Innovative Marktforschung unter anderem für Entspannung und Stressbewältigung und kommt der Sehnsucht nach einer Balance von Körper, Geist und Seele entgegen. Dabei gehe es um „Ziele wie Stressverarbeitung, erlebte Selbstwirksamkeit, Vitalität, Genussfähigkeit sowie ein positives Selbstkonzept“ (vgl. Tenzer 2003, S. 22). Es ist außerdem ein Mittel für das Selbstmanagement, da Wellness gleichzeitig „als Therapieersatz Kraft, Lebensfreude, ein gutes Körpergefühl, sinnstiftend und identitätsfördernd“ (ebd.) sei. Es handelt sich um „eine aktive selbstverantwortliche Gesundheitsvorsorge, die Ressourcen für ein erfolgreiches und erfülltes Leben sicherstellt“ (ebd.). In diesem Sinn soll Wellness neben Entspannung auch die Leistungsfähigkeit fördern. Auch in diesem Bereich zeichnet sich laut Tenzer (2003) ein „Megatrend“ (S. 23) ab, der viele Bereiche der Wirtschaft zurücklässt. Der Soziologe Matthias Horx, bringt damit vor allem drei große gesamtgesellschaftliche Trends in Verbindung: die Individualisierung, die Notwendigkeit einer eigenverantwortlichen Gesundheitsvorsorge und moderne Arbeitsformen. Das Individuum sei gefordert, sich seelisch und körperlich fit zu halten: „wenn es [...] viel leistet, soll es sich [...] aktiv und eigenverantwortlich um seine Regeneration kümmern“ (ebd.; Auslassungen: E. K.). Damit sichert Wellness die persönlichen Ressourcen und somit auch die Zukunftsfähigkeit und bedeutet letztlich „Pflege des immer wichtiger werdenden Humankapitals“ (ebd.). Demnach bildet Wellness und damit auch Entspannungsverfahren sowohl psychisches als auch physisches Kapital, was nach Tenzer vergleichbar mit dem „lebenslangen Lernen“ ist (ebd.).
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die Verantwortung für Gesundheit von der rein medizinischen Versorgung durch gesamtgesellschaftliche und politische Aspekte erweitert und sich das selbstbestimmte Gesundheitshandeln einer Person gestärkt hat. Damit hängt allerdings auch ein gesunkenes Vertrauen in die Ärzteschaft zusammen, was zur Folge haben kann, dass der Arztbesuch im Krankheitsfall zu lange hinausgezögert und so die Krankheit erst dann zu einem ernsten Gesundheitsrisiko wird. Die „Gefahr einer Individualisierung der Verantwortung“ (Faltermaier 1994, S. 72) sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Auch die angesprochene freie Marktwirtschaft bringt Probleme für den Einzelnen mit sich. Sie läuft Gefahr, Gesundheit zur „Ware“ verkommen zu lassen. Denn durch Überangebote und Halbwahrheiten werden Orientierungsprobleme geschaffen, die zu unbewusst gesundheitsschädigendem Handeln führen können. So stellt beispielsweise die „Freizeitindustrie“ (Hurrelmann 1990, S. 176) unzählige Angebote für eine Person bereit. Damit kann Freizeitspaß leicht zu krankmachendem Freizeitstress umschlagen. Außerdem wird z.B. mit einer entspannenden Wirkung von Alkoholtrinken oder Zigarettenrauchen geworben. Beides ist erwiesenermaßen gesundheitsschädlich (vgl. Corazza et al. 2001) und versetzt den Körper in einen Stresszustand, selbst wenn sich eine Person dabei entspannt fühlt. In diesem Sinne bieten sich meiner Meinung nach Entspannungsverfahren, richtig und kontrolliert angewendet, als eine sinnvolle und zugleich angenehme Freizeitbeschäftigung an, und stellen gleichzeitig eine gesundheitserhaltende Maßnahme dar.
Das Modell der Salutogenese-eine Theorie der Gesundheit
Das Thema Salutogenese hat in jüngerer Zeit in den Sozialwissenschaften und in der Medizin, vor allem in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung, viel Aufmerksamkeit erfahren. Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923-1994) hat dieses Konzept in die gesundheitswissenschaftliche und gesundheitspolitische Diskussion eingebracht. Er kritisiert eine rein pathologisch-kurative Betrachtungsweise und stellt ihr eine salutogenetische Perspektive gegenüber. Die Frage, warum Menschen gesund bleiben, soll Vorrang vor der Frage nach den Ursachen von Krankheiten und Risikofaktoren bekommen. Dementsprechend fragt die salutogenetische Perspektive primär nach den Bedingungen von Gesundheit und nach den Faktoren, welche die Gesundheit schützen und zur Unverletzlichkeit beitragen. Die Frage nach den Wirkfaktoren für die Erhaltung von Gesundheit steht dabei im Mittelpunkt. Teilweise ist bereits die Rede von einem Paradigmenwechsel: „von einem krankheitszentrierten Modell der Pathogenese hin zu einem gesundheitsbezogenen, ressourcenorientierten und präventiv ansetzenden Modell der Salutogenese“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20017, S. 9).
Bevor ich das Konzept der Salutogenese näher darstelle, beschreibe ich zunächst dessen Entstehungshintergrund und Kontext. Das Modell der Salutogenese und Antonvskys Thesen sind nur zu verstehen, wenn man sie vor dem Hintergrund der Entwicklungen und Strömungen in der Gesundheitsversorgung und in den Gesundheitswissenschaften der letzten fünfzig Jahre interpretiert. Dazu beschreibe ich folgende parallel verlaufende Entwicklungen: die Kritik am System der Gesundheitsversorgung, die Entwicklung eines biopsychosozialen Krankheitsmodells und die Veränderungen in der Prävention und der Gesundheitsförderung.
Kritik am System der Gesundheitsversorgung
Das System der Gesundheitsversorgung bzw. Krankenbehandlung in der Bundesrepublik Deutschland ist geprägt durch ein Handeln und Denken, das häufig als pathogenetische Betrachtungsweise (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 14) gekennzeichnet wird: im Mittelpunkt stehen die Beschwerden, Symptome oder Schmerzen des Patienten. Alle Anstrengungen des medizinischen Systems, der Ärzte und Therapeuten, richten sich auf die Diagnose und das möglichst schnelle Beseitigen der Symptome und Beschwerden. Die Erwartungen des Patienten an die Möglichkeiten des medizinischen Versorgungssystems sind hoch. In den vergangenen Jahrzehnten konnten wie bereits angesprochen beeindruckende Erfolge in Diagnostik und Therapie vieler Erkrankungen erzielt werden. Nichtsdestotrotz wird in den letzten Jahren zunehmend Kritik an der sogenannten Apparatmedizin und der primären Orientierung an Symptomen laut. Unter dem Eindruck einer immer stärkeren Technisierung der Medizin wird die Vernachlässigung der Person (also die Vernachlässigung der Ganzheitlichkeit) beklagt. Ferner sei unser gesundheitliches Versorgungssystem zu teuer, könne nicht angemessen auf die Zunahme chronischer Erkrankungen reagieren und würde sich nicht genügend mit ethischen Fragestellungen befassen. Gefordert wird eine „sprechende Medizin“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 14), die sich nicht nur an der Krankheit und Behinderung orientiert und mit hohem technischen Aufwand diagnostiziert, sondern dem Gespräch zwischen Arzt und Patienten einen hohen Stellenwert gibt, die gesunden Anteile des Patienten wahrnimmt und fördert sowie psychosoziale Aspekte der Krankheitsanpassung und Heilung mit einbezieht.
Entwicklung eines biopsychosozialen Modells
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt sich unter dem Einfluss naturwissenschaftlichen Denkens ein Krankheitsverständnis, das als biomedizinisches Krankheitsmodell bezeichnet wird (s.2.2). Dieses Modell
geht davon aus, dass der menschliche Körper mit einer Maschine vergleichbar ist, deren Funktionen und Funktionsstörungen verstanden werden können, indem die Organsysteme und –strukturen sowie die physiologischen Prozesse möglichst genau analysiert werden. Krankheitssymptome (körperliche und psychische Beschwerden) werden durch organische Defekte erklärt. Diese anatomischen oder physiologischen Defekte bilden die eigentliche Krankheit. Für die Entstehung des Defekts wird angenommen, dass es eine begrenzte Zahl von Ursachen gibt, so zum Beispiel Bakterien und Viren. Entscheidend ist das Erkennen des Defekts und die Suche nach Möglichkeiten, ihn zu beheben. Diese Grundannahmen bestimmen den Umgang mit körperlichen Beschwerden. Die Bestimmung, ob eine Person als krank bezeichnet werden kann, hängt davon ab, ob anatomische oder physiologische Veränderungen festgestellt werden können. Der kranke Mensch als Subjekt und Handelnder wird weitgehend ausgeklammert. Er ist passives Objekt physikalischer Prozesse, auf die seine psychische und soziale Wirkung keinen Einfluss haben (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 17). Medizinische Forschung, die dem biomedizinischen Krankheitsmodell folgt, konzentriert sich auf die Entdeckung bisher unbekannter Defekte und den Nachweis, dass diese die Ursache für die Krankheit sind. Die medizinische Behandlung zielt demnach darauf ab, den Defekt zu beheben (vgl. Faltermaier 1994, S. 20ff.). Dieses Krankheitsverständnis hat in vielen Bereichen zu großen medizinischen Fortschritten geführt, beispielsweise bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten (s. 2.2).
Dem biomedizinischen Modell stellt der Sozialmediziner Engel Ende der 1970er ein erweitertes, biopsychosoziales Modell gegenüber, in dem sowohl somatische als auch psychosoziale Faktoren zur Erklärung von Krankheiten herangezogen werden. Sozialwissenschaftliche, psychologische und psychosomatische Forschungsbefunde belegen, dass psychische und soziale Faktoren bei der Entstehung und im Verlauf von Krankheiten von Bedeutung sind. Auch das Erstellen einer Diagnose und die Behandlung der Erkrankung werden davon beeinflusst. Beispielsweise werden bereits die Wahrnehmung von Symptomen, das Schmerzerleben, die Inanspruchnahme medizinischer Versorgung und das Befolgen von ärztlichen Anordnungen entscheidend von psychischen und sozialen Faktoren beeinflusst (vgl. Bengel, Strittmatter; Willmann 20027, S. 17). Auch die psychobiologische Bewältigungs- und Stressforschung beginnt zu fragen, welche protektiven Ressourcen der Organismus unter Belastungsbedingungen beispielsweise über das Immunsystem aktivieren kann. Sie folgt damit nicht mehr ausschließlich einem Vulnerabilitätskonzept , das untersucht, wie psychische Belastungen über psychophysiologische Prozesse pathogenetisch wirksam werden (vgl. ebd.). Heute sind in diesem interdisziplinären gesundheitswissenschaftlichen Feld zahlreiche Fächer aktiv, wie beispielsweise die Medizinische Psychologie, die psychosomatische Medizin, die Gesundheitspsychologie, die Verhaltensmedizin und die Psychoneuroimmunologie (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 84).
Vulnerabilität ist definiert als „Verwundbarkeit“ bzw. „Verletzlichkeit“ (Wermke et al. 20017, S. 1040). Psychoneuroimmunologie: Relativ junges Forschungsgebiet, welches Wissen und Methodik der Psychologie und verschiedener medizinischen Teildisziplinen integriert, um zu untersuchen, welche Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Systemen des Körpers bestehen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 17f.).
Mit der Erweiterung des biomedizinischen Modells um psychische Bedingungsfaktoren ist jedoch nicht immer eine grundsätzliche Neuorientierung in der Auseinandersetzung mit Gesundheit verbunden. Oft orientieren sich die Formulierungen biopsychosozialer Modelle ebenfalls an einem Defizitmodell des Menschen. Deutlich wird diese Tendenz bei der gesundheitspolitischen Forderung nach präventiven Konzepten und Maßnahmen. Auf den ersten Blick erscheint dies als Neuorientierung und Distanzierung vom kurativen System. Bei näherer Betrachtung sind die pragmatischen Präventionskonzepte, die sich unter dem Begriff der Früherkennung und Gesundheitserziehung subsumieren lassen, geprägt von medizinischem Denken, auch wenn gerade bei letzteren psychologisches Wissen integriert ist. Trotz der vielfältigen Kritik und obwohl gerade bei den zunehmenden chronisch-degenerativen Erkrankungen (Verschleißerkrankungen) die Bedeutung von psychosozialen und kulturellen Faktoren nachgewiesen ist, bestimmt nach wie vor das biomedizinische Krankheitsmodell sowohl die heutige Schulmedizin als auch die Prävention.
Entwicklung der Prävention und Gesundheitsförderung
Wie bereits angesprochen, hat es in der gesamten Geschichte der Medizin Anstrengungen gegeben, Krankheiten zu verhüten. Ganz besondere Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung haben Maßnahmen, welche die hygienische Versorgung der Bevölkerung betreffen, sowie Massenimpfungsprogramme, wie sie nach dem zweiten Weltkrieg eingeführt werden (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 18). Im Mittelpunkt präventiver Anstrengungen steht gegenwärtig vor allem die Vermeidung der bereits angesprochenen Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Krebs, Rheuma, Allergien, Magen-Darmerkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates und psychische Störungen. Diese verlaufen meist chronisch und degenerativ und häufen sich mit zunehmendem Alter (vgl. Faltermaier 1994, S. 17). Zivilisationskrankheiten sind solche Erkrankungen, die in industrialisierten Staaten in großer Anzahl vorkommen. Es handelt sich dabei um körperliche, geistige und seelische Schäden als Folge von unangemessener Nutzung zivilisierter Errungenschaften und Schädigungen durch die Produktion von Zivilisationsgüter. Der Brockhaus (20029) spricht bei Zivilisationskrankheiten von Erkrankungen, „die durch zivilisatorische Einflüsse hervorgerufen oder gefördert werden“ (Brockhaus, S. 1013).
Bewegungsmangel, einseitige Ernährung, Nikotin- und Alkoholmissbrauch, in weiterem Sinne auch schädigende Umwelteinflüsse sind per Definition mit Einflüssen der Zivilisation gemeint. Bezugnehmend auf das Thema Entspannung gehe ich auf den Aspekt der Bewegung näher ein. Bewegungsmangel entsteht beispielsweise, wenn eine Person eine vorwiegend sitzende Tätigkeit ausübt. Hierzu zählen das Sitzen im Auto und Büro ebenso wie das Sitzen am PC oder beim Fernsehen. Der Bewegungsapparat einer Person setzt sich zusammen aus Muskeln, Bändern, Knorpeln und Knochen. In Kombination eingesetzt, ergeben sie die Tätigkeit „sich bewegen“. Diese geht einher mit Anspannung und Entspannung. Die Verspannung der Muskulatur ist eine häufige Erscheinung der modernen Zivilisation. Hiervon betroffen sind bevorzugt die Muskulatur von Nacken und Schultern. Besonders häufig kommt es zu Verspannungen bei monotonen Arbeitsprozessen, wie beispielsweise Fließbandarbeiten oder Computerarbeiten (vgl. Corazza et al. 2001).
Durch die zunehmend technische und computergesteuerte Arbeitswelt wird Bewegung im Berufsalltag immer seltener; andererseits aber fordern hochtechnische Geräte erhöhte Aufmerksamkeit und erzeugen vermehrt Stresssituationen. Zum Ausgleich einseitiger und mangelnder Bewegung bieten die Volkshochschulen z.B. Yoga-Kurse an. Um Stress zu bewältigen, gibt es eine Reihe von Entspannungsangeboten wie z.B. Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training und Yoga. Ein Entspannungsverfahren zu praktizieren stellt demnach eine Möglichkeit dar, Bewegungsmangel vorzubeugen und/oder zu beheben.
Basis für präventive Maßnahmen ist das Risikofaktorenmodell. Dieses wird auf der Grundlage von Ergebnissen epidemiologischer Studien und Statistiken von Lebensversicherungsgesellschaften in den 1950ern entwickelt, bei der Erforschung der koronaren Herzerkrankung (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 18). Demnach bestehen Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren wie zum Beispiel hohe Blutfettwerte, Tabakkonsum, Bluthochdruck, Übergewicht, psychische Stressoren und dem Auftreten von koronaren Herzerkrankungen (vor allem in Form von Herzinfarkten). Je mehr Risikofaktoren, insbesondere bei Männern, vorliegen, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen. Wie bei jedem statistischen (Wahrscheinlichkeits-) Modell treffen solche Aussagen nur bei einem bestimmten Prozentsatz der untersuchten Personen zu. Demzufolge können aus dem Zusammentreffen (Korrelation) von Risikofaktoren und Erkrankung keine ursächlichen, kausalen Interpretationen oder Vorhersagen über die Morbidität bzw. Mortalität einzelner abgeleitet werden. Die Wirkung der Risikofaktoren ist für die einzelne Person nicht zwangsläufig; es kann nur eine erhöhte Erkrankungswahrscheinlichkeit angenommen werden. Einige Forschungsergebnisse zum Stellenwert verschiedener Risikofaktoren und deren Wechselwirkungen sowie der Festlegung von kritischen Werten (ab wann ist ein Risikofaktor gefährlich?) und Einwirkungszeiten (wie lange muss ein Risikofaktor bestehen?) sind widersprüchlich. Da Risikofaktoren als beginnende Krankheit aufgefasst werden, konzentriert sich die Prävention auf die Vermeidung von Risikofaktoren und auf individuelle Verhaltensänderungen. Bisher sind im Risikofaktorenmodell überwiegend sogenannte verhaltensgebundene Risikofaktoren (wie zum Beispiel Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck) enthalten, während die kontext- und verhältnisbezogenen Risikofaktoren (zum Beispiel chronische Arbeitsbelastung, Umwelteinflüsse) noch vernachlässigt werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund setzt man in der Umsetzung des Modells vor allem auf individuelle Verhaltensänderungen.
Spätestens seit der WHO-Konferenz von Alma Ata (s.2.2) und der Proklamation „Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“ wird eine Ergänzung des biomedizinischen Risikofaktorenmodells und den mit diesem Modell verbundenen Implikationen als wichtig erachtet. Mit der Ottawa-Charta stellt die WHO 1986 das Programm zur Gesundheitsförderung (Health Promotion) vor. Dort heißt es:
Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozeß, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und Umwelt zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. [...] Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, daß man sich um sich selbst und für andere sorgt, daß man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, daß die Gesellschaft in der man lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen (zitiert nach Keupp 1997, S. 45; Auslassung: E. K.).
Die Gesundheitsförderung als ein sozial-ökologisches Gesundheits- und Präventionsmodell betrachtet Gesundheit nicht als Ziel, sondern als Mittel, um Individuen zu befähigen, individuelles und gesellschaftliches Leben positiv zu gestalten. Präventive Maßnahmen werden somit nicht durch das professionelle System verordnet. Sie zielen auf die aktive und selbstverantwortliche Beteiligung einer Person an der Herstellung gesundheitsfördernder Bedingungen und auf den Dialog und die Interaktion zwischen Laien und Professionellen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 19). Mit dieser Zielsetzung zeigt die Gesundheitsförderung große Nähe zum Empowerment-Ansatz, der aus der amerikanischen Gemeindepsychologie stammt. Handlungsziel der Empowerment-Praxis ist nach (Herriger 1997) „Menschen vielfältige Vorräte von Ressourcen für ein gelingendes Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen, auf die diese ‚bei Bedarf’ zurückgreifen können, um Lebensstärke und Kompetenz zur Selbstgestaltung der Lebenswelt zu gewinnen“ (S. 15) sowie „Menschen zur Entdeckung ihrer eigenen (vielfach verschütteten) Stärken zu ermutigen, ihre Fähigkeiten zu Selbstbestimmung und Selbstveränderung zu stärken“ (S. 7). Empowerment meint also den Prozess, innerhalb dessen Kompetenzen, Eigenverantwortlichkeit und Selbsthilfefähigkeit von Personen oder Gruppen gestärkt werden (vgl. Keupp 1997, S. 45f.). Damit ist Gesundheitsförderung auch eine politische und gesellschaftsverändernde Aufgabe, was die praktische Umsetzung nicht gerade vereinfacht (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 19). Der Ansatz der Gesundheitsförderung greift die Entwicklungen im Gesundheits- und Krankheitsverständnis auf (s.2.2). Er legt einen komplexen mehrdimensionalen Gesundheitsbegriff zugrunde und baut auf einem biopsychosozialen Krankheitsmodell auf.
Das Konzept der Salutogenese
Antonovsky war in der Stressforschung tätig und entwickelte schrittweise im Laufe seines beruflichen Werdegangs ein Modell, welches Gesundheit und Krankheit aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachtet als das medizinische Krankheitsmodell. Damit eröffnet er neue Perspektiven und Problemstellungen für die Gesundheitsforschung und -praxis (vgl. Faltermaier 1994, S. 43ff.). Aufgrund von epidemiologischen Daten über die Morbidität aller Erkrankungsarten in den USA kommt er Anfang der 1980er zu dem Schluss, dass „Krankheiten nicht etwa Ausnahme sind, sondern sich zu jedem Zeitpunkt mindestens ein Drittel der Bevölkerung (wahrscheinlich sogar die Mehrheit) im Zustand irgendeiner Krankheit befindet. Krankheit als „Abweichung ist also eher „normal“; Gesundheit als die Norm ist gar nicht so verbreitet“ (Faltermaier, 1994, S. 44). Mit dem Modell der Salutogenese will Antonovsky eine Antwort auf die für ihn zentrale und leitende Fragestellung geben, nämlich was den Menschen trotz vieler potentiell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund erhält.
Der Begriff der Salutogenese ist ein Neologismus (sprachliche Neubildung), den Antonovsky als Gegenbegriff zur bisher dominierenden Pathogenese des biomedizinischen Ansatzes und des derzeitigen Krankheitsmodells, aber auch des Risikofaktorenmodells setzt (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 24; Faltermaier 1994, S. 45). Dabei geht er von einem Postulat aus, das einer philosophischen Grundposition gleichkommt: Leben bedeutet nicht im Gleichgewicht, sondern im Ungleichgewicht zu sein. Das Grundprinzip menschlicher Existenz ist demnach nicht Heterostase sondern Homöostase , das heißt Leiden und Tod sind ebenso wie Glück und Wohlbefinden Bestandteil menschlichen Lebens. Die ausschlaggebende Frage ist wie das System erhalten wird (vgl. Faltermaier 1994, S. 45). Er formuliert mit dem Modell der Salutogenese eine „Theorie der Gesundheit“ (Faltermaier 1994, S. 48). Diese ist in Abb.2. schematisch dargestellt und nachfolgend in ihren wesentlichen Zügen beschrieben.
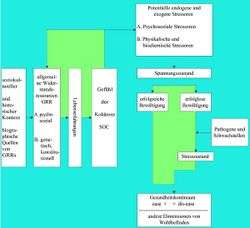
Das Modell von Antonovsky steht in der Tradition der Stress- und Bewältigungsforschung. Die Gefährdung der Gesundheit geht nach diesem Ansatz vom schädigenden Einfluss von Stressoren verschiedenster Art aus. Insofern spielen Stressoren nach Faltermaier (1994) „in diesem Modell eine zentrale Rolle, da sie sich bei einer Vielzahl von Krankheiten als Risikofaktoren erwiesen haben“ (S. 12). Im Gegensatz zu anderen Stressforschern geht Antonovsky davon aus, dass Stressoren allgegenwärtig sind und deren Wirkung nicht zwangsläufig gesundheitsschädigend sein muss. Er schlägt vor, zwischen Spannung und Stress zu unterscheiden. Die erste Reaktion ist seiner Meinung nach physiologische Spannung (psychophysische Aktivierung) und darauf zurückzuführen, dass Personen nicht wissen, wie sie in einer Situation reagieren sollen. Antonovsky definiert Stressoren als „eine von innen oder außen kommende Anforderung an den Organismus, die sein Gleichgewicht stört und die zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes eine nicht-automatische und nicht unmittelbar verfügbare, energieverbrauchende Handlung erfordert“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 32f.).
Antonovsky unterscheidet physikalische (z.B. Kälte, Lärm, Wetterkatastrophen), biochemische (z.B. Bakterien, Viren, Parasiten, Gifte und Schadstoffe) und psychosoziale (z.B. kritischen Lebensereignisse und -erfahrungen) Stressoren. Ob daraus Stress und im weiteren Verlauf gesundheitsschädigende Prozesse entstehen, ist von den Bewertungs- und Bewältigungsreaktionen des Individuums abhängig (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 85; s.3.3.1). Werden Stressoren und Spannungen erfolgreich bewältigt, bewegt sich eine Person auf dem Gesundheitskontinuum eher in die positive Richtung. Gelingt das nicht, dann reagiert der Organismus mit einem Stresszustand, der in Interaktion mit anderen Pathogenen und möglichen Schwachstellen des Organismus eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung des Gesundheitskontinuums bewirkt (vgl. Faltermaier 1994, S. 50).
Generell gilt, dass der menschliche Organismus als System permanent (natürlichen) Einflüssen und Prozessen ausgesetzt ist, die eine Störung seiner Ordnung (d.h. seiner Gesundheit) bewirken. Gesundheit ist demnach kein stabiler Gleichgewichtszustand, sondern muss in der Auseinandersetzung mit krankmachenden Einflüssen kontinuierlich neu aufgebaut werden. Gesundheit und Krankheit sind keine einander ausschließende Zustände, sondern die Extrempole auf einem Kontinuum. Dazwischen liegen Zustände von relativer Gesundheit und relativer Krankheit.
Die Art und der Erfolg von Bewältigungsversuchen wird wesentlich dadurch bestimmt, auf welche Ressourcen eine Person zurückgreifen kann. Demnach muss „die Suche nach spezifischen Krankheitsursachen (pathogenetischer Ansatz) [...] nach Antonovsky durch die Suche nach gesundheitsfördernden bzw. gesunderhaltenden Faktoren (salutogenetischer Ansatz) ergänzt werden“ (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 85). Diese Faktoren bezeichnet er als „generalized resistance resources“ (GRR), also generalisierte Widerstandsressourcen, und versteht darunter „jedes Merkmal einer Person, Gruppe oder Umwelt, das eine wirksame Spannungsbewältigung erleichtern kann“ (zitiert nach Faltermaier 1994, S. 51). Antonovsky diskutiert diejenigen Widerstandsressourcen, die auf eine gewisse empirische Unterstützung verweisen und auf verschiedenen Ebenen wirksam sein können:
- eine präventive Gesundheitsorientierung als unmittelbar für die Gesunderhaltung relevante GRR, die sich z.B. in der Vermeidung von Stressoren oder im Aufsuchen von Vorsorgeuntersuchungen ausdrückt;
- physikalische und biochemische GRRs wie z.B. eine besondere Reagibilität des Immunsystems;
- materielle GGRs wie Geld oder die Verfügbarkeit über Güter oder Dienstleistungen;
- kognitive und emotionale GGRs wie z.B. Wissen, Intelligenz oder Ich- Identität;
- effektive Bewältigungsstile als GRRs, die sich durch Rationalität, Flexibilität und Voraussicht charakterisieren lassen;
- interpersonale GRRs wie zum Beispiel die Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung oder die Eingebundenheit in und Bindung an soziale Netzwerke;
- makrosoziokulturelle GRRs wie beispielsweise die Verbundenheit mit stabilen Kulturen, rituell-magischen Aktivitäten oder religiösen Glaubensystemen (vgl. Faltermaier 1994, S. 51).
Durch die Frage nach Widerstandsressourcen steht der ganze Mensch mit seiner Biographie im Mittelpunkt und nicht nur seine Erkrankung bzw. seine Symptome. Der Wandel bezüglich der Gesundheitsvorstellung führt notwendigerweise zu einer Verschiebung des Fokus von der Risiko-Orientierung hin zur Ressourcen-Orientierung. Gesundheitswissenschaftliche Konzepte gehen davon aus, dass Ressourcen bei der Bewältigung (Coping) von Belastungen helfen und somit verhindern, dass der Organismus in einen längeren Stresszustand verfällt. Hinsichtlich der Gesundheitsbildung kann die Aktivierung von Ressourcen ein Schlüssel zum Erfolg einer Gesundheitsförderung sein. Eine Zusammenfassung der bisherigen Klassifizierungen von Ressourcen bietet die nachfolgende Tabelle, die von Oda (2001) im Rahmen einer Studie über „Spontanremissionen bei Krebserkrankungen aus der Sicht des Erlebenden“ zusammengestellt hat. Da die Erklärung der in dieser Tabelle klassifizierten Ressourcen den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, verweise ich zur weiterführenden Lektüre z.B. auf Oda (2001). Ich beschränke mich an dieser Stelle auf den Hinweis, dass Entspannung unter interne verhaltensbezogene Ressourcen fällt.
Im Widerspruch zu Oda (2001) handelt es sich nach Faltermaier (1994) bei dem Gefühl der Kohärenz (sense of coherence, SOC) um ein „alle Widerstandsressourcen integrierendes Konzept“ (S. 53). Dabei stellt es eine individuelle, psychologische (sowohl kognitive als auch affektiv-motivationale) Einflussgröße dar: eine allgemeine Grundhaltung gegenüber der Welt und dem eigenen Leben. Diese hängt davon ab, wie gut jemand in der Lage ist, vorhandene Ressourcen zum Erhalt seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens zu nutzen (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 28). Der Ausgang von Bewertungs- und Bewältigungsreaktionen und damit der Gesundheits- bzw. Krankheitszustand einer Person wird wesentlich durch dieses Konstrukt bestimmt. Das Kohärenzgefühl ist somit die zentrale Kraft zur erfolgreichen Stressbewältigung. Antonovsky (1997) definiert es als: „eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, daß die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen“ (S. 36). Diese Grundhaltung, die Welt als zusammenhängend und sinnvoll zu erleben, setzt sich nach Antonovsky somit aus den folgenden drei Komponenten zusammen:
- Dem Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility)
Hierbei handelt es sich um die Erwartung bzw. Fähigkeit von Menschen, Stimuli (auch unbekannte) als geordnete, konsistente, strukturierte Informationen verarbeiten zu können. Also nicht mit Reizen und Situationen konfrontiert zu sein bzw. zu werden, die chaotisch, willkürlich, zufällig und unerklärlich sind. Verstehbarkeit ist nach Antonovsky ein kognitives Verarbeitungsmuster (vgl. Antonovsky 1997, S. 34f.).
- Dem Gefühl von Handhabbarkeit (sense of manageability)
Hierbei handelt es sich um die Überzeugung eines Menschen, dass Schwierigkeiten lösbar sind. Antonovsky (1997) nennt dies auch instrumentelles Vertrauen und definiert es als das „Ausmaß, in dem man wahrnimmt, daß man geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen“ (S. 35). In diesem Zusammenhang betont er, dass es nicht allein darum geht, über eigene Ressourcen und Kompetenzen verfügen zu können, sondern auch darum zu glauben, dass andere Personen oder eine höhere Macht dabei helfen, Schwierigkeiten zu überwinden. Handhabbarkeit ist nach Antonovsky ein kognitiv-emotionales Verarbeitungsmuster (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 29).
- Dem Gefühl von Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness)
Hierbei handelt es sich nach Antonovsky (1997) um das „Ausmaß, in dem man das Leben als emotional sinnvoll empfindet: daß wenigstens einige der vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, daß man Energie in sie investiert, daß man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, daß sie eher willkommene Herausforderungen sind, als Lasten, die man gerne los wäre“ (S. 35). Diese Komponente ist nach Antonovsky die wichtigste, denn ohne die Erfahrung der Sinnhaftigkeit und ohne positive Erwartungen an das Leben ergibt sich trotz einer hohen Ausprägung der anderen beiden Komponenten kein hoher Wert des Kohärenzgefühls. Das Leben wird in allen Bereichen nur als Last empfunden und jede weitere sich zusätzlich stellende Aufgabe als Qual. Sinnhaftigkeit ist nach Antonovsky ein affektiv-motivationales Verarbeitungsmuster (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 29f.).
Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl führt dazu, durch Aktivierung angemessener Ressourcen, flexibel auf spezifische Situationen reagieren zu können. Ein gering ausgeprägtes Kohärenzgefühl hingegen führt zu einer eher starren und rigiden Antwort auf Anforderungen, da weniger Ressourcen zur Bewältigung vorhanden sind bzw. wahrgenommen werden (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 30). Das Kohärenzgefühl wirkt dabei als flexibles Steuerungsprinzip, das den Einsatz verschiedener Verarbeitungsmuster (Copingstile, Copingstrategien) in Abhängigkeit von den Anforderungen aktiviert. Das Kohärenzgefühl entwickelt sich im Laufe der Kindheit und Jugend, beeinflusst von gesammelten Erlebnissen und Eindrücken. Mit etwa dreißig Jahren ist es nach Antonovsky ausgeprägt und bleibt relativ stabil. Er bezeichnet es daher auch als dispositionale Orientierung. Ob sich ein stark oder gering ausgeprägtes Kohärenzgefühl herausbildet, hängt für Antonovsky von gesellschaftlichen Gegebenheiten und der familiären Sozialisation ab, nämlich von der Verfügbarkeit der erwähnten generalisierten Widerstandsressourcen (GRR). Eine grundlegende Veränderung im Erwachsenenalter hält er nur für begrenzt möglich (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 86). Höchstens durch radikale Veränderungen der sozialen, kulturellen und strukturellen Einflüsse, welche die bisherigen Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten massiv verändern oder viele unerwartete Erfahrungen mit sich bringen, könne das Kohärenzgefühl verändert werden (Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 31). Auf welche Weise kann jetzt ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl die Gesundheit fördern? Antonovsky geht von folgenden drei Einflussmechanismen über die Wahrnehmung von Stressoren aus. Diese hat er in Anlehnung an das transaktionale Modell von Lazarus (s.3.3.1) konzipiert und umfassen folgende Stufen:
- primary appraisal I
Menschen mit einem hohen SOC tendieren dazu, fordernde Situationen nicht als Belastung einzuschätzen, und erfahren daher keinen Spannungszustand.
- primary appraisal II
Auf dieser zweiten Stufe wird eingeschätzt, ob der Stressor das eigenen Wohlbefinden beeinflusst. Auch hier besteht die Annahme, dass Menschen mit hohem SOC die Stresssituation eher als günstig oder irrelevant wahrnehmen, als Menschen mit niedrigem SOC und somit ihre Spannung schneller abbauen können.
- primary appraisal III
Antonovsky nimmt an, dass auf einer dritten Stufe Personen mit hohem SOC im Gegensatz zu Personen mit niedrigem Kohärenzgefühl erstens Probleme klarer und differenzierter wahrnehmen und zweitens, dass ausgelöste Emotionen stärker fokussiert und weniger diffus (und damit lähmend) sind (vgl. Faltermaier 1994, S. 53).
Die ausgelöste Spannung wird gelöst, indem das Individuum seine Widerstandsressourcen zur Problembewältigung mobilisiert. Dabei ist eine Person mit hohem SOC eher in der Lage aus ihren generalisierten und spezifischen Widerstandressourcen die geeignete Kombination zu mobilisieren und die für die Situation angemessene Copingstrategie zu wählen. Demzufolge trägt ein hohes Kohärenzgefühl dazu bei, die durch Stressoren ausgelösten Spannungszustände des Organismus erfolgreich zu lösen und die zugrundeliegenden Probleme zu bewältigen. Indem ein Stresszustand erfolgreich gelöst werden kann, wird eine Bewegung zum gesunden Pol des Gesundheitskontinuums gefördert (vgl. Faltermaier 1994, S. 53f.).
Zur empirischen Überprüfung seiner Theorie hat Antonovsky einen Fragebogen entwickelt, den Orientation to Life Questionary (bzw. die SOC-Skala) (vgl. Antonovsky 1997, S. 79ff.). Die empirische Fundierung des Salutogenese-Modells besteht aus Querschnittuntersuchungen, die den Zusammenhang von Kohärenzgefühl mit verschiedenen Parametern psychischer und physischer Gesundheit und Persönlichkeitseigenschaften messen. Dabei erlauben die Korrelationen keine Aussagen über Ursachenzusammenhänge. Wenn sich also bedeutsame Korrelationen zwischen einem hohen SOC und einer Gesundheitsvariable finden, ist noch nicht nachgewiesen, dass das Kohärenzgefühl ein ursächlicher Faktor für Gesundheit ist (vgl. Bengel; Strittmatter; Willmann 20027, S. 40ff.). Viele empirische Studien bestätigen seit der Entwicklung dieses Modells vor über 20 Jahren die Aussagen Antonovskys in Bezug auf die Stresswahrnehmung und Stressbewältigung. Das Kohärenzgefühl hat demnach Einfluss auf die Bewertung von Stressoren und deren Bewältigung und kann eine Anpassung an schwierige Lebenssituationen erleichtern. Menschen mit hohem SOC nehmen Ereignisse und Anforderungen eher als Herausforderungen und weniger als Belastung wahr. Wenn sie dennoch Stress erleben, können sie ihn schneller wieder abbauen (vgl. ebd., S. 46ff.).
Entgegen der Annahme Antonovskys, dass das Kohärenzgefühl im Erwachsenenalter eine stabile Eigenschaft ist, finden sich aufgrund von entsprechenden Studien Hinweise, dass mit zunehmendem Alter auch die Stärke des Kohärenzgefühls zunimmt. Um fundierte Aussagen über die Veränderbarkeit dieses Konstrukts zu machen, fehlen jedoch Längsschnittstudien (vgl. ebd., S. 51).
Stress
Die beiden Begriffe Spannung und Entspannung bilden Gegenpole eines natürlich angelegten Reaktionsmusters. Heute wird für den Begriff Spannung, vor allem wenn es sich um krankmachende Dauerspannung handelt, in der Psychologie und der Medizin wie auch im Alltagsgebrauch der weiterführende Begriff Stress verwendet. Die Begriffe Entspannung und Stress sind ähnlich eng miteinander verknüpft, wie die Begriffe Gesundheit und Krankheit. Stress und seinen Folgen entgegenzuwirken, ist deshalb der wohl am häufigsten auftretende Motivationsgrund ein Entspannungsverfahren zu erlernen. Dieses Kapitel behandelt verschiedene Aspekte des Stressgeschehens. Dabei lassen sich Überschneidungen zu dem vorangegangen Kapitel über Gesundheit und Krankheit aufgrund der thematischen Nähe nicht vermeiden. Was die Vorgehensweise betrifft, kläre ich zunächst den Stressbegriff, um im folgenden darauf einzugehen, wie Stress zustande kommt und wie er sich abhängig von der kognitiven Bewertung sowohl auf den Körper als auch auf die Psyche auswirkt. Schließlich zeige ich aktuelle Tendenzen der Stressthematik auf.
Auseinandersetzung mit dem Stressbegriff
Ursprünglich kommt der längst zum Schlagwort gewordene Begriff Stress aus dem Englischen. Er wird in einem physikalischen Zusammenhang verwendet und zwar speziell in der Materialprüfung. Unter Stress wird in diesem Sinne die Anspannung, Verzerrung und Verbiegung von Metallen oder Glas verstanden (vgl. Vester 1976, S. 14). Der Begriff Stress wird 1950 von dem ungarisch-kanadischen Mediziner Hans Selye (1907-1982) in die Medizin und die Psychologie eingeführt. Selye beschreibt damit etwas Ähnliches: die Belastungen, Anstrengungen und Ärgernisse, denen eine Person täglich durch viele Umwelteinflüsse (wie z.B. Lärm, Hetze, Frustrationen, Schmerz, Existenzangst) ausgesetzt ist. Also Anspannungen, Verzerrungen und Anpassungszwänge, die eine Person aus dem persönlichen Gleichgewicht (der Homöostase) bringen und sie folglich seelisch und körperlich unter Druck setzen (vgl. Vester S. 14). Stress ist demnach eine Anpassungsreaktion auf alles was die Balance lebenswichtiger Funktionen wie zum Beispiel Temperatur oder Blutdruck stört (vgl. Possemeyer 2002, S. 148).
Eine umfassende Definition von Stress liefert Zimbardo (19956): „Stress ist ein Muster spezifischer und unspezifischer Reaktionen eines Organismus auf Reizereignisse, die sein Gleichgewicht stören und seine Fähigkeiten zur Bewältigung strapazieren oder überschreiten. Diese Reizereignisse umfassen eine ganze Bandbreite externer und interner Bedingungen, die allesamt als Stressoren bezeichnet werden. Ein Stressor ist ein Reizereignis, das vom Organismus eine adaptive Reaktion verlangt. Die Stressreaktion ist zusammengesetzt aus einer vielfältigen Kombination von Reaktionen auf unterschiedlichen Ebenen, einschließlich physiologischer, verhaltensbezogener, emotionaler und kognitiver Veränderungen“ (S. 575; Hervorhebungen: E. K.). Stress ist demnach ein Reaktionsmuster, mit dem eine Person auf physiologischer und psychischer Ebene auf Stressoren antwortet, also auf Reizereignisse, die sein Bewältigungspotential auf die Probe stellen.
Ursachen von Stress
Stress ist ein Phänomen, dass zum Leben gehört. Dass im Laufe des Lebens Veränderungen auftreten, ist ganz natürlich und unvermeidlich. Die Aussage „Das einzig Beständige im Leben ist der Wandel“ (Macha; Mauermann 1997, S. 7) ist kennzeichnend für vielfältige Veränderungen in der Biographie einer Person, in ihrem alltäglichen Leben, in ihrem gesellschaftlichen Kontext und in ihrer Umwelt. Veränderungen versetzen eine Person zunächst in einen Spannungszustand, der Anpassungsleistungen erforderlich macht. In diesem Sinne können sie auch als Stressoren bezeichnet werden. Eine Möglichkeit Stressoren zu definieren und zu kategorisieren, habe ich bereits im Zusammenhang mit dem Modell der Salutogenese von Antonovsky erwähnt (s.2.4.4).
Antonovsky unterscheidet weiterhin (in Übereinstimmung mit der psychologischen Forschungsliteratur) zwischen drei Arten von Stressoren: „größere Lebensereignisse“, „daily hassles (alltägliche Ärgernisse)“ sowie „chronische Stressoren“ (Faltermaier 1994, S. 48). In diesem Zusammenhang nennt Zimbardo (19956) eine vierte Dimension der Ursachen von Stress, nämlich „unvorhersehbare katastrophale Ereignisse“ (S. 586). Bedeutende Lebensveränderungen, selbst erfreuliche, können ebenso als stressbeladen erlebt werden wie die Ansammlung von alltäglichen Ärgernissen. Chronische Stressoren und Katastrophen können schweren Stress verursachen. Auf diese vier Ursachen von Stress, gehe ich im folgenden näher ein.
Kritische Lebensereignisse
Die heutige Stressforschung beschäftigt sich vor allem mit dem Wandel im Lebenslauf einer Person und fokussiert dabei insbesondere sogenannte „kritische Lebensereignisse“ (Schaufler 2000, S. 118). Kritische Lebensereignisse können beispielsweise Übergänge (Transitionen) in der Biographie einer Person sein, wie beispielsweise der zur Elternschaft. Grundsätzlich können kritische Lebensereignisse sowohl positive (etwa wenn sich zwei Personen ineinander verlieben) als auch negative (etwa von einer geliebten Person verlassen zu werden) Erfahrungen darstellen. Beiden ist jedoch gemein, dass sie einen Einschnitt im Leben einer Person bedeuten, der eine fortlaufende Anpassung an die sich wandelnde Situation erfordert. Fthenakis et al. (1999) untersuchte in einer Längsschnittstudie den Übergang zur Elternschaft, besonders den Übergang zur Vaterschaft und die damit verbundenen Veränderungen (vgl. ebd., S. 70ff.). Ein Ergebnis ist, dass mit der Geburt eines Kindes eine „Umverteilung der beruflichen und familiären Aufgaben“ (ebd., S. 74) stattfindet, und zwar im Sinne einer traditionellen Rollenverteilung. Die Väter erhöhen ihre Wochenarbeitszeit (von 33,4 auf 39,9 Stunden), wohingegen die Mütter ihre eigene Berufstätigkeit unterbrechen oder ganz aufgeben (vgl. ebd.). Dabei sind vor allem Frauen mit ihrer Rolle unzufrieden Der Stresspegel steigt für beide Elternteile: das Ausmaß von „Streit und Konflikten zwischen den Partnern“ nimmt zu, bei gleichzeitiger Abnahme des Ausmaßes von „Zärtlichkeit und Sexualität“ sowie „von Kommunikation und Austausch“ (ebd., S. 77f.).
Nach Zimbardo (19956) bilden „Veränderungen der allgemeinen Lebenssituation [...] für viele von uns den Kern streßerzeugender Lebensereignisse“ (S. 584). Sie können einer Person wirksames Handeln erschweren oder zu körperlichen Krankheiten führen. Der Einfluss bedeutender Lebensveränderungen auf die körperliche und seelische Gesundheit ist Thema zahlreicher Forschungsprojekte gewesen. Beispielsweise belegen viele Untersuchungen, dass das Ausmaß von Lebensveränderungen, wie es mit der Social Readjustment Rating Scale (SRRS) gemessen wird, vor dem Beginn einer Krankheit signifikant zunimmt. Stress durch Lebensveränderungen wird mit plötzlichem Tod durch Herzinfarkt, Tuberkulose, multipler Sklerose, Diabetes, Komplikationen im Verlauf von Schwangerschaften und bei Geburten, chronischen Krankheiten und vielen „kleineren“ gesundheitlichen Problemen (z.B. Schlaflosigkeit) in Zusammenhang gebracht. Es besteht die Annahme, dass Stress durch Lebensveränderungen die allgemeine Krankheitsanfälligkeit eines Menschen erhöht, wobei Krankheit selbst ein wesentlicher Stressor ist.
Eine Verbesserung der Messung der Auswirkungen von Lebensereignissen bietet der Life Experiences Survey (LES), der zwei typische Eigenschaften hat. Erstens liefert er Werte sowohl für die Zunahme, als auch für die Abnahme von Veränderungen, während die SRRS nur die Zunahme registriert. Zweitens geben seine Werte individuelle Einschätzungen der Ereignisse und ihrer Erwünschtheit wieder. Der Tod eines ungeliebten Ehegatten, der eine große Erbschaft hinterlässt, kann beispielsweise als durchaus erwünscht eingeschätzt werden (vgl. Zimbardo 19956, S. 584f.). Die Skala geht also über die bloße Zählung der Lebensereignisse, an die sich eine Person erinnert, hinaus, indem sie die persönliche Bedeutung jeder Veränderung erfasst. Ein Problem bei der Untersuchung von Zusammenhängen zwischen stressreichen Lebensereignissen und darauf folgender Erkrankung besteht darin, dass sie meistens retrospektiv angelegt sind. Retrospektiv bedeutet, dass sowohl die Maße für Stress, als auch die Maße für Krankheit erhoben werden, indem man die Versuchspersonen an vergangene Ereignisse erinnern lässt. Das eröffnet die Möglichkeit für Verzerrungen im Gedächtnis, die sich auf das Resultat der Erinnerung verfälschend auswirken. Versuchspersonen, die sich nicht wohl fühlen, können sich beispielsweise mit größerer Wahrscheinlichkeit an Stressoren ihrer Vergangenheit erinnern, als Versuchspersonen, denen es gut geht. Prospektive Untersuchungen kommen jedoch zu ähnlichen Ergebnissen wie retrospektive Untersuchungen: negative Werte in Bezug auf Lebensveränderungen korrelieren signifikant mit den körperlichen Symptomen, die ein halbes Jahr später angegeben werden (vgl. Zimbardo 19956, S. 58).
Alltägliche Ärgernisse
Der Alltag kann mitunter voll verschiedener Frustrationen sein: eine Person ist mit dem Auto unterwegs zu einer wichtigen Verabredung, gerät ausgerechnet dann in einen Verkehrsstau, tritt als sie ankommt und aussteigt in eine Regenpfütze, hetzt mit nassen Schuhen und Socken zu dem Zielgebäude, muss ins achte Stockwerk, der Fahrstuhl ist außer Betrieb, sie nimmt die Treppe und, als sie oben ankommt, steht sie vor „verschlossenen Türen“.
Addieren sich diese alltäglichen Ärgernisse, können sie zu Stressoren werden und die Gesundheit einer Person angreifen. Diesen Zusammenhang zeigt die folgende Untersuchung in der „eine Gruppe weißer Mittelschichtangehöriger mittleren Alters und beiderlei Geschlechts ein Jahr lang Tagebuch über alltägliche Ärgernisse [führte]. Gleichzeitig wurden bedeutende Lebensveränderungen und körperliche Symptome festgehalten. Es zeigte sich eine deutliche Beziehung zwischen den kleinen Störungen und gesundheitlichen Problemen: Je häufiger und je intensiver diese Störungen laut Bericht waren, um so schlechter war es sowohl um die physische als auch um die psychische Gesundheit des Tagebuchführers bestellt“ (Zimbardo 19956, S. 586; Anpassung: E. K.).
Chronische Stressoren
Unmittelbar anstehende Probleme der Arbeit und der ökonomischen Sicherheit stellen eine bedeutende Stressursache für Erwachsene dar. Viele Probleme, die mit Stress zusammenhängen, nehmen in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs zu. Zum Beispiel steigen Aufnahmen in psychiatrische Anstalten, Säuglingssterblichkeit, Selbstmorde und Todesfälle aufgrund alkoholbedingter Erkrankungen sowie Herz-Kreislauferkrankungen (vgl. Zimbardo 19956, S. 587).
Die Globalisierung der Wirtschaft ist kein neues Phänomen. Intensität und Reichweite weltweiter Interaktionen zwischen Unternehmen, Kulturen und politischen Systemen haben allerdings seit Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts und insbesondere seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes deutlich zugenommen. Durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien werden geographische Distanzen und Landesgrenzen immer bedeutungsloser und erlauben intensive Kommunikation quer über den Globus ohne Standortwechsel der Beteiligten. Globalisierung eröffnet neue Chancen wirtschaftlichen Wachstums. Die Beschäftigten werden dadurch jedoch mit neuen Arbeits- und Organisationsformen konfrontiert, mit zunehmenden Beschäftigungsrisiken und einer Intensivierung der Arbeit. Das Tempo des sozioökonomischen Wandels hat deutlich zugenommen, Sicherheit und Berechenbarkeit der Markt- und Arbeitsverhältnisse haben dagegen spürbar abgenommen. Diese Tatsache stellt einen weiteren, aktuell sehr bedeutenden chronischen Stressor dar (vgl. Graham; Takala; Machida 2003, S. 12).
Des Weiteren erzeugt die „Zerstörung des ökologischen Lebensraums“ (Hurrelmann 1990, S. 155) sowohl psychischen Stress als auch physische Bedrohung. Die chemischen Errungenschaften der modernen Technologie sind auch Ursache der Verseuchung ganzer Landstriche, deren Bewohner evakuiert werden müssen. Der Störfall im Atomkraftwerk von Three Mile Island im Jahre 1979 und das darauffolgende Ausströmen radioaktiver Dämpfe sowie die Katastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986 sind Beispiele für umweltbedingte Stressoren. „Diejenigen, die in der Umgebung lebten, erlebten beträchtlichen Stress, denn sie fürchteten die unmittelbaren und die langfristigen Folgen für ihre Gesundheit“ (Zimbardo 19956, S. 587). Schließlich gilt der heutige Straßenverkehr mit seinem hohen Lärmpegel, seiner hohen Dichte an optischen Eindrücken und seinen vielen angstauslösenden Situationen als „Streßverursacher erster Ordnung“ (Knörzer 1994, S. 234).
Katastrophale Ereignisse
Die Erforschung der körperlichen und seelischen Auswirkungen katastrophaler Ereignisse, traumatischer Erlebnisse, ist äußerst aufschlussreich: in den Reaktionen von Personen auf Katastrophen treten in vorhersehbarer Weise fünf Phasen auf (vgl. Zimbardo 19956, S. 586). • Typischerweise gibt es erst eine Phase des Schocks und sogar der „psychischen Abstumpfung“ (Zimbardo 19956, S. 586), während der die Personen das, was geschehen ist, nicht in vollem Umfang begreifen können. • Die nächste Phase beinhaltet das, was als „automatisches Handeln“ (ebd.) bezeichnet wird. Es wird versucht auf die Katastrophe zu reagieren und es gelingt sich anpassungsorientiert zu verhalten. Die betroffenen Personen sind sich jedoch dessen, was sie tun, nicht richtig bewusst und können sich später an die Erfahrungen dieser Phase nur schlecht erinnern. • Während der nächsten Phase spüren sie, dass sie etwas erreicht haben. Sie haben sogar ein positives Gefühl der Anstrengung für ein Ziel. In dieser Phase fühlen sie sich müde und merken, dass sie ihre Energiereserven aufbrauchen. • Während der vierten Phase erfahren sie „ein Nachlassen“: ihre Energien sind erschöpft, „der Eindruck der Tragödie schlägt schließlich durch“ und wird emotional empfunden (ebd.). • Darauf folgt eine ausgedehnte Phase der Erholung, in der die Personen sich wieder ausruhen und mit den aus der Katastrophe resultierenden Veränderungen umgehen. Die Kenntnis dieser typischen Reaktionsphasen liefert ein Modell, zur Vorhersage der Reaktionen von Personen auf Katastrophen. Dadurch wird es Helfern leichter gemacht, die Probleme, die auftauchen werden, zu antizipieren und entsprechende Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Reaktionen auf so unterschiedliche Ereignisse wie Überschwemmungen, Tornados, Flugzeugabstürze und Explosionen von Fabriken folgen diesem Modell (vgl. Zimbardo 19956, S. 586).
Auswirkungen von Stress
Die Bedeutung der kognitiven Bewertung
Die Reaktion auf einen Stressor ist von Person zu Person (interindividuell) verschieden. „Einige Menschen erleben ein stressreiches Ereignis nach dem anderen, ohne zusammenzubrechen, wohingegen sich andere sogar bei wenig Stress aufregen, da sich die meisten Stressoren nicht direkt auswirken“ (Zimbardo 19956, S. 576). Ihr Effekt ist abhängig von der kognitive Bewertung eines Stressors (ob er als Bedrohung oder als Herausforderung gesehen wird). Die kognitive Bewertung wird auch als „Moderatorvariable“ (ebd.) bezeichnet, da sie die Wirkung eines wahrgenommenen Stressors moderiert. Weitere Moderatorvariablen sind innere und äußere Ressourcen zum Umgang mit einem Stressor, Einstellungen und Bewältigungsmuster (vgl. ebd.). Das Gefühl der Kohärenz, welches ebenfalls entscheidend dazu beiträgt, wie ein Stressor wahrgenommen und bewertet wird, habe ich bereits im Rahmen des Modells der Salutogenese (s.2.4.4) dargestellt.
Bevor eine Stressreaktion einsetzt muss der Stressor zunächst sinnlich wahrgenommen und dann bewertet worden sein. Die kognitive Bewertung (cognitive appraisal) spielt eine zentrale Rolle bei der Situationsdefinition: was für eine Anforderung es ist, wie groß die Bedrohung ist, welche Ressourcen für Gegenmaßnahmen zur Verfügung stehen und welche Strategien angemessen sind. Einige Stressoren, beispielsweise ein Autounfall, eine schwere körperliche Krankheit oder der Tod einer geliebten Person, werden von fast allen Menschen als Bedrohung betrachtet. Viele andere Stressoren können jedoch auf unterschiedliche Weisen gesehen werden, abhängig von der allgemeinen Lebenssituation, der Beziehung dieser bestimmten Anforderung zu wichtigen Zielen, der Kompetenz zu ihrer Bewältigung und der Bewertung dieser Kompetenz. Die Bewertung eines Stressors und der Ressourcen zu seiner Bewältigung können für die bewusste Erfahrung, für die Auswahl geeigneter Bewältigungsstrategien und für den erfolgreichen Umgang mit Stress genauso wichtig sein wie der Stressor. Wird ein Stressor so interpretiert, dass er das Handlungspotential überfordert, so wird eine sich selbst erfüllende Prophezeiung geschaffen (vgl. Zimbardo 19956, S. 577). Wahrscheinlich wird eine Person scheitern, selbst wenn sie objektiv in der Lage wäre, mit der Herausforderung angemessen umzugehen (s.4.2).
Mittels der kognitiven Bewertung kann ein Stressor als interessante und neue Herausforderung definiert werden, die eine Person dann gerne annimmt, anstatt ihn als Bedrohung zu erleben. Eine Stresserfahrung kann daher durchaus anregend sein, eine Art „Aufputschen“ und Erwartungen von Erfolg sowie gesteigertes Selbstbewusstsein nach sich ziehen. Solch eine positive Reaktion auf Stressoren wird als Eustress im Gegensatz zu Distress bezeichnet. Eustress ist demnach „zur Gesunderhaltung des Gesamtorganismus notwendig und gut“, wohingegen Distress „unser Leib-Seele-Gleichgewicht auf Dauer stören und zu psychosomatischen Krankheiten führen kann“ (Schenk 1993, S. 11).
Ob ein Stressor als Herausforderung oder Belastung gesehen wird, liegt demnach im Erleben des Subjektes, es gibt keinen objektiven Maßstab dafür, was als positiver oder negativer Stress erlebt wird (vgl. Schaufler 2000, S. 117). Eine Person reagiert also nicht direkt auf einen Stressor, sondern auf das, was ihre Wahrnehmung und ihre Interpretation ihr zeigen.
Richard Lazarus, ein Pionier der Stressforschung, hat 1966 zwei Stufen der kognitiven Bewertung von Anforderungen unterschieden (vgl. Zimbardo 19956, S. 577). • Die primäre Bewertung (primary appraisal) bezieht sich auf die Bewertung der Merkmale einer Situation, das heißt belastende Ereignisse können als Bedrohung, Herausforderung oder als irrelevant für das eigene Wohlbefinden eingeschätzt werden; • Die sekundäre Bewertung (secondary appraisal) bezieht sich auf die Einschätzung der persönlichen und sozialen Ressourcen, das heißt der eigenen Möglichkeiten, eine belastende Situation allein oder mit Unterstützung anderer zu bewältigen (vgl. ebd.).
Während die Maßnahmen zur Stressbewältigung ausprobiert werden, wird die Bewertung fortgesetzt. Falls die erste Maßnahme unwirksam bleibt und der Stress andauert, werden neue Reaktionen in Gang gesetzt. Es kommt zu chronischem Stress, einem „Erregungszustand, der andauert, während die Anforderungen von der Person als größer als die verfügbaren inneren und äußeren Ressourcen zur Bewältigung wahrgenommen werden“ (Zimbardo 19956, S. 577). Die kognitive Bewertung definiert also die Anforderung. Die primäre Bewertung stellt fest, ob eine Anforderung stressreich ist, die sekundäre bewertet die verfügbaren persönlichen und sozialen Ressourcen und die Angemessenheit von Handlungsmaßnahmen. Bei chronischem Stress werden die Anforderungen im Laufe der Zeit größer als die Ressourcen.
Das transaktionale Stressmodell von Lazarus ist wohl die einflussreichste Stressbewältigungstheorie. Beispielsweise wurde es von Antonovsky aufgegriffen und im Rahmen seiner Theorie der Gesundheit erweitert (s.2.4.4). Es ermöglicht einen Perspektivenwechsel von der objektiven Belastungsseite zu subjektiven Bewältigungsprozessen, also zu den mit der Bewältigung von Stress (Coping) verbundenen Anpassungsleistungen einer Person. Stress ist demnach keine unveränderliche Einflussgröße, sondern verändert sich durch individuelle Informationsverarbeitung und durch situationsbezogene Variablen. In diesem Zusammenhang bin ich der Meinung, dass die Bewertung eines Stressors nicht nur interindividuell verschieden ist, sondern sich auch intraindividuell verändern kann. Das Leben einer Person befindet sich in einem ständigen Wandel, so dass ein und der selbe Stressor unterschiedlich bewertet werden kann: abhängig zum Beispiel von der jeweiligen Tagesform oder vom jeweiligen Entwicklungsstand einer Person. Aus existenzphilosophischer Sicht ist selbst die Entwicklung eines Menschen nicht „stetig“ (Bollnow 1965, S. 18). Sie ist kein linearer Prozess, was bedeutet, dass eine Person in ihrem Lebenslauf kreisförmig verschiedene Entwicklungsstufen immer wieder durchläuft. Eine Person kann insofern „mal mehr und mal weniger verkraften“, so dass der gleiche Stressor von der gleichen Person zu verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben (unabhängig von ihrem Lebensalter), unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden kann.
Physische Stressreaktionen
Das Gehirn hat sich ursprünglich als Zentrum zur effektiveren Koordination von Handlungen entwickelt. Effizienz bedeutet in diesem Zusammenhang Flexibilität der Reaktionen auf sich verändernde Umweltanforderungen und auch eine schnellere, oft automatische Reaktion. Eine vom Gehirn kontrollierte physiologische Stressreaktion tritt dann auf, wenn ein Organismus eine äußere Bedrohung wahrnimmt (beispielsweise einen Angreifer). Sofortiges Handeln und besondere Stärke sind erforderlich, damit der Organismus überlebt. Eine ganze Konstellation automatischer Mechanismen hat sich in der Phylogenese (Stammesgeschichte der Lebewesen) entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Da ich der Meinung bin, dass es sowohl für die theoretische als auch für die praktische Beschäftigung auf diesem Gebiet von Bedeutung ist biologische und medizinische Aspekte zu beachten, um z.B. den Zusammenhang zwischen Stress und Krankheit herzustellen gehe ich im Folgenden auf die Stressphysiologie ein.
Die Alarmreaktion In den 1920ern entwirft der Physiologe Walter Cannon (1871-1945), die erste wissenschaftliche Beschreibung der Reaktion von Tieren und Menschen auf äußere Gefahren. Er findet heraus, dass in den Nerven und Drüsen eine Abfolge von Aktivitäten ausgelöst wird, die den Körper auf Gegenwehr und Kampf oder auf Flucht in die Sicherheit vorbereitet. Cannon nennt diese grundlegende zweifache Stressreaktion „fight-or-flight syndrome“ (Zimbardo 19956, S. 578).
In diesem Zusammenhang wird Stress von Selye definiert als „ein unspezifisches, stereotypes, phylogenetisch altes Antwortmuster, das primär den Organismus für physische Aktivität wie Kampf oder Flucht vorbereitet“ (Eiff 1976, S. 3). Demnach handelt es sich bei der körperlichen Stressreaktion um ein angeborenes Muster. Die Stressreaktion, auch als Alarm- und Notfallreaktion bezeichnet, ist eine entwicklungsgeschichtlich alte Funktion, die der Mensch mit höherentwickelten Tieren gemeinsam hat (vgl. Knörzer 1994, S. 233). Sinn der Stressreaktion ist ursprünglich die Lebenserhaltung durch einen reflexartigen Angriffs- und Fluchtmechanismus. Der vollständige Ablauf dieser Stressreaktion besteht aus drei Phasen, die in Abb.3 dargestellt und in Bsp.1 erläutert sind.
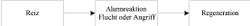
Bsp.1.: (modifiziert) nach Knörzer (1994, S. 233) Ein Steinzeitmensch, nur mit Fellen bekleidet und mit einer Keule bewaffnet, streift durch den Busch. Plötzlich hört er ein Knacken, sieht den Schatten eines sich nähernden gefährlichen Tieres, nimmt dessen Geruch wahr (Reiz). Ohne nachzudenken läuft er blitzschnell davon und bringt sich an einen ruhigen Platz in Sicherheit (Flucht), wo er sich ausruht (Regeneration).
Die Alarmreaktion wird demnach durch einen bedrohlichen Reiz, nämlich das gefährliche Tier, ausgelöst (vgl. Knörzer 1994, S. 233). Der gesamte Organismus ist auf zwei mögliche Verhaltensweisen programmiert: Flucht oder Angriff. Ohne weiteres Nachdenken wird unwillkürlich die Entscheidung für eine der beiden Verhaltensweisen getroffen und diese dann ausgeführt (in diesem Beispiel Flucht). Nach der erfolgten körperlichen Handlung ist eine Ruhepause zur Regeneration des Organismus notwendig (vgl. Olschewski 1995, S. 71). In diesem Zusammenhang gewinnen Entspannung und Entspannungsverfahren als Bewältigungsmaßnahme von Stress an Bedeutung (s. 4.4). Folgende Vorgänge sind für den Ablauf der Stressreaktion verantwortlich. Die von den Sinnesorganen aufgenommenen Wahrnehmungsimpulse laufen sofort in eine Region des Zwischenhirns, wo sie Angst verursachen (Knörzer 1994, S. 233). Hierbei spielt der Hypothalamus eine zentrale Rolle. Wegen seiner doppelten Funktion bei Notfällen wird er von manchen Autoren als „Stresszentrum“ (Zimbardo 19956, S. 578) bezeichnet: er kontrolliert erstens das autonome Nervensystem und zweitens aktiviert er die Hypophyse (vgl. Zimbardo 19956, S. 578).
• Das autonome (oder vegetative) Nervensystem reguliert die Aktivitäten der Körperorgane und untersteht normalerweise nicht der direkten Kontrolle einer Person . Es ist unterteilt in den Sympathikus (zuständig für die Stressreaktion) und den Parasympathikus (zuständig für die Entspannungsreaktion) (vgl. Zimbardo 19956, S. 131f.). Angesichts einer als stressreich bewerteten Bedingung finden (auf der Aktivität des Sympathikus beruhend) folgende physiologische Veränderungen im menschlichen Organismus statt: die Atmung wird schneller und stärker, der Herzschlag beschleunigt sich, die Blutgefäße verengen sich und der Blutdruck steigt. Zusätzlich zu diesen inneren Veränderungen öffnen Muskeln die Wege durch Hals und Nase, um mehr Luft in die Lungen zu lassen. Zugleich verändern sie den Gesichtsausdruck so, dass starke Emotionen sichtbar werden. An die Eingeweidemuskulatur geht die Botschaft, bestimmte Körperfunktionen, zum Beispiel die Verdauung, einzustellen. Die Sexualfunktion und die Immunabwehr, ebenfalls Funktionen, die im Moment der Stressreaktion nicht gebraucht werden, werden „abgeschaltet“ (Olschewski 1995, S. 71). Damit wird jegliche Energie ungeteilt auf die Begegnung mit der Gefahr ausgerichtet. Ferner erfolgt das Signal, dass die Nebennieren die beiden Hormone, Adrenalin und Noradrenalin, ausschütten, die wiederum eine Reihe von Organen anweisen, ihre speziellen Funktionen auszuüben. Die Milz stellt mehr rote Blutkörperchen her, um im Fall einer Verletzung die Blutgerinnung zu unterstützen. Das Knochenmark wird angeregt, mehr weiße Blutkörperchen zu produzieren, um Infektionen zu bekämpfen. Die Leber wird angeregt, die Zuckerproduktion zu steigern, um mehr Energie für den Körper bereitzustellen (vgl. Groetschel 1984, 36ff.). Dabei wird angenommen, dass Adrenalin eine größere Rolle bei Angstreaktionen und Flucht spielt, während Noradrenalin mehr mit Reaktionen der Wut und Gegenwehr zusammenhängt (vgl. Zimbardo 19956, S. 578). • Die Hypophyse reagiert auf die Signale aus dem Hypothalamus, indem sie zwei für die Stressreaktion wesentliche Hormone ausschüttet, das thyrotrophe Hormon und adrenocorticotrophe Hormon (ACTH). Ersteres regt die Schilddrüse an, die ihrerseits dem Körper mehr Energie zur Verfügung stellt. Das stimuliert die Nebennieren, was zur Ausschüttung einer Gruppe von Hormonen führt, die Stereoide heißen und für Stoffwechselprozesse und die Ausschüttung von Zucker aus der Leber ins Blut von Bedeutung sind. ACTH signalisiert verschiedenen Körperorganen die Ausschüttung von etwa dreißig anderen Hormonen , von denen jedes bei der Anpassung des Körpers an den Stressor eine Rolle spielt (vgl. Zimbardo 19956, S. 578).
Der reflexartige Ablauf der Stressreaktion ist für den modernen Menschen genauso überlebensnotwendig wie für den Steinzeitmenschen. Dies lässt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen.
Bsp.2.: (modifiziert) nach Knörzer (1994, S. 234) Eine Person läuft gedankenverloren über eine verkehrsreiche Straße. Plötzlich hört sie das Hupen und die Bremsgeräusche eines Autos. Mit einem schnellen Sprung bringt sie sich auf den Gehsteig in Sicherheit. Die durch das Hupen ausgelöste Alarmreaktion hat bewirkt, dass sie, ohne nachzudenken, blitzschnell der Gefahr ausweichen konnte. Nimmt sich diese Person anschließend auch noch die Zeit, um sich von dem Schreck zu erholen, vielleicht indem sie mehrmals tief durchatmet, bis sich ihr Herzschlag und ihre Atmung wieder beruhigt haben, so ist die Stressreaktion auch hier vollständig und durchaus gesundheitsfördernd verlaufen.
Wenn eine Person blitzartig mit Flucht oder Angriff reagiert, so geschieht dies vollkommen automatisch und unter Ausschaltung des Großhirns. Denn jedes Denken, jede Überlegung wäre Zeitverschwendung und würde eine große Gefahr für das Überleben darstellen. Durch die beschriebenen hormonellen Veränderungen wird der Organismus in einen Zustand gebracht, der zu körperlichen Höchstleistungen befähigt. Wird eines der beiden Handlungsmuster, Angriff oder Flucht durchgeführt, verbraucht der Körper die mobilisierte Energie. Die Überregung der Nervenbahnen wird zurückgedreht. Danach setzt eine Entspannungsreaktion und Aktivierung des parasympathischen Nervensystems ein. Die verbrauchten Kräfte können sich in einer Ruhepause regenerieren. Der Stressmechanismus und seine Folgen sind also ursprünglich und auch heute natürlich und sogar gesundheitsförderlich, da sie eine Person vor größeren Verletzungen schützen (z.B. im Straßenverkehr) und damit lebenserhaltend sind. Insofern stellt sich die Frage, warum Stress die Mehrzahl der gegenwärtigen Krankheiten mitbedingt.
Dazu ist es notwendig Reize (Stressoren), die gegenwärtig die Stressreaktion auslösen, zu betrachten. Am Beispiel des Straßenverkehrs lässt sich erkennen, warum diese Stressreaktionen eine Person krank machen kann. Angenommen aus einer Seitenstrasse schießt ein Auto hervor, nimmt ihr die Vorfahrt, so dass sie gerade noch rechtzeitig ausweichen oder bremsen kann, so ist es für diese Person unmöglich zu fliehen oder anzugreifen. Es ist ganz im Gegenteil wichtig ruhig zu bleiben, um angemessen reagieren zu können. Hinter dem Steuer sitzend kann sie sich nicht körperlich abreagieren, so dass beispielsweise die während der Stressreaktion mobilisierten Fettsäuren nach und nach in Cholesterin umgewandelt werden. Das Cholesterin lagert sich direkt in die Blutgefäße ein, was die Arteriosklerose (eine Zivilisationskrankheit) beschleunigt. Die erhöhten Blutgerinnungsfaktoren steigern zusätzlich die Thrombosegefahr . Die gleichen Stressreaktionen treten auch als Folge von psychischen Stressoren auf, zu deren Bewältigung sie jedoch nicht angemessen sind, da oftmals keine körperliche Aktivität, die zusätzliche Kraft und Energie verbraucht, erforderlich ist (vgl. Zimbardo 19956, S. 586). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass physiologische Stressreaktionen automatische Mechanismen sind, die rasche „Notfallhandlungen“ erleichtern. Sie werden durch den Hypothalamus reguliert und umfassen mehrere Alarmreaktionen des Körpers, die durch die Aktivität des Autonomen Nervensystems und der Hypophyse ausgelöst werden. Sie verringern die Schmerzempfindlichkeit und liefern zusätzliche Energie für Flucht oder Widerstand. Sie sind nützlich bei der Bekämpfung physischer Stressoren, können jedoch in Reaktion auf psychische Stressoren, insbesondere bei schwerem oder andauerndem Stress, schädlich wirken.
Das allgemeine Adaptionssyndrom Selye ist der erste, der die Auswirkungen von andauerndem schweren Stress auf den Körper mit wissenschaftlichen Mitteln untersucht. Als Endokrinologe interessiert er sich für Stressoren, die die Körperfunktionen bedrohen. Nach Selyes Stresstheorie gibt es viele Arten von Stressoren, einschließlich aller Krankheiten und vieler anderer körperlicher und psychischer Bedingungen. Allen ist jedoch gemeinsam, dass sie eine Anpassung des Organismus verlangen, damit dessen Unversehrtheit und Wohlbefinden aufrechterhalten oder wiederhergestellt wird (vgl. Zimbardo 19956, S. 579). Zusätzlich zu den Reaktionen, die für einen bestimmten Stressor spezifisch sind, wie zum Beispiel die Verengung der Blutgefäße als Reaktion auf Kälte, gibt es ein typisches Muster unspezifischer adaptiver physiologischer Mechanismen. Dieses Muster tritt in Reaktion auf eine fortgesetzte Bedrohung durch jeden ernstzunehmenden Stressor auf. Selye bezeichnet dieses Muster als allgemeines Adaptionssyndrom. Er findet eine charakteristische Abfolge von drei Phasen, die dieses Syndrom kennzeichnet: eine Alarmreaktion, eine Phase der Resistenz und eine Phase der Erschöpfung (vgl. Selye 1957, S. 44f.).
• Die Alarmreaktion besteht aus physiologischen Veränderungen, durch die ein bedrohter Organismus unmittelbar die Wiederherstellung seines normalen Funktionsniveau zu erreichen versucht. Ob der Stressor ein physischer ist, wie unzureichende Ernährung, Schlafmangel, Krankheit oder Verletzung, oder ein psychischer, wie Verlust von Liebe oder persönlicher Sicherheit, die Alarmreaktion besteht immer aus dem gleichen allgemeinen Muster körperlicher und biochemischer Veränderungen. Beispielsweise scheinen sich Menschen, die an ganz unterschiedlichen Krankheiten leiden, alle über Symptome wie Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit, Schmerzen in Muskeln und Gelenken, Verlust des Appetits und ein allgemeines Gefühl des Unwohlseins zu beklagen. Im Unterschied zu den Notmaßnahmen der Mobilisierung von Verhaltensreaktionen gegen eine äußere Gefahr, mobilisiert die Alarmreaktion die körpereigene Abwehr zur Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts (vgl. Zimbardo 19956, S. 580). • Dauert die stressauslösende Situation an, so folgt auf die Alarmreaktion die Phase der Resistenz, während der der Organismus einen Widerstand gegenüber dem Stressor zu entwickeln scheint. Obwohl die belastende Stimulation andauert, verschwinden die Symptome, die während der ersten Phase auftreten, und die physiologischen Prozesse, die durch die Alarmreaktion in Aufruhr geraten sind, folgen wieder ihren normalen Abläufen (vgl. Selye 1957, S. 148f.). Diese Resistenz gegen den Stressor scheint hauptsächlich durch gesteigerte Hormonausschüttungen aus dem Hypophysenvorderlappen und den Nebennieren bewirkt zu werden (vgl. Zimbardo 19956, S. 579). Auch wenn es in dieser zweiten Phase eine größere Resistenz gegenüber dem ursprünglichen Stressor gibt, so ist doch die Resistenz gegenüber anderen Stressoren reduziert. Selbst ein schwacher Stressor kann in diesem Stadium eine starke Reaktion hervorrufen, wenn die Ressourcen des Körpers durch den Widerstand gegen einen früheren, mächtigeren Stressor gebunden sind (vgl. Selye 1957, S. 148f.). Beispielsweise stellen einige Menschen fest, dass sie leichter gereizt reagieren, während sie dabei sind, sich von einer Grippe zu erholen. Die allgemeine Resistenz gegenüber Krankheit ist während dieser Phase reduziert, wenn auch die Anpassung an die spezifischen schädlichen Einflüsse verbessert ist (vgl. Zimbardo 19956, S. 579). • Wenn der Organismus den schädlichen Stressoren zu lange ausgesetzt ist, wird ein Punkt erreicht, an dem es ihm nicht länger möglich ist, die Resistenz aufrechtzuerhalten. Dann tritt er in die dritte Phase des allgemeinen Adaptionssyndroms, in die Phase der Erschöpfung. Der Hypophysenvorderlappen und die Nebennieren können die erhöhte Hormonausschüttung nicht länger aufrechterhalten. Das bedeutet, dass der Organismus sich nicht mehr an den Dauerstress anpassen kann. Viele Symptome aus der Phase der Alarmreaktion treten in dieser Phase wieder auf. Wirkt der Stressor weiter auf den Organismus ein, so können laut Zimbardo (19956) „die Zerstörung von Körpergewebe und, im Extremfall, der Tod als Folge eintreten“ (S. 580).
Das Konzept des allgemeinen Adaptionssyndroms hat sich bei der Erklärung von Störungen als nützlich erwiesen, die den Ärzten zuvor verwirrend vorkamen. Innerhalb dieses Rahmens können sie als Ergebnis physiologischer Prozesse betrachtet werden, die mit den andauernden Versuchen des Körpers, mit einem als gefährlich wahrgenommenen Stressor zurechtzukommen, zusammenhängen. Als Mediziner hat sich Selyes Forschung auf physische Stressreaktionen bei Versuchstieren, beispielsweise Ratten im Labor konzentriert (vgl. Selye 1957). Insofern hat seine Theorie wenig über die Bedeutung psychischer Aspekte von Stress beim Menschen zu sagen, insbesondere bezüglich der kognitive Bewertung einer Situation (s.3.3.1), die darüber bestimmt, welche physiologischen Reaktionen auftreten.
Stress und Krankheit In Selyes Theorie wird betont, dass die Stressreaktion als Reaktion auf verschiedene Stressoren, Krankheit eingeschlossen, auftritt. Die Theorie zeigt auch, wie eine lang andauernde Stressreaktion selbst zu Krankheit führen kann (vgl. Zimbardo 19956, S. 580). Beispielsweise hängt Bluthochdruck, eine Krankheit die das Risiko für Herzanfälle und vorzeitigen Tod erhöht mit Stress zusammen. Auch Herz-Kreislauferkrankungen hängen mit der physiologischen Stressreaktion zusammen, da das Herz bei „all diesen Prozessen ständig belastet ist“ (Groetschel 1984, S. 38). Seyle (1957) bezeichnet stressbedingte Krankheiten als „Anpassungskrankheiten“ (diseases of adaptation) (S. 150). Dazu zählt er zum Beispiel „Bluthochdruck, Krankheiten des Herzens und der Blutgefäße, Nierenkrankheiten, [...], rheumatische und rheumatoide Gelenkentzündungen, Entzündungskrankheiten der Haut und der Augen, Infektionskrankheiten, allergische und Überempfindlichkeitskrankheiten, nervöse und geistige Leiden, Sexualstörungen, Krankheiten des Verdauungsapparates, Stoffwechselkrankheiten, Krebs und Krankheiten der Widerstandsfähigkeit im allgemeinen“ (ebd., S. 152). Viele dieser Krankheiten habe ich bereits unter dem Stichwort Zivilisationskrankheiten erwähnt, so dass sich vor dem Hintergrund eines steigenden Stresspegels, auch die Zunahme der stressbedingten Krankheiten erklären lässt.
Nach Zimbardo (19956) können Stressoren auf drei Wegen als kausale Faktoren bei der Entstehung von Krankheiten wirksam werden: • Erstens können lang andauernder schwerer Stress oder chronische Erregung, die aus der Wahrnehmung von Bedrohung entstehen, mit der Zeit zu Ausfällen der physiologischen Funktionen und zu Krankheit führen. Wie bereits erwähnt, ist die „automatische“ körperliche Reaktion für die meisten psychischen Stressoren unangemessen. Sie tritt dennoch auf, und es spielt keine Rolle, ob Menschen sich ängstlich, bedroht oder unter Druck fühlen. Es ist die persönliche Bewertung der Situation, auf die es ankommt, nicht deren objektive Realität. Psychosomatische Störungen sind körperliche Krankheiten, von denen angenommen wird, dass Emotionen und Denkprozesse eine zentrale Rolle spielen. Sie werden oft als Anpassungsstörungen bezeichnet, weil ihre Ursprünge im Versuch des Organismus liegen, sich an Stressoren anzupassen. Magengeschwüre oder hoher Blutdruck sind klassische Beispiele für adaptionsbedingte Krankheiten, wenn auch nicht alle Fälle durch Stress zustande kommen. Viele Krankheiten können ihre Ursachen in physiologischen oder psychischen Faktoren oder einer Kombination von beiden haben. Damit ein chronischer psychischer Stressor zu einer körperlichen Krankheit führt, muss eine Person hinsichtlich eines bestimmten Teils des körperlichen Systems eine konstitutionelle Verwundbarkeit (Vulnerabilität), und einen nicht effektiven Stil zur Bewältigung der Stresssituation aufweisen. Entweder nimmt die Person die chronische emotionale Erregung gar nicht bewusst wahr, oder sie glaubt, es gäbe keine bessere Art, mit der schwierigen Situation umzugehen (vgl. Zimbardo 19956, S. 581).
• Zweitens können Stressoren krank machen, wenn die komplexen physiologischen Mechanismen des allgemeinen Adaptionssyndroms nicht angemessen funktionieren und selbst krankheitsverursachend wirken. Abwehrprozesse, die normalerweise der Wiederherstellung des Normalzustandes dienen, werden in extremer oder unnötiger Weise eingesetzt. Der Körper zeigt eine Überreaktion oder eine unangemessene Antwort auf Stressoren, die seine Stabilität bedrohen können. Da der Körper nicht immer weiß, welche „Angreifer“ potentiell schädlich sind, begeht er in manchen Fällen einen Irrtum und reagiert dann aversiv auf Reize, die in Wirklichkeit gutartig sind. Allergische Reaktionen sind das deutlichste Beispiel dafür: Blütenstaub hat keine direkten schädlichen Auswirkungen auf den Körper und dennoch bringt Blütenstaub bei einigen Personen eine allergische Reaktion hervor. Diese besteht aus einer Entzündung der Nasenschleimhäute und einem allgemeinen Adaptionssyndrom, das den ganzen Körper in Mitleidenschaft zieht. Allergien werden als Anpassungskrankheiten bezeichnet, da der Körper den Stressor als Gefahrenquelle bewertet und eine unnötige Stressreaktion hervorbringt (vgl. Zimbardo 19956, S. 581).
• Drittens kann der kontinuierliche Prozess der Adaption, die dadurch bedingte Erschöpfung des Energievorrates des Organismus und die kumulative Schädigung der Organsysteme zur Erkrankung führen. Jede Person verfügt über begrenzte Energievorräte, die sie nutzen kann, um mit Stressoren umzugehen. Sind sie erschöpft, so kann sie die Stressoren nicht länger bewältigen und wird krank. Dies ist der Grund dafür, dass alle Organismen im Laufe des allgemeinen Adaptionssyndroms schließlich die Phase der Erschöpfung erreichen, wenn der Stressor nicht entfernt wird. Selbst wenn eine Person ein aktives, gesundheitsbewusstes Leben führt, so wird doch bei der erfolgreichen Bewältigung aller spezifischer Stressoren, die auftreten, einige Energie für diese Anpassungsleistung verbraucht. Selye behauptet das Richtige zu tun, bedeute, die eigene Adaptionsenergie gut einzuteilen, statt sie durch Reaktionen auf zivilisationsbedingte „falsche Alarme“, die eine Person besser ignorieren sollte, zu verschwenden (vgl. Selye 1957, S. 317).
Psychische Stressreaktionen
Die physiologischen Stressreaktionen einer Person laufen automatisch und vorhersagbar ab. Es sind reflexhafte Reaktionen, die im Moment einer Notfallsituation (s.Bsp.2.) nicht bewusst kontrolliert werden können. Bei den psychischen Stressreaktionen ist das anders: „Sie sind erlernt und in hohem Maße von unseren Wahrnehmungen und Interpretationen der Welt und unserer Fähigkeiten, mit ihr umzugehen, abhängig“ und enthalten „Aspekte des Verhaltens, der Emotion und der Kognition“ (Zimbardo 19956; S. 581).
Verhaltensmuster Das Verhalten einer Person unter Stress hängt unter anderem davon ab, wie stark der empfundene Stress ist. • Leichter Stress aktiviert und intensiviert biologisch signifikante Verhaltensweisen wie Essen, Aggression und Sexualität. Er erhöht die Wachsamkeit eines Organismus, Energien werden konzentriert, und die Leistung kann gesteigert werden. Positive Verhaltensanpassungen können durch eine Verbesserung der Informationslage erreicht werden, durch Wachsamkeit gegenüber Quellen der Bedrohung, durch Suche nach Schutz und Unterstützung von anderen und durch Erlernen besserer Einstellungen und Bewältigungsmechanismen (vgl. Zimbardo 19956, S. 582). • Andauernder unbewältigter Stress, der von mehreren Stressoren herrührt, kann sich ansammeln und im Laufe der Zeit zunehmend belastend wirken. Er verursacht laut Zimbardo (19956) „fehlangepasste Verhaltensweisen wie erhöhte Reizbarkeit, schlechte Konzentration, beeinträchtigte Produktivität und chronische Ungeduld“ (S. 582). Tritt jedoch jeder dieser Stressoren nur vereinzelt auf, und wird gleichzeitig als kontrollierbar wahrgenommen, verursacht er „keine Probleme“ (Zimbardo 19956, S. 582). • Mäßiger Stress führt typischerweise zum Abbruch von Verhaltensweisen, besonders solchen, die geschulte Koordination erfordern. Für einige Personen besteht die typische Reaktion auf ein mittleres Stressniveau darin, dass sie zuviel essen, besonders nach einer frustrierenden Erfahrung. Mäßiger Stress kann auch wiederholte stereotype Handlungen hervorrufen, wie Herumlaufen im Kreis oder Vor- und Zurückschaukeln. Die Wirkungen dieser wiederholten Reaktionen sind ambivalent. Sie sind „adaptiv, denn sie senken das hohe Niveau der Stimulation durch den Stressor und verringern die Sensibilität der Person gegenüber der Umwelt“ (Zimbardo 19956, S. 582). Gleichzeitig sind sie „nicht adaptiv, denn sie sind rigide und unflexibel und bestehen selbst dann weiter, wenn die Umweltgegebenheiten andere Reaktionen erfordern würden“ (ebd.). • Schwerer Stress hemmt und unterdrückt Verhalten und kann zur völligen Unbeweglichkeit führen. Die Unbeweglichkeit unter schwerem Stress sei eine Abwehrreaktion und stehe für „einen Versuch des Organismus, die erschöpfenden Stresseffekte zu reduzieren oder auszuschalten ... eine Form der Selbsttherapie“ (zitiert nach Zimbardo 19956, S. 583).
Emotionale Aspekte Die Stressreaktion beinhaltet eine ganze Reihe unterschiedlicher emotionaler Antworten. Bewertet eine Person einen Stressor als spannende Herausforderung, die sie bewältigen kann, ist es möglich, dass sie mit einem positiven Gefühl, „einer Art freudiger Erregung“ (ebd.) reagiert. Weit üblicher sind die negativen emotionalen Reaktionen der Reizbarkeit, Wut, Ängstlichkeit, Mutlosigkeit und Depression. Der meiste Stress wird akut als unangenehm empfunden und bringt negative Emotionen und Anstrengungen, das Unbehagen auf direkte oder indirekte Weise zu reduzieren, hervor. Stresserzeugende Veränderungen der Lebensbedingungen, die mit dem Verlust oder der Trennung von Freunden und wichtigen Bezugspersonen zusammenhängen, sind häufig im Vorfeld der Depression zu finden. Allein zurückzubleiben, wenn Personen, die wichtig sind, sterben oder weggehen, scheint mit größerer Wahrscheinlichkeit in eine Depression zu münden, als eine ähnliche Trennung, die durch eigene Handlungen zustande kommt (vgl. Zimbardo 19956, S. 582). Die Erfahrung eines ganzen Bündels stressreicher Ereignisse ist ein weiterer Prädikator für eine depressive Reaktion. Darüber hinaus können Vergewaltigungsopfer, Opfer eines sexuellen Missbrauchs, Überlebende von Flugzeugabstürzen, Naturkatastrophen, Unfälle, Kriegsveteranen und andere, die äußerst traumatische Ereignisse erlebt haben, emotional mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (Stresssyndrom) reagieren. Typisch für diese Reaktion ist das ungewollte Wiedererleben des traumatischen Ereignisses, besonders des ursprünglichen Gefühls von Schock, Furcht und Schrecken in Träumen oder Rückblenden. Zusätzlich dazu erleben die Überlebenden eine emotionale Abstumpfung gegenüber alltäglichen Ereignissen, was mit Gefühlen der Entfremdung von anderen Menschen zusammenhängt. Schließlich kann der emotionale Schmerz dieser Reaktion zu einer Verschlimmerung verschiedener Symptome führen, wie etwa zu Schlafstörungen, Schuldgefühlen, überlebt zu haben, Konzentrationsstörungen und einer gesteigerten Schreckreaktion. Die emotionalen Reaktionen des posttraumatischen Stresssyndroms können in akuter Form direkt nach einer Katastrophe auftreten und nach einer Phase von mehreren Monaten abklingen. Das Syndrom kann auch bestehen bleiben und chronisch werden. Dann wird es als „residuales Stresssyndrom“ (Zimbardo 19956, S. 583) bezeichnet. In den klinischen Einrichtungen der Vereinigten Staaten werden immer wieder Veteranen des zweiten Weltkrieges und des Koreakrieges entdeckt, die ein residuales oder ein verzögertes posttraumatisches Stresssyndrom aufweisen (vgl. Zimbardo 19956, S. 583). Aus aktuellem Anlass, seit den Terroranschlägen am 11. September 2001, taucht das Kürzel für die posttraumatische Belastungsstörung PTBS auch immer wieder in den Medien auf.
Kognitive Auswirkungen Ist ein Stressor einmal als bedrohlich für das eigene Wohlbefinden oder für das Selbstwertgefühl beurteilt worden, so kann eine Reihe verschiedener intellektueller Funktionen nachteilig beeinflusst werden. Die Verringerung der kognitiven Effizienz und die Störungen des flexiblen Denkens sind im Allgemeinen um so gravierender, je größer der Stress ist. Kognitive Stressreaktionen umfassen eine Einengung der Aufmerksamkeit, Rigidität des Denkens sowie Störungen des Urteilsvermögens, des Problemlösens und des Erinnerungsvermögens (vgl. Zimbardo 19965, S. 585). • Aufmerksamkeit ist eine Ressource, die Grenzen hat. In einem Experiment wurde herausgefunden, dass selbst „die Durchführung einer einfachen [...] Aufgabe behindert [ist], wenn man etwas anderes im Kopf hat’“ (Zimbardo 19956, S. 229; Anpassung: E. K.). Die Konzentration auf die bedrohlichen Aspekte einer Situation und auf die eigene Erregung senkt deshalb den Anteil an Aufmerksamkeit, der zur wirksamen Bewältigung der anstehenden Aufgaben zur Verfügung steht. • Auch das Gedächtnis wird beeinträchtigt, weil das Kurzzeitgedächtnis durch den Teil an Aufmerksamkeit begrenzt wird, der neuem Input zukommt. Daneben hängt das Abrufen relevanter Erinnerungen aus der Vergangenheit von der reibungslosen Bearbeitung der angemessenen Hinweisreize ab. • In ähnlicher Weise kann Stress Prozesse des Problemlösens, der Urteilsbildung und der Entscheidungsfindung stören: die Wahrnehmung von Alternativen wird eingeschränkt, und statt kreativer Reaktionen tritt stereotypes, rigides Denken auf. • Schließlich kann ein chronisches Gefühl der Bedrohung auch auf ganz normale Situationen übertragen werden. Beispielsweise kann eine Person mit Prüfungsangst, diese Angst auch auf Diskussionen in einer Bildungsveranstaltung übertragen (vgl. Zimbardo 19956, S. 584).
Stress - ein aktuelles Thema
Wie schon erwähnt findet der Begriff Stress 1950 Eingang in die Medizin und die Psychologie. Vor über 50 Jahren kannten dieses Wort allenfalls Physiker. Mittlerweile hat Stress nicht nur sprachlich den Alltag durchdrungen. Viele Wissenschaftler sehen in ihm ein zentrales Problem der Leistungsgesellschaft. Auch Arbeitgeber, Gewerkschaftler und Politiker attestieren ihm Wachstumsraten, die sie bedenklich finden. Die WHO hat Stress zu „einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts“ (Possemeyer 2002, S. 148) erklärt.
Das Phänomen Stress wird gegenwärtig sowohl im Alltag als auch in der Forschung mit sämtlichen Lebensbereichen in Zusammenhang gebracht: z.B. Stress im persönlichen Bereich, in der Schule, in der Freizeit oder am Arbeitsplatz. Wissenschaftler verschiedener Forschungsrichtungen machen Stress zum Gegenstand ihrer Untersuchungen. Zum Beispiel beschäftigt sich Hurrelmann (1990) mit Familienstress, Schulstress und Freizeitstress. In jüngster Zeit erforschen Wissenschaftler, wie zum Beispiel Schneewind (19992) oder Fthenakis et al. (1999) Stress im familiären Bereich. Stress wird häufig als Krankheit der Gegenwart bezeichnet. Fast jede Person kennt aus Erfahrung Situationen, in denen sie sich beruflich oder privat überfordert und überlastet fühlt, in denen sie gereizt, hektisch oder nervös ist. Gefühle des Ärgers, der Wut, der Ohnmacht oder der Niedergeschlagenheit sind deutliche Zeichen für Stress.
Das Gleichgewicht zwischen An- und Entspannung, Aktivität und Ruhe, Stress und Erholung ist demzufolge gegenwärtig allzu oft gestört und entspricht nicht mehr dem naturgegebenen Harmonieprinzip. Stress gehört zum Leben, durch Stress kann wie schon erwähnt sogar die Leistungsfähigkeit erhöht werden. Zu viel Stress kann aber gleichzeitig krank machen. Alarmierende Statistiken zeigen, dass die ursprünglichen biologischen Abwehrkräfte oft nicht mehr ausreichen oder manchmal ungeeignet sind, den Organismus vor Dauerschäden zu bewahren. Wie bereits erwähnt waren 1995 über zwei Drittel der Krankheiten stressbedingt. Ich gehe davon aus, dass diese Zahl nicht gesunken ist . Gegenwärtig wirkt sich Stress besonders negativ aus, da soziale Normen das körperliche Ausagieren der physiologischen Stressreaktion nur selten zulassen. Es ist für eine Person unangebracht zu fliehen, oder zu kämpfen, wenn sie beispielsweise eine öffentliche Rede halten soll. Zusätzlich ist die Zahl der stressauslösenden Reize enorm gestiegen, so dass viele Personen keine Zeit finden, sich zu regenerieren. Schließlich lösen innere Einstellungen (z.B. Sorgen, negative Erwartungen, Ängste) Stress aus (Wagner-Link 1987, S. 8f.). Eine repräsentative Umfrage des Emnid Institutes im Januar 2003, mit der Frage: „Wovor haben sie am meisten Angst?“, zeigt aktuelle Ängste der deutschen Bevölkerung. Nach dieser Angst-Skala rangiert die Angst vor Krieg und Terroranschlägen (mit 38%) an erster Stelle, gefolgt von der Angst vor Krankheiten (26%), der Angst vor Arbeitslosigkeit (14%), der Angst vor Gewalt und Kriminalität (10%) und der Angst vor finanzieller Not und Schulden (9%) (vgl. Angst-Skala 2003). Demnach betrifft beispielsweise die Angst um einen Arbeitsplatz einen großen Teil der deutschen Bevölkerung. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass die Arbeitslosenquote in einem Zeitraum von nur 3 1/2 Jahren konstant gestiegen ist: von ca. 10% zu Beginn des Jahres 2000 (vgl. Böeser; Schörner; Wolters 20002, S. 17) auf 10,4% Ende Juli 2003 (Pressestelle des Arbeitsamtes Augsburg).
Dauerstress ist, wie bereits dargestellt, nicht nur Mitverursacher zahlreicher Erkrankungen, sondern kann sich auch indirekt negativ auswirken. So steigt beispielsweise das Unfallrisiko aufgrund der mangelnden Konzentrationsfähigkeit in einer Belastungssituation. Außerdem nimmt die Leistungsfähigkeit ab und die von Stress betroffene Person fühlt sich häufig unwohl bzw. ungesund. In der heutigen Zeit besteht weniger eine körperliche Überlastungssituation als vielmehr Überlastungssituationen im geistig-seelischen Bereich. Die meisten Personen leiden unter massiver Reizüberflutung, der Hektik des Alltags bei gleichzeitig geringerem sozialen Kontakt (die Zeit für Gespräche und andere Unternehmungen in der Familie ist knapp, die Familie sitzt viel vor dem Fernseher, der Vater ist selten zuhause, Kinder leiden unter Schulstress und es besteht ein innerer Zwang zu vielen Hobbytätigkeiten) (vgl. Hurrelmann 1990, Schneewind 19992, Fthenakis et al. 1999). Körperlich besteht ein chronischer Unterforderungszustand, im Durchschnitt besteht Bewegungsmangel. Um dies zu kompensieren, versuchen sich viele Personen z.B. durch Fernsehen zu entspannen, was oftmals gerade zur Anspannung führt (z.B. innere und damit äußere Anspannung bei einem Fußballspiel). Personen in Belastungssituationen verhalten häufig gesundheitsschädigend: sie rauchen mehr, ernähren sich ungesund oder trinken mehr Alkohol, um sich eine Entspannungssituation zu verschaffen. Gerade diese Bewältigungsstrategien tragen dann noch vermehrt zum eigenen Stress bei. Die Situation schaukelt sich auf, viele Personen versuchen diesen Teufelskreis mit Medikamenten zu kompensieren (vgl. Olschewsky 1995). Damit verlässt sich der Betroffene auf Hilfe von außen, so dass die Selbstheilungskräfte (z. B. in Form von Entspannung) die jeder Person naturgemäß zueigen sind, außer acht gelassen werden. In der Bundesrepublik Deutschland ist es weit verbreitet, anstelle von den in den Alltag integrierten Erholungsphasen ein Medikament einzunehmen, das schlaffördernd wirkt, und morgens ein Mittel einzunehmen, das die Wirkung des Schlafmittels vertreibt und eine Person besser aufwachen lässt (z.B. Kaffee). Die betroffene Person scheint sich dieser Abläufe meist nicht bewusst zu sein.
Die in Deutschland weitverbreitete „Kultur des Kaffeetrinkens“ ist ein Beleg dafür, dass viele nicht wissen, dass auch die Ernährungsweise für den Organismus einen Stressor (biochemischer Art) darstellen kann, und insofern auf Dauer schädlich wirkt. Da dieser Aspekt in den mir vorliegenden Stresstheorien nicht explizit erwähnt wird, und da ich ihn für sehr bedeutend hinsichtlich des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens halte, soll er an dieser Stelle Eingang finden. Beispielsweise entsteht durch den Genuss von Kaffee im Körper Gerbsäure. Diese Säure muss der Körper so schnell wie möglich neutralisieren, damit sie nicht seine Zellen, Organe und Drüsen verätzen und in ihrer Funktion beeinträchtigen. Für diesen Neutralisierungsvorgang benötigt er Mineralstoffe. Diese bezieht er entweder aus der zugeführten Nahrung oder, was aufgrund einer unausgewogenen Ernährung gegenwärtig bei vielen Personen der Fall ist, aus den körpereigenen Depots, wie zum Beispiel aus den Zähnen, den Knochen, den Nägeln und der Haut. Die neutralisierten Säuren werden als sogenannten Schlacken im Körper abgelagert (vgl. Jentschura; Lohkämper 200310, S. 48f.). Die gesundheitlichen Folgen sind gravierend. Zum einen wird mit dem Entzug der körpereigenen Mineralstoffe zum Beispiel die zunehmende Anzahl von Osteoporoseerkrankungen erklärt (vgl. Corazza et al. 2001, S. 666ff.), zum anderen erklärt die Ablagerung der neutralisierten Säuren beispielsweise die hohe Anzahl (1,8 Millionen) der an Gicht erkrankten Personen (vgl. Jentschura; Lohkämper 200310, S. 30). In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass durch Stress, Angst und Ärger Salzsäure entsteht, die genauso neutralisiert werden muss. Interessant ist außerdem die Tatsache, dass unter körperlicher Anstrengung Milchsäure entsteht, was bedeutet, dass Sport den Körper in diesem Sinne auch stressen kann. Vor allem, wenn sich eine Person als Ausgleich zu einem anstrengenden Tag sportlich betätigt, und sich dabei im Sinne eines leistungsorientierten Denkens (z.B. heute laufe ich schneller) oder im Sinne eines konkurrenzorientierten Denkens (meine sportliche Leistung soll besser als die der anderen sein) unter Druck setzt. Die „[k]örperliche Aktivität unter der Maxime höher, schneller, weiter’ hat keinerlei Entspannungswert, sondern ist Stress mit anderen Mitteln“ (Schaufler 2000, S. 130; Anpassung: E. K.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Phänomen Stress ambivalent ist: der leistungsbezogene Alltag erfordert gegenwärtig nahezu die gesamte Energie einer Person. Gleichzeitig kann eine Person ohne Stress nicht leben. So wie sie ohne körperliche Anstrengung weder Muskeln noch Ausdauer entwickelt, braucht eine Person auch psychische Belastungen im Sinne von Herausforderungen, um ihr Verhalten einer sich ständig wandelnden Umwelt anzupassen und Neues zu erlernen. Stress spielt zwar eine Rolle in der Entstehung, Erhaltung und Verschlechterung von Erkrankungen. Die Überwindung und Bewältigung von Stress führt aber zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, zur Erhöhung der Widerstandskraft und stellt damit eine Prophylaxe gegenüber Krankheiten dar. Krankheit kann zwar selbst ein Stressor sein, da Bedürfnisse nicht befriedigt werden können und Handlungsmöglichkeiten und -fähigkeiten eingeschränkt sind. Aber Krankheit kann auch dazu führen, dass der Kranke sich ein für seine Person und seine Umwelt adäquateres Verhalten aneignet und damit weniger in Stress kommt, was häufig bei den Herzinfarktpatienten der Fall ist (vgl. Scheuch 1989, S. 91). Es scheint von großer Bedeutung zu sein, mit der eigenen Energie optimal haushalten zu können, um Überforderungen zu vermeiden. Damit Spannungszustände erfolgreich bewältigt werden und Stress nicht zum krankmachendem Distress wird, ist ein umfassendes Stressmanagement erforderlich. Dies soll Thema des nächsten Kapitels sein.
Literatur
- Abele, Andrea; Becker, Peter (Hg.) 1991: Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik. Juventa Verlag: Weinheim, München.
- Antonovsky, Aaron 1997: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Dgvt-Verlag: Tübingen.
- Arnold, Rolf; Nolda, Sigrid; Nuissl, Ekkehard (Hg.) 2001: Wörterbuch Erwachsenenpädagogik. Julius Klinkhardt.
- Bengel, Jürgen; Strittmatter, Regine; Willmann, Hildegard 20027: Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese. Diskussionsstand und Stellenwert. Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung. Bd.6. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Köln.
- Bernstein, Douglas A.; Borkovec, Thomas D. 19782: Entspannungs-Training. Handbuch der progressiven Muskelentspannung. J. Pfeiffer Verlag: München.
- Berufsverband Deutscher Yogalehrer (Hg.) 20003: Der Weg des Yoga. Handbuch für Übende und Lehrende. Via Nova Verlag: Petersberg.
- Bögle, Reinhard 1996: Yoga. Ein Weg für Dich. Einblick in die Yoga-Lehre. Bechtermünz Verlag: Augsburg.
- Bollnow, Otto Friedrich 19653: Existenzphilosophie und Pädagogik. Versuch über unstetige Formen der Erziehung. Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz.
- Bösel, Rainer et al. 1978: Streß. Einführung in die psychosomatische Belastungsforschung. Hoffmann und Campe Verlag: Hamburg.
- Boeser, Christian; Schörner, Thomas; Wolters, Dirk (Hg.) 20022: Kinder des Wohlstands. Auf der Suche nach neuer Lebensqualität. Verlag für Akademische Schriften: Frankfurt/Main
- Brockhaus, F. A. (Hg.) 20029: Der Brockhaus in einem Band. F.A. Brockhaus: Leipzig.
- Brockhaus, F. A. (Hg.) 19847: Der neue Brockhaus. F. A. Brockhaus: Wiesbaden.
- Brüderl, Leokadia (Hg.) 1988: Theorien und Methoden der Bewältigungsforschung. Juventa Verlag: Weinheim, München.
- Bund der Yoga Vidya Lehrer (Hg.) 20006: Handbuch zur Yoga-Schulung und Yogalehrer-Ausbildung. Yoga Vidya Verlag Volker Bretz: Oberlahr.
- Corazza, Verena et al. 2001: Kursbuch Gesundheit. Kiepenheuer und Witsch: Köln.
- Ebert, Dietrich 1986: Physiologische Aspekte des Yoga und der Meditation. Hippokrates: Stuttgart.
- Eliade, Mircea 1977: Yoga. Unsterblichkeit und Freiheit. Insel Verlag: Frankfurt am Main.
- Eiff, August Wilhelm von 1976: Seelische und körperliche Störungen durch Streß. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart.
- Faltermaier, Toni 1994: Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitshandeln. Über den Umgang mit Gesundheit im Alltag. <a href="https://www.yoga-vidya.de/yoga-psychologie/">Psychologie</a> Verlags Union: Weinheim.
- Fischer-Schreiber, Ingrid et al. (Hg.) 19942: Lexikon der östlichen Weisheitslehren. Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Zen. Otto Wilhelm Barth Verlag: Bern, München, Wien.
- Forschungsverbund Laienpotential (Hg.) 1987: Gesundheitsselbsthilfe und professionelle Dienstleistungen. Springer: Berlin.
- Frauwallner, Erich 1953: Geschichte der indischen Philosophie. Die Philosophie des Veda und des Epos der Buddha und der Jina. Das Samkhya und das klassische Yoga-System. Otto Müller Verlag: Salzburg.
- Fthenakis, Wassilios E. et al. 1999: Engagierte Vaterschaft. Die sanfte Revolution in der Familie. Leske+Budrich: Opladen.
- Fuchs, Christian 1990: Yoga in Deutschland. Rezeption, Organisation, Typologie. Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln.
- Fuchs, Christian 1992: Geschichte und Gegenwart des Yoga in Deutschland. In: Deutscher Volkshochschulverband e.V., Fachstelle für internationale Zusammenarbeit (Hg.). Volkshochschulen und der Themenbereich Afrika, Asien und Lateinamerika. Materialien 33. Yoga und Indien. Bonn.
- Graham, Ian; Takala Jukka; Machida, Seiji 2003: Safety Culture at work. International Labour Office: Genf.
- Groetschel, Rose 1984: Belastungen, Bewältigungsressourcen und Herz-Kreislauf-Risiken. Bremen.
- Hamm, Alfons 20002: Progressive Muskelentspannung. In: Vaitl, Dieter; Petermann, Franz (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. <a href="https://www.yoga-vidya.de/yoga-psychologie/">Psychologie</a> Verlags Union: Weinheim.
- Haug, Christoph V. 1991: Gesundheitsbildung im Wandel. Klinkhardt: Bad Heilbrunn/Obb.
- Haring, Claus 1979: Lehrbuch des autogenen Trainings. Ferdinand Enke Verlag: Stuttgart.
- Heckhausen, Heinz 1989: Motivation und Handeln. Springer: Heidelberg.
- Herriger, Norbert 1997: Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln.
- Hoffmann, Bernt 200014: Handbuch Autogenes Training. Grundlagen, Technik, Anwendung. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co KG: München.
- Hurrelmann, Klaus 1990: Familienstress, Schulstress, Freizeitstress. Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche. Beltz: Weinheim, Basel
- Jacobson, Edmund 19994: Entspannung als Therapie. Progressive Relaxation in Theorie und Praxis. Klett-Cotta: Stuttgart.
- Jacquemart, Pierre; Elkefi, Saida 1996: Yoga als Therapie. Lehrbuch für die Arzt- und Naturheilpraxis. Weltbildverlag: Augsburg.
- Jentschura, Peter; Lohkämper, Josef 200310: Gesundheit durch Entschlackung. Verlag Peter Jentschura: Münster.
- Keller, Josef A.; Novak Felix 19932: Kleines Pädagogisches Wörterbuch. Herder: Freiburg, Basel, Wien.
- Keupp, Heiner 1997: Ermutigung zum aufrechten Gang. Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie: Tübingen.
- Kirschner, Wolf et al. 1995: §20 SGB V. Gesundheitsförderung; Krankheitsverhütung. Untersuchung zur Umsetzung durch die Krankenkassen. Bd.6. Asgard: Sankt Augustin.
- Knörzer, Wolfgang 1994: Zur Selbstkompetenz von Lehrenden unter besonderer Berücksichtigung der Körperwahrnehmung und Körpererfahrung im Rahmen eines Modells ganzheitlicher Gesundheitsbildung. Heidelberg.
- Kossak, Hans-Christian 20002: Hypnose. In: Dieter, Vaitl; Franz, Petermann (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Klebert, Karin, Schrader, Einhard, Straub Walter G. 1987: KurzModeration. Windmühle: Hamburg.
- Kraft, Hartmut 19892: Autogenes Training. Methodik, Didaktik und Psychodynamik. Hippokrates: Stuttgart.
- Krampen, Günther; Ohm, Dietmar 1994: Prävention und Rehabilitation: In: Franz Petermann; Dieter, Vaitl, (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.2. Anwendungen. Beltz Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Kriegisch, Norbert; Zittlau, Jörg 19972: Das große Buch der gesunden Ernährung. B&S Reihenwerke Verlags GmbH: Stuttgart.
- Langen, Dietrich (Hg.) 1968: Der Weg des Autogenen Trainings. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt.
- Langmaack, Barbara; Braune-Krickau, Michael 19955: Wie die Gruppe laufen lernt. Anregungen zum Planen und Leiten von Gruppen. Ein praktisches Lehrbuch. Psychologie Verlags Union: München.
- Lidell, Lucy 1985: Yoga für alle Lebensstufen. Gräfe und Unzer: München.
- Lindemann, Hannes 19795: Überleben im Stress. Autogenes Training. Der Weg zu Entspannung, Gesundheit, Leistungssteigerung. Heyne: München.
- Lysebeth, André v. 1970: Yoga für Menschen von heute. Bertelsmann: Gütersloh.
- Macha, Hildegard; Mauermann, Lutz (Hg.) 1997: Brennpunkte der Familienerziehung. Deutscher Studien Verlag: Weinheim.
- Massoth, Peter; Massoth, Eva 1984: So gesund wie möglich. Selbsthilfe in kranken Zeiten. Beltz: Weinheim, Basel.
- Mensen, Herbert 1997: Das autogene Training. Entspannung, Gesundheit, Stressbewältigung. Wilhelm Goldmann: München.
- Mumford, John 1982: Psychosomatischer Yoga. Der östliche Pfad zu geistigem und körperlichem Wohlbefinden. Sphinx: Basel.
- Oda, Hiroshi 2001: Spontanremissionen bei Krebserkrankungen aus der Sicht des Erlebenden. Psychologie Verlags Union, Verlagsgruppe Beltz: Weinheim.
- Olschewski, Adalbert 1995: Streß bewältigen. Ein ganzheitliches Kursprogramm. Karl F. Haug Verlag: Heidelberg.
- Patanjali 19824: Die Wurzeln des Yoga. Die klassischen Lehrsprüche des Patanjali. Die Grundlage aller Yoga-Systeme. Otto Wilhelm Barth Verlag: Bern, München, Wien.
- Payne, Rosemary A. 1998: Entspannungstechniken. Ein praktischer Leitfaden für Therapeuten. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm.
- Petermann, Franz; Vaitl, Dieter (Hg.) 1994: Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.2. Anwendungen. Beltz Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Riemann, Gerhard (Hg.) 1996: Paramahansa Yogananda interpretiert die Rubaijat des Omar Chajjam. Knaur: München.
- Schaufler, Birgit 2000: Frauen in Führung. Von Kompetenzen, die erkannt und genutzt werden wollen. Huber: Bern, Göttingen, Toronto, Seattle.
- Schenk, Christoph 1993: Streß bewältigen durch Entspannung. Mit Anleitungen zum Autogenen Training. Falken Verlag GmbH: Niederhausen.
- Scheuch, Klaus 19893: Streß. Gedanken, Theorien, Probleme. Verlag Volk und Gesundheit: Berlin.
- Schiffer, Eckhard 2001: Wie Gesundheit entsteht. Salutogenese. Schatzsuche statt Fehlerfahndung. Beltz: Weinheim, Basel.
- Schmidt, Karl O. 19906: Seneca. Der Lebensmeister. Drei Eichen Verlag: Ergolding.
- Schneewind, Klaus 19992: Familienpsychologie. Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln.
- Schott, Heinz; Wolf-Braun, Barbara 20002: Zur Geschichte der Hypnose und der Entspannungsverfahren. In: Vaitl, Dieter; Petermann, Franz (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Schultz, Johannes Heinrich 198217: Das autogene Training. Konzentrative Selbstentspannung. Versuch einer klinisch-praktischen Darstellung. Georg Thieme Verlag: Stuttgart.
- Schwarzer, Ralf 19962: Psychologie des Gesundheitsverhaltens. Hogrefe: Göttingen.
- Selye, Hans 1957: Stress beherrscht unser Leben. Rombach&Co: Freiburg i. Br.
- Sivananda, Radha Swami 1991: Geheimnis Hatha Yoga. Symbolik, Deutung. Praxis. Bauer Verlag: Freiburg im Breisgau.
- Tausch, Reinhard 1993: Hilfen bei Streß und Belastung. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH: Reinbek bei Hamburg.
- Trökes, Anna 2000: Das große Yoga Buch. Das moderne Standardwerk zum Hatha-Yoga. Gräfe und Unzer: München.
- Vaitl, Dieter 20002: Autogenes Training. In: Vaitl, Dieter; Petermann, Franz (Hg.). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Vaitl, Dieter; Petermann, Franz (Hg.) 20002: Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd.1. Grundlagen und Methoden. Psychologie Verlags Union: Weinheim.
- Venth, Angelika (Hg.) 1987: Gesundheit und Krankheit als Bildungsproblem. Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung. Klinkhardt: Bad Heilbrunn/Obb.
- Vishnudevananda, Svami 1984: Das große illustrierte Yoga-Buch. Gräfe und Unzer: Freiburg im Breisgau.
- Vester, Frederic 1976: Phänomen Stress. Wo liegt sein Ursprung, warum ist er lebenswichtig, wodurch ist er entartet. Deutsche Verlags-Anstalt GmbH: Stuttgart.
- Wagner-Link, Angelika 1989: Aktive Entspannung und Stressbewältigung. Wirksame Methoden für Vielbeschäftigte. Expert Verlag: Ehningen; Taylorix Verlag: Stuttgart.
- Watzlawick, Paul 200122: Anleitung zum Unglücklichsein. Piper Verlag GmbH: München.
- Watzlawick, Paul 200113: Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben. Piper: München, Zürich.
- Weber, Erich (Hg.) 19958: Pädagogik. Eine Einführung. Bd.1. Grundfragen und Grundbegriffe. Teil 1. Pädagogische Anthropologie. Phylogenetische (bio- und kulturrevolutionäre) Voraussetzungen der Erziehung. Ludwig Auer GmbH: Donauwörth.
- Weber, Erich (Hg.) 19968: Pädagogik. Eine Einführung. Bd.1. Grundfragen und Grundbegriffe. Teil 2. Ontogenetische (entwicklungspsychologische und lebensgeschichtliche) Voraussetzung der Erziehung. Notwenigkeit und Möglichkeit der Erziehung. Ludwig Auer GmbH: Donauwörth.
- Wermke, Matthias et al. (Hg.) 20017: Duden. Das Fremdwörterbuch. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG: Mannheim.
- Wolpe, Joseph 1972: Praxis der Verhaltenstherapie. Hans Huber Verlag: Bern, Stuttgart, Wien.
- Yesudian, Selvarajan; Haich, Elisabeth 197220: Sport und Yoga. Drei Eichen Verlag: München.
- Zimbardo, Philip G. 19956: Psychologie. Springer Verlag: Berlin, Heidelberg, New York.
Zeitschriften:
- Bartsch, Norbert et al. (Hg.) 2000: Prävention. Zeitschrift für Gesundheitsförderung. Das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000, der GKV-Leitfaden und die GKV-Selbsthilfe-Grundsätze. 23, Heft 3.
- Huber, Andreas 1995: Streß-Management. Auf der Suche nach einer neuen Entspannungskultur. In: Psychologie Heute. 22, Heft 10.
- Possemeyer, Ines 2002: Zivilisationsplage Stress. Die Ursachen, die Folgen, die Auswege. In: Geo. Heft 3.
- Roth-Hunkeler, Theres 1997: Wellness Trainer/innen haben nicht nur Fitness im Sinn. In: Education permanente. 31, Heft 4.
- Schwab, Dieter 1997: Megatrend Gesundheit. In: Psychologie Heute. 22, Heft 10, S. 29-31.
- Schwarzer, Ralf 1994: Volitionstheorie der Gesundheitserziehung. In: Zeitschrift für Pädagogik. Gesundheitserziehung. 40, Heft 6.
- Tenzer, Eva 2003: Wellness. Das Widerstandsprogramm gegen den Alltagsstress. In: Psychologie Heute. 30, Heft 8.
- Unverzagt, Gerlinde 1997: Den Menschen aus dem Tiefschlaf wecken. Yoga ist eine wirksame Methode gegen Zeitkrankheiten. In: Psychologie Heute. 24, Heft 3.
- Venth, Angelika 1994: Gesundheitsförderung durch Erwachsenenbildung als Unterstützung von Selbsthilfe. Das Konzept von Gesundheitsbildung an Volkshochschulen. In: Nakos Extra. 23, Heft 1.
Weblinks
- Angst-Skala 2003
http://www.flensburg-online.de/diverses/angst-skala-2003.html
- Fthenakis, Wassilios E. 2000: Hat Familie Zukunft? Neue Herausforderungen für Familienberatung, Familienbildung und Familienpolitik.
http://www.fthenakis.de/Vortrag_Arbeitstagung_2000-01-11.pdf